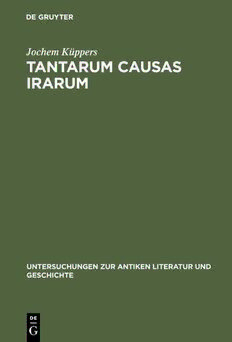Table Of ContentJochem Küppers
Tantarum causas irarum
w
DE
G
Untersuchungen zur
antiken Literatur und Geschichte
Herausgegeben von
Winfried Bühler, Peter Herrmann und Otto Zwierlein
Band 23
Walter de Gruyter · Berlin · New York
1986
Tantarum causas irarum
Untersuchungen zur einleitenden Biicherdyade
der Punica des Silius Italicus
von
Jochem Küppers
Walter de Gruyter · Berlin · New York
1986
Als Habilitationsschrift auf Empfehlung der Philosophischen Fakultät der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn gedruckt mit Unterstützung
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Gedruckt auf säurefreiem Papier
(alterungsbeständig — pH 7, neutral)
CIP-Kur^titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Küppers, Jochem:
Tantarum causas irarum : Unters, zur einleitenden Bücherdyade d.
Punica d. Silius Italicus / von Jochem Küppers. — Berlin ; New
York : de Gruyter, 1986.
(Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte ; Bd. 23)
ISBN 3-11-010610-8
NE: GT
©
1986 by Walter de Gruyter & Co., Berlin 30, Genthiner Straße 13.
Printed in Germany
Alle Rechte, insbesondere das der Ubersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne
ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet, dieses Buch oder Teile
daraus auf photomechanischem Wege (Photokopie, Mikrokopie, Xerokopie) zu vervielfältigen.
Satz und Druck: Arthur Collignon GmbH, Berlin 30
Einband: Lüderitz & Bauer, Berlin 61
Vorwort
Die vorliegenden Untersuchungen zu den beiden einleitenden Büchern
der Punica des Silius Italicus wurden im Wintersemester 1983/84 von der
Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn als Habilitationsschrift angenommen. Für den Druck erfuhren sie
in einzelnen Punkten eine Überarbeitung, die zumeist durch die fördernde
Kritik der von der Fakultät bestellten Gutachter angeregt wurde. In dieser
Hinsicht danke ich namentlich den Professoren H. Erbse und D. Schaller
sowie vor allem Professor O. Zwierlein, der mir bei der Beurteilung der
Frage nach Disposition und Umfang des silianischen Proömium wichtige
Hinweise gab (vgl. 36 ff. bes. 38 f.). Mein besonderer Dank gilt aber Profes-
sor W. Schetter, der meine Arbeit an den Punica stets mit wertvollen Rat-
schlägen förderte.
Zu danken habe ich außerdem den Herausgebern der .Untersuchungen
zur antiken Literatur und Geschichte', daß sie diese Arbeit in ihre Reihe
aufgenommen haben, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, daß sie
einen großzügigen Zuschuß zu den Druckkosten gewährte, und dem
Verlag, daß dieses Buch rasch und in so ansprechender Form gedruckt
wurde.
Wesentlichen Anteil am Zustandekommen dieser Arbeit hat aber auch
meine Frau, die neben häufiger Rücksichtnahme mir immer wieder Mut
zusprach. Dafür möchte ich ihr auch an dieser Stelle ausdrücklich danken.
Bonn 1985 J.K.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Einleitung 1
A. Inhalt und Aufbau der beiden Anfangsbücher der Punica und ihre
Stellung im Gesamtwerk 4
1. Inhaltliche und kompositionelle Grundzüge von Buch 1 und 2
der Punica 4
2. Die einleitende Bücherdyade im Rahmen des Gesamtwerkes 11
B. Das Proömium und die Geschehensexposition bis zu Hannibals
Angriff auf Sagunt (Sil. 1,1-270) 22
1. Die silianische Gestaltung des Proömium zum Gesamtwerk 22
1.1 Umfang und Disposition des silianischen Proömium ... 22
1.2 Die silianische Themenangabe (Sil. 1,1 — 16): Traditionelle
Proömiengestaltung und inhaltliche Eigenständigkeit ... 45
2. Mythologische und historische Begründung des 2. Punischen
Krieges 61
2.1 Die Kausalkette: Dido — Juno — Hannibal und Hannibals
Schwur 61
2.2 Der Schwur Hannibals und Didos Fluch 73
2.3 Der weitere Gang der Handlung bis zu Hannibals Angriff
auf Sagunt 92
C. Der Kampf um Sagunt 107
1. Makrostruktur und Darstellungsweise der silianischen Schilde-
rung 107
2. Thematische Leitlinien und epische Gestaltung des Geschehens
in und um Sagunt 123
2.1 Hannibals Sturm auf Sagunt und das Eingreifen des Mur-
rus (Sil 1,271-555) 125
2.2 Asbyte und ihre .Amazonen' (Sil. 2,56-269) 141
2.3 Sagunts Untergang (Sil. 2,391-695) 153
2.3.1 Hannibals Schild (Sil. 2,395-456) 154
2.3.2 Sagunts Selbstvernichtung im Widerstreit von Fides
und Tisiphone (Sil. 2,457-695) 164
D. Die Grundzüge silianischer Darstellungs- und Erzählweise in der
einleitenden Bücherdyade 171
Exkurs: Zum Problem der Großkomposition der Punica 176
Literaturverzeichnis 193
Register 199
Einleitung
Eine intensivere Beschäftigung mit den Punica des Silius Italicus,
dem — neben Lukans Gedicht vom Bürgerkrieg — zweiten erhaltenen
umfangreichen Geschichtsepos der römischen Antike, setzte erst in jünge-
rer Zeit mit der Monographie v. Albrechts ein1. Das Ziel dieses Buches
ist es, die spezifische gestalterische Leistung des Silius näher zu bestimmen,
die nach Meinung des Verfassers nicht so sehr in einer Poetisierung des
Livius besteht, als vielmehr „gedanklich-konstruktiver" Art ist: „Umorien-
tierung des Hannibalischen Krieges auf die Aeneis hin, Deutung des
historischen Geschehens aus der Sicht der größten Dichtung der Römer."2
In diesem Zusammenhang spielt für v. Albrecht eine wichtige Rolle der
Nachweis ganz bestimmter inhaltlicher „Grundlinien und Grundtenden-
zen", die dem silianischen Epos Einheit und Gehalt verleihen3.
Die sich hier andeutende Tendenz, das spezifisch Silianische bei der
Gestaltung der Punica näher zu bestimmen, kennzeichnet seitdem die
Forschungslage. Allerdings werden dabei zusehends die inhaltlichen Ge-
sichtspunkte, oder — um es mit den Worten Juhnkes zu formulieren —
„die ideologischen Grundzüge des silianischen Epos"4 überbetont. Dies
ist insbesondere bei der durch v. Albrecht angeregten Dissertation Kissels
der Fall, der die „Konstante silianischen Denkens"5 in den geschichtsphilo-
sophischen Grundanschauungen des Dichters sieht und diese durch seine
Interpretationen näher zu bestimmen sucht. In eine ähnliche Richtung
weisen auch zwei Aufsätze Vesseys zu den beiden einleitenden Büchern6,
welche die durch v. Albrecht herausgestellten gedanklichen Grundlinien
in gewissem Umfange zum einzigen Instrument der Interpretation machen.
Nur am Rande sei auf zwei Dissertationen aus jüngster Zeit hingewiesen,
nämlich die von Fincher und Thuile, die sich mehr oder weniger darauf
beschränken, ausgehend von den Untersuchungen v. Albrechts den gesam-
ten Inhalt bzw. einen Teilabschnitt der Punica zu paraphrasieren.
1 Zu der durchweg negativen Beurteilung des Silius in der älteren Forschung, die sich
gerne auf das bekannte Plinius-Diktum (ep. 3,7,5): Scribebat carmina maiore cura quam
ingenio beruft, v. Albrecht 9 — 12 und hier unten 11 mit Anm. 40.
2 V. Albrecht 184.
3 Vgl. besonders v. Albrecht 15 — 89.
4 Juhnke 225 Anm. 165 (vgl. auch 50) sowie unten 13 Anm. 46.
5 Kissel 10.
6 Vessey, Saguntum und ders., Shield.
2 Einleitung
Demgegenüber hat Juhnke stärker den Kunstwillen und die poetische
Gestaltung des Silius hervorgehoben, indem ihm — entsprechend der
Themenstellung seiner Arbeit — an dem Nachweis der silianischen Rezep-
tion und Adaptation von Homerischem gelegen ist7. Freilich wäre ein
intensiver Vergleich zwischen Silius und Vergil wichtiger und aufschlußrei-
cher gewesen. Niemann wendet sich in seiner Dissertation der „Darstellung
der römischen Niederlagen" zu, die einen breiten Umfang im Gesamtwerk
einnimmt und die bei v. Albrecht so gut wie gar keine Berücksichtigung
findet, und zwar vor allem mit dem Ziel, „die Spannung zwischen histori-
scher Überlieferung und epischer Tradition"8 sichtbar zu machen. Einer
Einzelepisode, nämlich der Nekyia im 13. Buch der Punica, gilt die
Dissertation von Reitz, die aber nur wenig dazu beiträgt, das Span-
nungsfeld zwischen epischem Traditionsgut und der silianischen Gestal-
tung innerhalb seines Geschichtsepos auszuloten. Das Thema der stoff-
lichen und künstlerischen Gestaltung im Vergleich mit der historischen
Überlieferung steht auch im Mittelpunkt der zuletzt erschienenen Mono-
graphie von Burck, wobei drei Themenkreise aus dem bisher kaum unter-
suchten letzten Werkdrittel einer ausführlichen Analyse unterzogen wer-
den, nämlich „Die Taten des Marcellus", „Hasdrubals Invasion in Italien;
die Schlacht am Metaurus" und „Die Schlußkämpfe in Nordafrika".
Diese knappen Bemerkungen zur Forschungssituation verdeutlichen,
daß man sich erst in jüngster Zeit um Einzeluntersuchungen zu wichtigen
Passagen dieses umfangreichen Epos bemüht. Solche Untersuchungen sind
aus zwei Gründen begrüßenswert: zum einen, weil auch Kommentare
neueren Datums fehlen, und zum anderen, weil in einem Teil der zuerst
genannten Arbeiten das Interesse an den übergeordneten Gesichtspunkten
einer Erfassung von Sinn und Absicht des Gesamtwerkes überwiegt, was
dann leider bisweilen zu einem geradezu unverbindlichen Interpretieren
einzelner Textpassagen führt9.
Bei allen bisher genannten Arbeiten fällt jedoch auf, daß ein wichtiges
Problemfeld, nämlich die silianische Erzähl- und Darstellungsweise, weitge-
hend unberücksichtigt bleibt. Erste Ansätze zu einer intensiveren Auseinan-
dersetzung mit diesen Fragen begegnen allein bei Herzog, der sich im Rah-
men seiner Untersuchungen zur Bibelepik darum bemüht, die erzähltechni-
schen Voraussetzungen für diese christliche Ausformung epischen Erzählens
innerhalb des antiken römischen Epos und dort vor allem auch bei Silius
näher zu bestimmen10. In den Siliuskapiteln der umfangreichen Abhandlung
Häusslers über das „Historische Epos" sucht man vergeblich nach erzähl-
7 Vgl. besonders Juhnke 185-220, aber auch 11-22. 280-297.
8 Niemann 2.
9 Vgl. z.B. hier unten 154-164.
10 Herzog 60-97 und bes. 76-86.