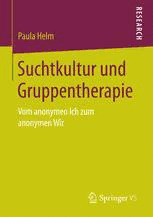Table Of ContentPaula Helm
Suchtkultur und
Gruppentherapie
Vom anonymen Ich zum
anonymen Wir
Suchtkultur und Gruppentherapie
Paula Helm
Suchtkultur und
Gruppentherapie
Vom anonymen Ich zum
anonymen Wir
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Karsten Fitz
PaulaHelm
Frankfurtam Main,Deutschland
Dissertation UniversitätPassau, 2015
ISBN978-3-658-14948-2 ISBN978-3-658-14949-9 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-14949-9
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie;detailliertebibliografischeDatensindimInternetüberhttp://dnb.d-nb.deabrufbar.
SpringerVS
©SpringerFachmedienWiesbaden2017
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
MikroverfilmungenunddieEinspeicherungundVerarbeitunginelektronischenSystemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wärenunddahervonjedermannbenutztwerdendürften.
DerVerlag,dieAutorenunddieHerausgebergehendavonaus,dassdieAngabenundInforma-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit,GewährfürdenInhaltdesWerkes,etwaigeFehleroderÄußerungen.
GedrucktaufsäurefreiemundchlorfreigebleichtemPapier
SpringerVSistTeilvonSpringerNature
DieeingetrageneGesellschaftistSpringerFachmedienWiesbadenGmbH
Geleitwort
Frau Dr. Paula Helm gehört zur ersten Kohorte von Promovierenden im DFG-
Graduiertenkolleg 1681 „Privatheit: Formen, Funktionen, Transformationen“ an
der Universität Passau. Ihre vorgelegte Dissertation mit dem Titel Anonymität
und Autonomie – Eine Ethnographie der Suchttherapie ist, ganz der Denkweise
und Vorbildung ihrer Verfasserin verpflichtet, eine konsequent interdisziplinär
ausgerichtete Studie. Dass das Ausbalancieren der verschiedenen sich gegensei-
tig beeinflussenden, interdiziplinären Ansätze aus der Ethnologie, der Literatur-
und Kultursemiotik, der Psychoanalyse und der Empirischen Sozialforschung am
Ende so überzeugend gelingen würde, war nie eine Selbstverständlichkeit. Diese
konsequent interdisziplinäre Ausrichtung hat auch mich als Betreuer immer
wieder sehr Gewinn bringend ‚gezwungen‘, weit über den fachlichen Tellerrand
zu blicken. Dies war stets eine bereichernde Erfahrung!
Das Projekt befasst sich mit den kulturellen Wurzeln von Suchtkrankheiten
und den sozialen Bedingungen, die notwendig sind, damit sich Suchtkranke
selbstständig von ihrem Leiden emanzipieren und sich als Souveräne ihres eige-
nen Handelns neu konstituieren können. Zu diesem Zweck haben Gruppierun-
gen, die auf der Grundlage von sogenannten 12-Step Netzwerken operieren, wie
eben die Anonymen Alkoholiker, ein höchst komplexes Anonymitätskonzept
entwickelt, welches es möglich macht, die Widersprüche und Gegensätze zwi-
schen den sozialen Anforderungen des Alltags und der Notwendigkeit individu-
eller Autonomie in Einklang zu bringen. An dieser diffizilen Schnittstelle setzt
Frau Dr. Helms für die Privatheitsforschung besonders interessanter und höchst
innovativer Beitrag ein, denn Anonymität als Schlüsselkonzept der Privatheits-
forschung hat bis dato als Untersuchungskategorie wenig Aufmerksamkeit erhal-
ten. Zum einen dient das Anonymitätskonzept der Gewährleistung der „informa-
tionellen Privatheit“ des Einzelnen, zum anderen hat es v. a. einen erzieherischen
Effekt auf das jeweilige Verhältnis des Individuums zu Fragen der „dezisionalen
Privatheit“. So erarbeitet die Dissertation ein genuin interdisziplinär ausgerichte-
tes, theoretisches Modell zur Erfassung und Rationalisierung der Interdependenz
von Sucht, Anonymität und, über die Erlangung dezisionaler Privatheit, Auto-
nomie. Sie kommt dabei zu der Erkenntnis, dass der Schlüssel der Anonymous-
Gruppierungen zum „Leben in Genesung“ darin besteht, den klassischen, aber
6 Geleitwort
sehr engen und einseitigen Autonomiebegriff durch einen relationalen Autono-
miebegriff ersetzt zu haben.
Aber Selbstverständlich hält die Arbeit auch für den eher klassischen Ame-
rikanisten einige erhellende Erkenntnisse parat. Dass z.B. das amerikanische
Streben nach Unabhängigkeit, Freiheit und Glückseligkeit – Life, Liberty, and
the pursuit of Happiness –, welches im kulturellen Selbstbild des self-made man
so tief verwurzelt ist, in besonderem Maße kein Eingeständnis von „Schwäche“
erlaubt, so dass es dazu kommt, sich selbst und Andere (also das Umfeld) zu
täuschen, ist eine ebenso wichtige wie einleuchtende Erkenntnis.
Bereits das erste große Hauptkapitel der vorgelegten Dissertation füllt schon
eine Forschungslücke, indem es eine moderne Kulturgeschichte der Suchtgenese
seit den 1930er Jahren, also seitdem „Sucht“ als Krankheitsbild verstanden wird,
nachvollzieht. Somit hat Frau Dr. Helm auch eine kompakte und detaillierte
Kulturgeschichte vorgelegt, die mit großem Sach- und Fachverstand und mit
einem hohen Maß an Einfühlungsvermögen die schrittweise und mühselige Ent-
wicklung des ‚Zustands‘ Alkoholismus aufarbeitet. Als solches versteht die Ver-
fasserin ihre Studie dann auch völlig zu Recht als eine „emotionshistorische
Untersuchung“. Die vorliegende Arbeit ist damit einhergehend zusätzlich als
Geschichte der Institutionalisierung von dezentralen Netzwerken mit Mutual
Support Group-Strukturen von Bedeutung, wobei die Verfasserin das Outen als
Alkoholiker/in als Auf- bzw. Preisgabe der informationellen Privatheit und
Schritt hin zu mehr dezisionaler Privatheit betrachtet – und somit zentrale Kon-
zepte des Privatheitsdiskurses zur Anwendung kommen.
Frau Dr. Paula Helm plädiert aus den oben genannten Gründen mit Nach-
druck dafür, dass der Anonymität eine viel größere Bedeutung zugeschrieben
werden sollte, als dies in der Forschung und im öffentlichen Diskurs bisher der
Fall ist. Die vorliegende Dissertation ist ein wegweisender Beitrag dazu.
Passau, im Mai 2016 Prof. Dr. Karsten Fitz
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ................................................................................................... 11
2 Begriffe und Konzepte von Sucht bis Autonomie .................................. 17
2.1 Mutual Support statt Self-Help ............................................................... 17
2.2 Geistes- und sozialgeschichtliche Einordnung der Suchtproblematik .... 20
2.3 12-Stepper – Betroffene und kulturelle Akteure zugleich ...................... 28
2.4 Anonymität früher und heute .................................................................. 31
2.5 Ein praxeologischer Blick auf Sucht und Genesung .............................. 35
2.6 Gesundheit, Krankheit und Autonomie .................................................. 38
2.7 Bedingungen personaler Autonomie – Probleme und Ambivalenzen .... 42
2.8 Aufbau und Struktur der Analyse ........................................................... 50
3 Zur Kulturgeschichte der Suchtgenesung ............................................... 55
3.1 Methodische Vorbemerkung I ................................................................ 55
3.1.1 Zur Analyse diskursiver Praktiken ................................................ 57
3.1.2 Grenzen und Konturen des Diskursstranges zur Suchtgenesung .. 59
3.1.3 Quellenlage, Erhebungsmethoden und Quellenkritik ................... 61
3.1.4 Ein sozialer Schwarm im Netz von Sucht und Genesung ............. 65
3.2 Zu den Entstehungsbedingungen eines neuen
Krankheitsverständnisses ........................................................................ 68
3.2.1 Als es Alkoholismus, aber noch keine Alkoholiker gab – The
Golden Twenties ........................................................................... 68
3.2.2 Ideologisierung und Desillusionierung – The Great Depression .. 72
3.2.3 Suche nach Alternativen – Einflüsse der europäischen
Psychoanalyse ............................................................................... 79
3.2.4 Krankheit und Moral – Einflüsse der christlichen Kirche ............ 82
8 Inhaltsverzeichnis
3.2.5 Identifizieren statt Missionieren – Geburt des Mutual Support .... 88
3.2.6 Zwischenfazit: Anonymität als Medizin gegen eine
Beziehungskrankheit ..................................................................... 93
3.3 Zur Entstehung einer kollektiven Identität durch Anonymität ............... 95
3.3.1 Eine Geschichte des Trial-and-Errors – Zur Quellenlage ............. 95
3.3.2 Erste Keime einer Graswurzelbewegung – Die Twelve Steps
entstehen ........................................................................................ 97
3.3.3 Ein Buch, viele Autoren, eine Identität – Alcoholics
Anonymous ................................................................................. 103
3.4 Etablierung von Mutual Support über das Prinzip der Anonymität ..... 114
3.4.1 Prelude: Ambivalenzen der Anonymität ..................................... 114
3.4.2 Zur Quellenlage im Zeitraum 1940-1960 ................................... 116
3.4.3 Ein privates und ein öffentliches Selbst ...................................... 119
3.4.4 Zwischenfazit: Anonymitätsschutz in drei Stufen ...................... 128
3.5 Wege in die kollektive Autonomie durch Anonymität ......................... 130
3.5.1 Ende einer Anarchie .................................................................... 130
3.5.2 Copyleft – Mechanismus dezentraler Steuerung ......................... 135
3.5.3 Special oder Primary Purpose? ................................................... 137
3.6 Mutual Support als symptomübergreifende Medizin gegen Sucht ....... 138
3.6.1 Eine Familienkrankheit ............................................................... 138
3.6.2 Addicts Anonymous? .................................................................. 142
3.6.3 Von Abstinenz zu Nüchternheit .................................................. 149
3.7 Fazit I: Anonymität als Faktor kollektiver Autonomie ......................... 152
4 Transformationen des Selbst im Kontext von Sucht und Genesung .. 161
4.1 Methodische Vorbemerkung II ............................................................. 161
4.1.1 Teilnehmende Beobachtung ........................................................ 164
4.1.2 Sampling ..................................................................................... 167
4.1.3 Bildung von Codes ...................................................................... 170
4.1.4 Praxeologische Perspektive ......................................................... 173
4.1.5 Mutual Support als Rite de Passage ............................................ 175
4.2 Zum Verfall personaler Autonomie – Stadien der Sucht ...................... 179
4.2.1 Automanipulation als soziale Strategie ....................................... 180
4.2.2 Autonomie- und Selbstverlust ..................................................... 183
4.2.3 Sinn-und Machtlosigkeit ............................................................. 185
4.3 Ernüchterungserfahrungen – Ent-Täuschungen .................................... 188
Inhaltsverzeichnis 9
4.3.1 Sozialer Tiefpunkt ....................................................................... 189
4.3.2 Emotionaler Tiefpunkt ................................................................ 196
4.3.3 Kapitulation ................................................................................. 200
4.4 Einstieg in den Liminal Space – Rituale der Genesung ........................ 205
4.4.1 Trennung von der Alltagsstruktur ............................................... 205
4.4.2 Tod und Wiedergeburt ................................................................ 208
4.4.3 Ein Kreis als Anfang und als Ende ............................................. 211
4.5 Im Liminal Space – Werkzeuge der Genesung .................................... 214
4.5.1 Identifikation, Vertrauensbildung und das ethische Moment
der Anonymität ............................................................................ 214
4.5.2 Mimetische Bezugs- und Abgrenzungsprozesse in der
Sponsorschaft .............................................................................. 219
4.5.3 Katharsis und Autonom-Werdung .............................................. 224
4.6 Wiedereinstieg in die Alltagsstruktur – Leben in Genesung ................ 231
4.6.1 Die Haltung der Anonymität als Bündel sozialer Fähigkeiten .... 231
4.6.2 Genesungspraxis und Alltagsleben ............................................. 232
4.7 Fazit II: Zur performativen Macht der Anonymität .............................. 240
4.7.1 Zusammenfassung zum Transformationsprozess von Sucht zu
Genesung ..................................................................................... 240
4.7.2 Wie aus der praktizierten Anonymität eine Haltung werden
kann ............................................................................................. 244
5 Anonymität, Autonomie und die Mythen der Genesung ..................... 249
5.1 Genesung .............................................................................................. 251
5.1.1 Was es bedeutet, zu genesen ....................................................... 251
5.1.2 Das Konzept lebenslanger Genesung .......................................... 254
5.1.3 Genesung gleich Autonomie durch Nüchternheit ....................... 260
5.2 Ego ........................................................................................................ 262
5.2.1 Historische Hintergründe zum Begriff des Ego .......................... 262
5.2.2 Ego der Psychoanalyse ................................................................ 263
5.2.3 Buddhistische Einflüsse .............................................................. 269
5.2.4 Das Ego als Träger von Ideologie und Kulturkritik .................... 276
5.2.5 Bewertung des Ego-Begriffs im Kontext von Sucht und
Genesung ..................................................................................... 282
5.3 Mythos .................................................................................................. 283
5.3.1 Die Rolle des Mythos im Mutual Support .................................. 283
10 Inhaltsverzeichnis
5.3.2 Der Genesungsmythos ................................................................ 285
5.3.3 Aneignung und Pluralisierung des Genesungsmythos ................ 289
5.3.4 Mythos und Autonomie ............................................................... 293
5.3.5 Bewertung des Mythos im Kontext von Sucht und Genesung ... 296
5.4 Fazit III: Die beiden großen A’s ........................................................... 297
5.4.1 Differenzen: Anonymität als säkulares Konzept praktizierter
Spiritualität .................................................................................. 297
5.4.2 Best Practice: Autonomie und Anonymität auf einem
Kontinuum von Sucht und Genesung ......................................... 303
6 Abschlussreflexion: Zur Interdependenz von Sucht, Genesung,
Anonymität und Autonomie ................................................................... 313
7 Bibliografie ............................................................................................... 321
7.1 Primärliteratur ....................................................................................... 321
7.2 Sekundärliteratur ................................................................................... 323
8 Anhang ..................................................................................................... 331
8.1 Twelve Steps, Twelve Traditions and Twelve Concept of Alcoholics
Anonymous ........................................................................................... 331
8.2 Besuchte Meetings im Zusammenhang mit der Teilnehmenden
Beobachtung ......................................................................................... 335
8.3 Transkriptionen der Experteninterviews ............................................... 337
8.3.1 Steven S. ...................................................................................... 337
8.3.2 Mary C. ....................................................................................... 339
8.4 Inventuren von 12-StepperInnen .......................................................... 341
8.4.1 Mel T., Underearners Anonymous .............................................. 341
8.4.2 Helen S., Al-Anon ....................................................................... 369
8.4.3 Grace M., Overeaters Anonymous .............................................. 380
8.5 Tabellen zur Verbreitung von Mutual Support-Gruppen weltweit ....... 383
8.6 Graphik zur Genealogie der Mutual Support-Gruppen ........................ 388
8.7 Graphik zum Verlauf von Sucht und Genesung ................................... 389
8.8 Round Table-Protokoll „Scientists and Narcotics Anonymous“ .......... 389