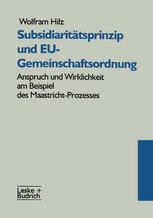Table Of ContentWolfram Hilz
SubsidiariUitsprinzip und
ED- Gemeinschaftsordnung
Wolfram Hilz
Subsidiaritatsprinzip
und EU
Gemeinschaftsordnung
Anspruch und Wirklichkeit
am Beispiel
des Maastricht- Prozesses
Leske + Budrich, Opladen 1998
Gedruckt auf siiurefreiem und altersbestiindigem Papier.
ISBN 978-3-322-97428-0 ISBN 978-3-322-97427-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-97427-3
© 1998 Leske + Budrich, Opladen
Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschiitzt. Jede Verwertung
au8erhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzuliissig und strafbar. Das gilt insbesondere fiir VervielfaItigungen, Ubersetzungen, Mi
kroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
INHALT
VOl"W'ort............................................................................................. 9
Einleitung.......................................................................................... 11
l. Themenrelevanz und -kontext ............................................... . 11
2. Integrationstheoretische Verortung der Thematik .................. . 15
3. Quellen-und Literaturlage ..................................................... . 20
4. Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise ................................. . 23
Kapitel I:
Facetten des Subsidiaritatsprinzips in der EG........ ....... ................. 27
l. Ursprung und Bedeutung des Subsidiaritatsprinzips .............. . 27
l.l. AnknOpfungspunkte in der politischen Ideengeschichte und
Staatstheorie .......................................................................... . 28
l.2. Das Subsidiaritatsverstandnis in der katholischen Soziallehre. 31
1.3. Verallgemeinerbarer Kerngehalt des Prinzips ........................ . 36
1.4. Divergierende Interpretationsmoglichkeiten .......................... . 37
l.5. Funktionen des Subsidiaritatsprinzips .................................... . 39
2. Das VerhiUtnis der Subsidiaritat zu FOderalismus,
Regionalismus und Supranationalitat. .................................... . 41
2.l. Subsidiaritat und FOderalismus .............................................. . 41
2.2. Subsidiaritat und Regionalismus ............................................ . 44
2.3. Subsidiaritat und Supranationalitat ........................................ . 46
3. Das Subsidiaritatsprinzips in Rechtsordnung und
Staatsstruktur der EG-Mitgliedstaaten ................................... . 49
3.l. Die Verwirklichung des Grundsatzes in Deutschland. ............ . 50
3.2. Erfahrungen der EG-Partner mit dem Subsidiaritatsprinzip ... . 54
3.2.l. FOderalisierte und regionalisierte EG-Staaten ........................ . 55
3.2.2. Dezentralisierte EG-Staaten ................................................... . 58
3.2.3. Unitarische EG-Staaten ......................................................... . 62
4. Das Subsidiaritatsprinzip im EG-Gefiige ............................... . 66
5
4.1. Subsidiaritiit im primaren Gemeinschaftsrecht ....................... . 66
4.2. Initiativen zur Aufnahme des Subsidiaritiitsprinzips in die
EG-Vertrage .......................................................................... . 68
5. Zusammenfassung: Die Bedeutung des Subsidiaritiitsprinzips
fur die EG-Mitglieder und fur die Gemeinschaft .................... . 72
Kapitel ll:
Vorschlage zur Verankerung des Subsidiaritatsprinzips auf
europiischer Ebene im Vorfeld der Regierungskonferenzen ......... 75
1. Deutsche Aktivitiiten zur Verankerung des
Subsidiaritatsprinzips ............................................................ . 76
1.1. Krise des FOderaiismus und Subsidiaritatsplane der Lander ... . 76
1.2. Die detaillierten Subsidiaritatsforderungen der Lander .......... . 78
1.3. Rezeption der Landervorschlage durch die Bundesregierung .. 82
2. Gemeinsame Subsidiaritiitsinitiativen der deutschen Lander
mit anderen Regionen ............................................................ . 83
3. Subsidiaritatsvorschlage der anderen EG-Mitglieder.. ............ . 86
3.1. Die belgische Position zur Subsidiaritiit ................................. . 87
3.2. Die griechische Position zur Subsidiaritat .............................. . 87
3.3. Die danische Position zur Subsidiaritat .................................. . 88
3.4. Die britische Position zur Subsidiaritat .................................. . 89
4. Subsidiaritatsvorstellungen und -initiativen der EG-Akteure .. . 89
4.1. Subsidiaritiitsinitiativen im Europaischen Parlament ............. . 89
4.2. Subsidiaritatsvorstellungen der Kommission .......................... . 93
4.3. Stellungnahmen des Europaischen Rates zum
Subsidiaritatsgrundsatz .......................................................... . 98
5. Zusammenfassende Kategorisierung der
Subsidiaritatsvorschlage ........................................................ . 100
Kapitel ill:
Die gemeinschaftliche Subsidiaritatsdiskussion wihrend der
Regierungskonferenz und ihr Ergebnis........................................... 103
1. Die Subsidiaritiitsdiskussion wahrend der
Regierungskonferenz zur Politischen Union .......................... . 103
1.1. Die divergierenden Perzeptionen der existierenden
Subsidiaritiitsvorschlage ........................................................ . 103
1.2. Die Entstehung der "deutsch-britischen
Subsidiaritiitskoalition ........................................................... . 106
1.3. Die Flankierung der Subsidiaritiits-durch die "F-word"-
Diskussion ............................................................................. . 108
6
1.4. Die anhaltende Subsidiaritatsdebatte bis zum
Vertragsabschlu6 ................................................................... . III
1.5. Die Aussagekraft der Subsidiaritats-und
F Oderalismusdiskussion ......................................................... . 115
2. Das Subsidiaritatsprinzip im Maastrichter Vertrag: ............... .
Interpretationsoffenheit statt Klarheit .................................... . 118
2.1. Kurzbewertung des EU-Vertrages .......................................... . 118
2.2. Der Art. 3b EG-Vertrag: Mehr offene Fragen als Hilfe zur
Kompetenzordnung ............................................................... . 121
2.2.1. Absatz 1: Altbekanntes in neuer Form ................................... . 121
2.2.2. Absatz 2: Kulminationspunkt der Unklarheiten ..................... . l23
2.2.3. Absatz 3: Verhaltnismiilligkeit wie bisher.. ............................ . l27
2.2.4. Das Problem der lustitiabilitat ............................................... . 128
2.3. Weitere subsidiaritatsrelevante Elemente des Vertrags ........... . 131
3. Zusammenfassende Bewertung .............................................. . 135
Kapitel IV:
Die Interpretationsdiskussion der Maastrichter
Subsidiaritatsklausel wahrend des RatiilZierungsverfahrens ......... 139
1. Der Ratsgipfel von Lissabon: Erstes Herantasten an eine
Konkretisierung der Subsidiaritatsklausel............................... 140
2. "Kampf' mit Memoranden und Dossiers: Aufgalopp zum
Sondergipfel von Birmingham................................................ 144
3. Der Sondergipfel von Birmingham als Perfektionierung der
"Marketingstrategie" 'Bftrgemahe Union durch Subsidiaritat' 148
4. Fortsetzung des "Papierkrieges" bis zum Gipfel von
Edinburgh.............................................................................. 152
5. Die Friichte der Arbeit: Das Subsidiaritatskonzept von
Edinburgh ..... ......... ..... ...... ...... ...... ............. .... ....... ................. 159
6. Die Konkretisierung der Subsidiaritatsklausel durch
Priifraster, Streichlisten und interinstitutionelle Abkommen ... 165
7. Zusammenfassende Kategorisierung der Akteure
hinsichtlich ihrer Subsdiaritatsinterpretationen....................... 169
Kapitel V:
Die Relevanz der Subsidiaritatsdiskussion fUr die nationalen
RatiilZierungsverfahren ................................................................... 175
1. Luxemburg............................................................................. 176
2. Belgien................................................................................... 177
3. Griechenland.......................................................................... 178
7
4. Frankreich.............................................................................. 179
5. Irland ..................................................................................... 180
6. Italien. ............. ........ ................ ......... .... ....... ............ ....... .... .... 182
7. Niederlande............................................................................ 183
8. Portugal.................................................................................. 185
9. Spanien .................................................................................. 186
10. Danemark.......... ... ....... ........ ............ ... ..... ...... ................ .... ..... 187
11. Gro6britannien ....................................................................... 189
12. Deutschland ........................................................................... 195
13. Zusammenfassende Bewertung der Ratiflkationsverfahren
unter Subsidiaritatsgesichtspunkten........................................ 199
Kapitel VI:
Die Subsidiaritatsdiskussion als Spiegel fUr die "Verfassung"
der EU nach Maastricht: Eine Bewertung in 6 Schritten............... 203
1. Bewertung der Subsidiaritiitsregelung durch die Akteure
nach Inkrafitreten des EU-Vertrags ........................................ 203
2. Veranderungen in der gemeinschaftlichen
Kompetenzordnung durch die Subsidiaritatsregelung ............. 208
3. Auswirkungen der Subsidiaritatsklausel auf Demokratie-
und Legitirnitiitsdefizit der EU................................................ 214
4. ROckwirkungen der Subsidiaritatsdiskussion auf die
Integrationsbereitschaft der Burger......................................... 219
5. Das Subsidiaritiitsprinzip als Prototyp fur
interpretationsoffene, "europiiische" Begriffe.......................... 223
6. Alternativen zum Subsidiaritiitsprinzip als
Kompetenzausscheidungsnorm............................................... 226
SchluDbetrachtung und Ausblick..................................................... 231
Anhang ............................................................................................. 241
1. Abkiirzungsverzeichnis ......................................................... . 241
2. Verzeichnis der Reden und Dokumente ................................. . 243
2.1. Reden .................................................................................... . 243
2.2. Dokumente ............................................................................ . 245
2.2.1. Europiiische Gemeinschaft. .................................................... . 245
2.2.2. EG-Mitglieder ....................................................................... . 250
2.2.3. Sonstige ................................................................................. . 254
3. Literaturverzeichnis ............................................................... . 256
8
Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist die aktualisierte Fassung meiner Dissertation, die
im Sommersemester 1997 von der Sozialwissenschaftlichen Fakultat der
Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen angenommen wurde.
Besonderer Dank gilt meinen "Doktoreltem", Prof. Dr. Beate Neuss und
Prof. Dr. Dieter Grosser, die mir mit konstruktiver Kritik geholfen haben,
meine Vorstellungen in ein realisierbares Konzept zu fassen. Dieser
"Zwang" zur Prazisierung war besonders wichtig, da der DiskussionsprozeB,
der im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, zurn Zeitpunkt meiner ersten thema
tischen Voruberlegungen im Herbst 1992 gerade erst begonnen hatte. Mei
ner "Doktormutter", Beate Neuss, danke ich nicht nur flir die Fachgespra
che, die meine Sichtweise flir europapolitische Zusammenhange geschiirft:
haben, sondem auch flir die Gewahrung von Freiraurnen bei meiner Tatig
keit als ihr Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Chemnitz, durch die
sie mich zu einem zugigen AbschluB der Studie motivierte.
Ich danke all jenen Mitarbeitem aus Ministerien und Parlamenten der
EU-Mitgliedstaaten, die mir durch ihre Auskunftsfreudigkeit wertvolle Ein
sichten in die nationalen Diskussionen vermittelt haben. Daneben bin ich
allen Kolleginnen und Kollegen zu Dank verpflichtet, die mir durch ihre
Kommentare und Stellungnahmen in den verschiedenen Arbeitsphasen eine
wichtige Hilfe waren; allen voran meinen Mtinchener Doktorandenkollegen
Dr. Thomas Paulsen und Dr. Benno Siebs. FUr die groBe MUhe des Korrek
turlesens danke ich meinem Vater.
Den grofiten Dank schulde ich meinen Eltem, Edith und Robert Hilz,
flir ihre unermudliche Forderung sowie meiner lieben Frau Susanne mit un
seren Tochtem Elisabeth und Theresa. Sie waren mir stets Ruckhalt, Ruhe
punkt und unentbehrliches Korrektiv, wenn ich den Blick fUr die wirklich
wichtigen Dinge des Lebens zu verlieren drohte.
Eching, im April 1998 Wolfram Hilz
9
Einleitung
1. Themenrelevanz und -kontext
"Die Hundehiitte ist fur den Hund und das Subsidiaritatsprinzip ist fur die Katz,!"j
Dieser Satz bringt stark pointiert zum Ausdruck, was viele von der An
wendung des Subsidiaritatsprinzips im Rahmen der europaischen Integra
tion halten, namlich nichts. Trotzdem hat der fur die katholische Soziallehre
zentrale Grundsatz nach Unterzeichnung des Maastrichter Vertrages euro
paweite Bekanntheit erlangt. In der durch das negative danische Referen
dum vom Juni 1992 ausgelOsten schwersten Integrationskrise seit dem
Scheitem der EVG 1954 ruckte der Begriff Subsidiaritat in den Mittelpunkt
der hektischen Gemeinschaftsaktivitaten zur Rettung des Maastrichter Ver
trages. Es gibt sogar Stimmen, die das Jahr 1992, das europapolitisch mit
der Vollendung des Binnenmarktes verkniipft war, aufgrund dieser Entwick
lung zum "Jahr der Subsidiaritat" umwidmeten.2 Dabei wurde das Subsidi
aritatsprinzip, das in den meisten EG-Staaten weitgehend unbekannt war,
mit so kontraren Schlagwortem wie "Zauberformel", "Schliisselbegriff',
"Rettungsanker", "Magna Charta fur Europa" oder "Leerformel", "Mode
wort" und "Mythos" charakterisiert. Diese kleine Auswahl verdeutlicht,
welche widerspruchlichen Einschatzungen dieses "ominosen Prinzips" es
gegeben hat und noch gibt. Gleichzeitig belegen diese Bezeichnungen das
3
plOtzlich erwachte Interesse von Politikem und Journalisten und darnit der
Offentlichkeit an diesem Grundsatz, der offensichtlich mehr ist als "nur ein
Wort".4
Es stellt sich die Frage, warum und zu welchem Zweck das umstrittene
Prinzip in die Gemeinschaftsvertrage aufgenommen wurde und wieso die
einen in diesem urspriinglich gesellschaftspolitischen Grundsatz die Rettung
fur die Gemeinschaft nach dem miihsamen Kompromill von Maastricht er
blickten, wahrend die anderen ihn als proklamatorische Worthiilse ohne eu-
Dieser Ausspruch -halb im Scherz, halb im Ernst -stammt von Wernhard Moschel, geliuBert
wahrend einer Diskussion auf der interdisziplinaren Fachtagung des Arbeitskreises Europai
sche Integration zum Thema SUbsidiaritatsprinzip in der EU im Oktober 1994 in Tiibingen.
Zu den Tagungsbeitrligen siehe Hrbek 1995.
2 Perissich (1992, S. 5) behauptet dies: "L'annee 1992, toujours annoncee comme I'annee butoir
du Marche unique, est devenue I' annee de la subsidiarite."
3 Zu den Quellen und Schopfe rn der Schiagworte siehe auch Kahl1993, S. 415, Fn. 2.
4 Dieter Grimm: Subsidiaritat ist nUT ein Wort, FAZ vom 17.9.92, S. 38.
11
ropapolitisch anwendbaren Inhalt achteten. Es ging bei der Auseinanderset
zung urn die Subsidiaritat offensichtlich urn mehr als urn die Interpretation
einer europaischen Vertragsnorm. Deshalb ist zu fragen, welche Bedeutung
der EG-weite Streit urn das Subsidiaritatsprinzip wahrend des Maastricht
Prozesses5 batte, welche Ziele die europapolitischen Akteure darnit verfolg
ten und was dieser Detailkonflikt tiber den Zustand der Gemeinschaft aus
sagt.
Ein Blick auf die "Verfassung", in der sich die Europaische Gemein
schaft zu Beginn der neunziger Jahre befand, kann Hinweise liefe m, wieso
es zur gemeinschaftlichen Subsidiaritatsdiskussion kam. Es gab viellaitige
Unsicherheiten und neue Herausforderungen, die auf einen Proze6 der Neu
orientierungen hinwirkten. Von au6en wurde an die EG, die im wesentli
chen eine westeuropaische Wirtschafts- und keine politische Gemeinschaft
war, nach dem Zusarnmenbruch der europaischen Nacbkriegsordnung 1989/
90 beispielsweise die Forderung nach einer schnellen Offnung nach Osten
und die Konzentrierung der au6enpolitischen Kapazitaten zur Erlangung
entsprechender Problemlosungskompetenz gestellt. Trotzdem entsprachen
die EG-Mitglieder der Vielzahl an BeitrittswUnschen aus Osteuropa und den
Forderungen nach einer europaischen Au6enpolitik zunachst nicht, sondem
schritten auf dem eingeschlagenen Integrationskurs fort.
Von "innen" heraus wurden nach den erfolgreichen Wiederbelebungs
bemtihungen der Integrationsdynarnik durch das Binnenmarktprogramm
und die Einheitliche Europaische Akte (EEA) neue Forderungen an die Ge
meinschaft gestellt, mit denen sie bisher kaum konfrontiert wurde. Die
"Friedensgemeinschaft" EG war durch ihre Kooperationsmechanismen, die
gewaltsame Konflikte zwischen ehemals verfeindeten Machten undenkbar
werden lie6en, ausreichend legitimiert. Sobald diese EG jedoch daran ging,
ihre seit den ersten Integrationsbemtihungen der fiinfziger Jahre konzipierte
politische Zielsetzung mit Nachdruck zu verfolgen und gro6e Teile des oko
nomischen Lebens zu beeinflussen, wurde sie kritischer betrachtet.
Die seit den sechziger Jahren beklagte mangelnde Integrationsdynarnik
wurde seit Mitte der achtziger Jahre, als die EG-Kommission unter ihrem
neuen Prasidenten Jacques Delors ihre Wiederbelebung mitinitiierte, auch
als Argument gegen weitere Integration verwendet. Angesichts der Auswei
tung der Gemeinschaftstatigkeit stellte sich die Frage der Legitimitat von
Gemeinschaftsma6nahmen und der ausreichenden demokratischen Struktu
rierung der EG neu. Auch bedurfte die vorhandene, unsystematisch fort
entwickelte Kompetenzordnung der Gemeinschaft einer Abstimmung auf
die neuen und auf die bereits existierenden Aufgaben. Die fehlende Akzep
tanz einer gro6eren Eigenstandigkeit der Gemeinschaft ist zu einem erhebli
chen Teil auf diese "Asymmetrie zwischen Kompetenzallokation und Legi-
5 Damit ist der Zeitraum von der Einberufung der Regierungskonferenzen bis zum Inkrafttreten
des Maastrichter Venrages gemeint.
12