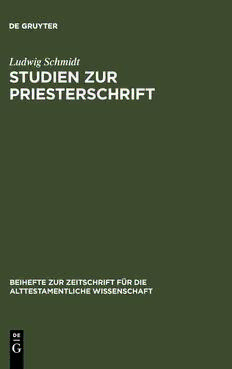Table Of ContentLudwig Schmidt
Studien zur
Priesterschrift
Walter de Gruyter · Berlin · New York
1993
© Gedruckt auf säurefreiem Papier,
das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.
Die Deutsche Bibliothek — CIP-Einheitsaufnahme
Schmidt, Ludwig:
Studien zur Priesterschrift / Ludwig Schmidt. — Berlin ; New
York : de Gruyter, 1993
(Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft;
Bd. 214)
ISBN 3-11-013867-0
NE: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft / Beihefte
ISSN 0934-2575
© Copyright 1993 by Walter de Gruyter & Co., Berlin 30
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro-
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Druck: Arthur Collignon GmbH, Berlin 30
Buchbinderische Verarbeitung: Lüderitz und Bauer, Berlin 61
Vorwort
Die hier vorgelegten Untersuchungen sind ein Beitrag zu der gegenwärtig
umstrittenen Frage nach der Entstehung des Pentateuch. In ihnen soll an
ausgewählten Beispielen gezeigt werden, daß die priesterliche Schicht ursprüng-
lich eine selbständige Quellenschrift war, in der ältere Darstellungen neu gestal-
tet wurden. Die erste Studie "Die Priesterschrift in Exodus 1-14" geht auf ein
Referat zurück, das ich auf einer Tagung der Fachgruppe Altes Testament der
Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie am 10. Mai 1991 in Hofgeismar
vorgetragen habe.
Frau Isolde Wernicke hat das Manuskript sorgfältig geschrieben. Die
Herren stud, theol. Janning Hoenen und Ulrich Nötzel haben mich bei den
Korrekturen unterstützt. Mein Assistent Dr. Friedrich Fechter hat große Mühe
darauf verwandt, den Laserausdruck und das Stellenregister anzufertigen. Ihnen
allen möchte ich an dieser Stelle danken. Außerdem danke ich Herrn Professor
Dr. Otto Kaiser und dem Verlag Walter de Gruyter für die Aufnahme der
Arbeit in die Reihe "Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissen-
schaft".
Erlangen, im Januar 1993 Ludwig Schmidt
Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Α. Die Priesterschrift in Exodus 1-14. Quellenschrift oder Redaktion? 1
I. Die Fragestellung 1
II. Die priesterliche Berufung des Mose (Ex 6,2-12; 7,1.2.4-7) . 2
III. Die priesterlichen Plagen in Ex 7,8-11,10 10
IV. Die priesterliche Darstellung des Meerwunders (Ex 14*) . . 19
V. Ergebnis 34
B. Die priesterlichen Murrerzählungen 35
I. Die Fragestellung 35
II. Die Wachtel-Manna-Erzählung (Ex 16,1-15) 36
III. Die priesterliche Geschichte von dem Wasser
aus dem Felsen (Num 20,1-13) 45
IV. Die Kundschaftergeschichte (Num 13,1-14,38) 73
1. Num 13 74
2. Num 14,1-38 85
3. Die priesterliche Kundschaftergeschichte 106
4. Ergebnis 112
V. Der Aufstand gegen Mose und Aaron (Num 16-17) 113
1. Num 16 116
2. Num 17 146
3. Die Erzählung von den 250 Männern 157
4. Die Korach-Bearbeitung 167
5. Die Endredaktion 173
6. Ergebnis 177
VI. Aufbau und Komposition der priesterlichen
Murrerzählungen 179
VII. Zusammenfassung 203
VIII Inhaltsverzeichnis
C. Das Ende der Priesterschrift. Ρ zwischen Num 20,12 und Dtn 34,9 207
I. Die Fragestellung 207
II. Der Tod Aarons (Num 20,22b-29) 208
III. Die Ankündigung des Todes von Mose
(Num 27,12-14; Dtn 32,48-52) 211
IV. Die Einsetzung Josuas (Num 27,15-23) 221
V. Der Tod des Mose (Dtn 34,la*.7-9) 241
VI. Ergebnisse und Folgerungen 251
Literaturverzeichnis 272
Stellenregister (in Auswahl) 277
Α. Die Priesterschrift in Exodus 14
Quellenschrift oder Redaktion?
I. Die Fragestellung
In der gegenwärtig kontroversen Diskussion über die Entstehung des Penta-
teuch kommt m.E. der priesterlichen Schicht eine besondere Bedeutung zu. Κ
Koch hat 1987 in seinem Aufsatz "P - kein Redaktor!" darauf hingewiesen, "daß
die Aussonderung einer oder mehrerer 'priesterlicher' Schichten in den Büchern
Genesis bis Numeri und die Erkenntnis einer relativen Eigenständigkeit des
nicht-priesterlichen jehovistischen (JE) Textbestandes relativ unbestritten geblie-
ben ist"1. Dadurch ist aber die priesterliche Schicht, wie auch K. Koch betont,
ein guter Ausgangspunkt für die Frage nach der Entstehung des Pentateuch.
Wenn die priesterlichen Texte zu einer eigenen Darstellung gehören, die zu-
nächst nicht mit dem übrigen Stoff verbunden war, ist eine Urkundenhypothese
für das literarische Werden des Pentateuch als Teilaspekt unverzichtbar2. Erst
durch eine spätere Redaktion wären ja die priesterliche und die vorpriesterliche
Fassung miteinander verbunden worden. Allerdings wird gegenwärtig zunehmend
die Auffassung vertreten, daß die priesterlichen Texte als Ergänzung des vor-
priesterlichen Bestandes entstanden sind3. So steht die Forschung gegenwärtig
vor der Alternative, ob die priesterlichen Texte als Quellenschrift oder als
Ergänzungsschicht verstanden werden müssen.
Diese Frage läßt sich nur durch eine erneute Analyse der priesterlichen
Texte entscheiden. Deshalb soll im folgenden die priesterliche Schicht in Ex 1-
14 untersucht werden. Ihre Abgrenzung ist hier zwar in Einzelheiten umstritten.
1 K. Koch, 448.
2 Die literarische Entstehung des Pentateuch läßt sich nicht allein mit einer Urkun-
denhypothese erklären. Auch die Vertreter der neueren Urkundenhypothese, nach
denen die drei Quellenschriften des Jahwisten, des Elohisten und der Priesterschrift
anzunehmen sind, rechnen außerdem mit zum Teil erheblichen Erweiterungen, vgl.
z.B. die Analysen von Ex 3f bei L. Schmidt, Pentateuch, 90-92, und W.H. Schmidt,
Exodus, lOOff.
3 So z.B. E. Blum, Studien, 219ff; vgl. auch die von E. Blum, Vätergeschichte, 425f;
ders., Studien, 229 Anm. 2, und von M. Vervenne, 73 Anm. 18, genannten neueren
Arbeiten.
2 Α. Die Priesterschrift in Exodus 1-14
Im wesentlichen besteht aber Übereinstimmung darüber, welche Stücke minde-
stens zur priesterlichen Schicht zu rechnen sind4. Da sie sich deutlich von der
vorpriesterlichen Darstellung abheben, wurde lange Zeit kaum bestritten, daß
sie zu einem priesterlichen Werk gehören, das erst redaktionell mit dem übri-
gen Stoff zusammengearbeitet wurde. Dieses Bild hat sich geändert. Es war
zunächst eine prinzipielle Erwägung, die für diesen Bereich gegen eine selb-
ständige Priesterschrift angeführt wurde. In der priesterlichen Schicht wird Mose
erstmals in Ex 6,2 erwähnt: "Da redete Gott zu Mose". Hier wird jedoch Mose
nicht eingeführt. Mit Recht stellt R. Rendtorff fest: "Er ist ganz plötzlich da und
empfängt die Zusage der Herausführung der Israeliten aus Ägypten (Ex 6,2-
8)"5. Obwohl Mose in der priesterlichen Schicht eine zentrale Rolle zukommt,
wird er also in ihr nicht eingeführt. Daraus geht für R. Rendtorff, wie schon
zuvor für F.M. Cross6, eindeutig hervor, daß in Ex 6,2ff die vorpriesterliche
Darstellung in Ex 2ff vorausgesetzt ist, in der von der Geburt und Rettung des
Mose, seiner Flucht nach Midian und seiner Rückkehr nach Ägypten berichtet
wird. Inzwischen haben E. Blum und J.-L. Ska diese grundsätzliche Überlegung
durch Analysen ergänzt, mit denen sie nachweisen wollen, daß die priester-
lichen Texte tatsächlich nicht zu einem selbständigen Erzählfaden gehören
können7.
Dagegen soll im folgenden gezeigt werden, daß die Argumente, die gegen
die Priesterschrift als Quellenschrift in Ex 1-14 angeführt werden, einer Über-
prüfung nicht standhalten. Die priesterlichen Texte bilden hier vielmehr einen
in sich geschlossenen Zusammenhang, der noch weitgehend erhalten ist. Er wird
durch die nichtpriesterlichen Stücke erheblich gestört. Durch sie wird auch die
Konzeption nicht mehr deutlich, die der priesterliche Verfasser seiner Dar-
stellung zugrundelegte.
II. Die priesterliche Berufung des Mose (Ex 6,2-12; 7,1.2.4-7)
Als erstes Beispiel nenne ich die priesterliche Darstellung der Berufung des
Mose in Ex 6,2-12; 7,1.2.4-7, die in neuerer Zeit schon verschiedentlich als
4 Vgl. z.B. die Tabellen bei K. Elliger, 174; N. Lohfink, Priesterschrift, 222 Anm. 29;
P. Weimar, Struktur, 85 Anm. 18.
5 R. Rendtorff, 130.
6 F.M. Cross, 317f.
7 E. Blum, Studien, 232ff; J.-L. Ska, Place; ders., Remarques, 97ff.
Die priesterliche Berufung des Mose (Ex 6,2-12; 7,1.2.4-7) 3
Begründung für die ursprüngliche Selbständigkeit der Priesterschrift herangezo-
gen wurde8.
Der Abschnitt Ex 6,2-7,7 ist nicht literarisch einheitlich. 6,13-30 wurde später einge-
fügt. Das ergibt sich schon daraus, daß in 6,30 der Einwand des Mose aus 6,12 wieder
aufgenommen wird9. Sekundär ist aber auch 7,3. Bereits F. Kohata hat 7,3b Ρ abgespro-
chen, weil bei Ρ für die ägyptischen Plagen in 7,8ff* nicht der Begriff "Zeichen" (mx) ge-
braucht wird10. Nach 7,9 wird der Pharao von Mose und Aaron ein "Wunderzeichen"
(naiD) fordern. Auch in 11,9f ist nur von "Wunderzeichen" die Rede. Diese beiden Verse
sind zwar verschiedentlich Ρ abgesprochen worden. Es wird aber im folgenden gezeigt
werden, daß sie aus der Priesterschrift stammen11. 7,3b unterscheidet sich aber nicht nur
durch den Begriff "Zeichen" von der priesterlichen Darstellung, sondern der Halbvers
steht hier auch zu früh. Bei Ρ kommt erst in 7,9 die Möglichkeit in den Blick, daß der
Pharao von Mose und Aaron ein Wunderzeichen fordern könnte. In 11,9 teilt Jahwe Mose
mit, warum der Pharao nicht auf Mose und Aaron hört. Bei Ρ erfährt Mose also erst hier,
warum sie den Pharao nicht überzeugen konnten.
Gegen F. Kohata gehört aber auch 7,3a nicht zu P. Ρ verwendet für die Verhärtung
des Herzens des Pharao durchgehend die Wurzel pin (Ex 7,13.22; 8,15; 9,12; 14,4.8). Da-
gegen steht in 7,3a rrop hi. Zudem käme auch diese Ankündigung bei Ρ zu früh. Hier ist
Jahwe erstmals bei der Plage der Geschwüre (9,8-12) in der Verhärtungsnotiz das Sub-
jekt. Dagegen heißt es in den vorangegangenen priesterlichen Plagen: "Da wurde das
Herz des Pharao hart" (7,13.22; 8,15)12. Durch die unterschiedliche Formulierung der
Verhärtungsnotiz will Ρ zeigen, daß eigentlich die Plage der Geschwüre den Pharao hätte
überzeugen müssen. Dazu kam es jedoch nicht, weil Jahwe sein Herz verhärtete. Deshalb
kann Ρ dann in 11,10 im Rückblick auf die Plagen feststellen, daß Jahwe bei ihnen das
Herz des Pharao verhärtete. Nach der Ankündigung in 7,3a ist es aber ein Rätsel, warum
Jahwe in den Verhärtungsnotizen der priesterlichen Plagen nicht immer das Subjekt ist.
Durch 7,3a wird nicht mehr deutlich, daß sich für Ρ die Plage der Geschwüre von den
früheren Wunderzeichen unterschied. Zudem schließt 7,4 glatt an 7,2 an. Daß der Pharao
nicht auf Mose und Aaron hören wird (v. 4aa), bezieht sich auf v. 2b, wonach Aaron in
Gegenwart des Mose von dem Pharao die Entlassung der Israeliten fordern sollte. V. 3
wurde also später eingefügt. Für den Ergänzer sollte Mose, schon bevor er und Aaron zu
dem Pharao gingen, erfahren, warum der Pharao der Entlassungsforderung nicht nach-
kommen wird. V. 3b ist in Anlehnung an 11,9 gebildet worden. Dagegen gibt es zu der
Formulierung in v. 3a in der Plagenerzählung keine direkte Parallele. Möglicherweise be-
8 Vgl. L. Schmidt, Pentateuch, 86ff; K. Koch, 462ff; W.H. Schmidt, Plädoyer, 3ff; ders.,
Exodus, 270ff.
9 Vgl. W.H. Schmidt, Exodus, 296f.
10 F. Kohata, Jahwist, 34-36.
11 Vgl. unten III.
12 So lautete die Verhärtungsnotiz wohl auch in der priesterlichen Froschplage (8,1-
3...11a"/.b). Die Endredaktion hat sie in 8,11 durch die Verstockungsnotiz aus J
ersetzt, vgl. L. Schmidt, Beobachtungen, 81f.
4 Α. Die Priesterschrift in Exodus 1-14
steht eine Beziehung zu 13,15. Dort heißt es: "und es geschah, als der Pharao (es) schwer-
machte, uns zu entlassen...". Dieser Vers steht in dem m.E. späten Abschnitt 13,11-16.
Zu der priesterlichen Erzählung von der Berufung des Mose gehören somit ur-
sprünglich: Ex 6,2-12; 7,1.2.4-713. Dabei besteht die Botschaft an die Israeliten, mit der
Jahwe in 6,6-8 Mose beauftragt, aus zwei Teilen. Die Erkenntnisaussage in 6,7b mar-
kiert deutlich einen Einschnitt. Es geht in 6,6f darum, daß Jahwe die Israeliten aus
Ägypten befreien will. In 6,8 läßt er dann außerdem ankündigen, daß er die Israeliten zu
dem Land bringen und es ihnen als Besitz geben wird. Damit wird in 6,6-8 zwischen der
Befreiung der Israeliten aus Ägypten und ihrem Weg zu dem Land, der in der Gabe des
Landes sein Ziel erreichen wird, unterschieden. Es handelt sich für Ρ um zwei Heilstaten
Jahwes. Sie sind zwar aufeinander bezogen, da die Landnahme die Befreiung aus Ägypten
voraussetzt. Aber die Errettung aus der ägyptischen Zwangsarbeit ist eine Heilstat von
eigener Bedeutung. Das unterstreicht Ρ durch die Erkenntnisaussage in 6,7b. Ab 6,10 ist
dann nur noch die Befreiung aus Ägypten das Thema. Die Rede, mit der Jahwe den
Einwand des Mose von 6,12 widerlegt, hat ebenfalls zwei Teile. In 7,1.2.4aa werden Mose
und Aaron mit der Entlassungsforderung zu dem Pharao gesandt, und Jahwe sagt voraus,
daß sie keinen Erfolg haben werden. In 7,4a/3.b.5 kündigt Jahwe dann an, daß er sich
selbst gegen die Ägypter wenden und die Israeliten herausführen wird. Damit sagt hier
Jahwe bei Ρ voraus, daß sich die folgenden Ereignisse in Ägypten in zwei Etappen
vollziehen werden: Der Entlassungsforderung von Mose und Aaron wird der Pharao nicht
nachkommen. Aber danach wird Jahwe durch sein machtvolles Eingreifen die Israeliten
aus Ägypten herausführen14.
Daß diese priesterliche Erzählung nicht als Ergänzung der vorpriesterlichen
Darstellung entstanden ist, wird vor allem mit drei Argumenten begründet:
1. Sie ist in wesentlichen Punkten eine Dublette zu Ex 3f. Das gilt z.B. für
die Botschaft an die Israeliten in 6,6-8. Bereits nach 3,16f sollte Mose den
13 Nach F. Kohata, Jahwist, 29ff, ist auch 6,8 später eingefügt worden. Dieser Vers darf
jedoch Ρ nicht abgesprochen werden, vgl. dazu unten S. 185f.
14 Nach F. Kohata, Jahwist, 303f, ist es nicht textgemäß, "zu einzelnen Aussagen von
7,3-5 eine Entsprechung in den folgenden Ereignissen zu finden", weil in diesen
Versen keine Angaben enthalten seien, "die auf ein bestimmtes Ereignis voraus-
weisen". Auch nach ihr (Jahwist, 331) besteht aber zwischen v. 4aa und v. 4a/3 ein
Einschnitt. Auch wenn der Ablauf der Ereignisse nicht in den Einzelheiten vor-
ausgesagt wird, wird durch diese Zäsur doch zwischen dem erfolglosen Auftreten von
Mose und Aaron vor dem Pharao und dem machtvollen Wirken Jahwes, durch das
er die Israeliten herausführen wird, unterschieden, vgl. J.-L. Ska, Plaies, 24-26, der
freilich nicht erkannt hat, daß v. 3 sekundär ist. Dagegen sieht P. Weimar, Meerwun-
dererzählung, 219ff, schon nach v. 2 eine Zäsur. Die Jahwerede in 7,1-5 bestehe aus
den beiden Teilen v. 1.2 und v. 3-5. Das setzt jedoch voraus, daß v. 3 ursprünglich ist.
Wahrscheinlich hat aber auch der Ergänzer, der v. 3 einfügte, nach v. 3 keinen
Einschnitt gesehen. Bei ihm bezieht sich v. 4aα ebenfalls auf die Entlassungsforde-
rung in v. 2b. Mit dem Anfang von v. 3 "und ich" markiert er keine Zäsur, sondern
stellt eine Beziehung zu dem betont vorangestellten "du" in v. 2 her.