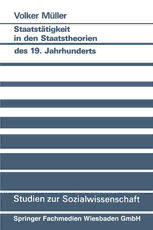Table Of ContentVolker Miiller
Staatstatigkeit
in den Staatstheorien
des 19. Jahrhunderts
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Miiller, Volker:
Staatstătigkeit in den Staatstheorien des 19. Jahrhunderts/
Volker Miiller. - Opladen: Westdt. Veri., 1991
(Studien zur Sozialwissenschaft; Bd. 108)
Zugl.: Konstanz, Univ., Diss., 1990
ISBN 978-3-531-12339-4 ISBN 978-3-322-99519-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-99519-3
NE:GT
Alle Rechte vorbehalten
© 1991 Springer Fachmedien Wiesbaden
Ursprung1ich erschienen bei Westdeutscher Verlag GmbH, Op1aden 1991
Das Werk einschlieB!ich aller seiner Teile ist urheberrechtlich ge
schiitzt. Jede Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Urheber
rechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzu1ăssig und
strafbar. Das gilt insbesondere ftir Vervielfaltigungen, Ubersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektrohischen Systemen.
Umschlaggestaltung: studio ftir visuelle komrnunikation, Diisseldorf
Gedruckt auf săurefreiem Papier
Volker Miiller · Staatstatigkeit in den Staatstheorien des 19. Jahrhunderts
Studien zur Sozialwissenschaft
Band 108
Verwaltung in Deutschland
Historische und sozialwissenschaftliche Untersuchungen
Herausgegeben von Thomas Ellwein
An der Universitat Konstanz besteht seit ihrer Errichtung ein verwaltungswissenschaftlicher
Schwerpunkt. Er ist 1985 durch einen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem
Land Baden-Wiirttemberg geforderten Sonderforschungsbereich "Verwaltung im Wandel" erwei
tert worden. Im SFB werden international und national, historisch und systematisch verglei
chend oder in begrenzten empirischen Studien anhand einzelner Arbeitsfelder der offentlichen
Verwaltung deren Organisation, Verfahren und Wirkungsweise untersucht. In den Teilprojekten,
aus denen die Arbeiten zum Thema "Verwaltung in Deutschland" hervorgehen, sind zunachst
die Gewerbeaufsicht und die Gewerbeforderung ausgewahlt worden; im zweiten Schritt wurde
dies auf die Ortspolizei und die Stragenbauverwaltung sowie schliemich auf die Steuerverwal
tung ausgedehnt. Solche Verwaltungen lassen sich nur bedingt generell untersuchen; sobald
historische Detailforschung oder sozialwissenschaftliche Analysen und Fallstudien ins Spiel
kommen, mug eine regionale Begrenzung erfolgen. Fiir den genannten Arbeitskomplex bildet
dafur im Zweifel der heutige Regierungsbezirk Detmolds die Untersuchungsregion. Erganzt wer
den die Arbeiten durch Untersuchungen liber die Entwicklung des Haushaltsrechts, der Haus
haltsprinzipien und der tatsachlichen Haushalte von Staat (Reich und Landern) und Gemein
den im 19. ] ahrhundert, denn ohne genauere Kenntnis der Haushaltswirklichkeit kann die Auf
gabenteilung zwischen Staat und Gemeinden und iiberhaupt die Aufgabenentwicklung der
offentlichen Verwaltung nicht zureichend dargestellt und erklart werden.
Die Arbeiten folgen teils einem genetischen Ansatz und teils der systematischen Frage nach
dem Verhaltnis zwischen Recht (Rechtsentwicklung) und Verwaltung. Die historischen Beitrage
(zusammengefagt in einer Verwaltungsgeschichte des Regierungsbezirks Detmold) sollen die
Faktoren herausarbeiten, welche das Wachstum und die Veranderungsschiibe in der offentli
chen Verwaltung (in Deutschland) bedingen. Systematisch richtet sich das Erkenntnisinteresse
auf die Position der Verwaltung im demokratischen Prozeg, auf die Wirkungsweise der Fiih
rungsinstrumentarien, vor allem des Gesetzes, und auf die Selbststeuerungsmoglichkeiten der
Verwaltung.
Westdeutscher Verlag
Inhalt
1. Staatliche Steuerung als politik-und verwaltungswissenschaftliches
Paradigma 7
1.1. Theoriegeschichte und Policy Science (Problemaufrill) 11
1.2. Vorgehensweise, Methode und Aufbau 15
2. Liberale Staatstheorie 21
2.1. Angelsăchsischer Liberalismus 21
2.1.1. Adam Smith und Epigonen (Craig, Cooper, Brougham,
Spencer) 23
2.1.2. Der Utilitarismus (Bentham, Lewis, Jevons) 36
2.1.3. Klassischer Liberalismus (Senior, McCulloch, Mill, Sidgwick) 50
2.1.4. Laissez-faire-Kritik und "New Liberalism" (Caimes, Adams,
Ritchie, Green, Bosanquet, Hobson) 65
2.2. Franzosischer Liberalismus (Constant, Bastiat, Dunoyer, Guizot,
Tocqueville, Leroy-Beaulieu) 76
2.3. Deutscher Liberalismus 94
2.3.1. Kant und Wilhelm von Humboldt 96
2.3.2. Der kompensierende Staat (Liider, Kraus, Berg, J akob,
Rotteck) 107
2.3.3. Der steuemde Staat (Schlozer, Sartorius, Ahrens, Rau, Mohl,
Schmitthenner) 128
2.3.4. Der Manchester-Liberalismus (Rochau, Schulze-Delitzsch,
Prince-Smith, Barth) 166
3. Konservative Staatstheorie 177
3.1. Restauration und Romantik 177
3.1.1. Traditionalismus und politische Romantik (Burke, Maistre,
Bonald, Haller, Schlegel, Miiller) 178
3.1.2. Hegel und der okonomische Staatsinterventionismus (Luden,
Călin, Sismondi, Dupont-White) 193
3.2. Politischer Katholizismus 209
3.2.1. Katholische Staatstheorien in Deutschland (Baader, BuB,
Ketteler, Vogelsang, Hitze, Hertling) 209
3.22. Katholizismus und positivistische Soziologie in Frankreich
(Villeneuve-Bargemont, Lamennais, Comte, Le Play) 222
6
3.2.3. Solidarismus (Bourgeois, Gide, Pesch, Durkheim, Ruskin,
Carlyle) 230
3.3. Historische Schule und organische Staatstheorie 238
3.3.1. Dezentraler Stăndestaat (Rehberg, Stein), Protestantismus
(Schleiermacher, Stahl) und historische Schule (List, Roscher,
Knies) 239
3.3.2. Etatismus (Treitschke, Escher, Wagener) und Korporatismus
(Frantz, Huber, Marlo) 251
4. Sozialistische Staatstheorie 265
4.1. Fruhsozialismus 265
4.1.1. Utopismus (Saint-Simon, Fourier, Weitling, Cabet, Babeuf) 266
4.1.2. Etatismus (Owen, Buchez, Buret, Hess, Blanc, Pecqueur,
Bazard) 275
4.2. Deutscher Sozialismus (Fichte, Rodbertus, Lassalle) 287
4.3. Anarchismus (Godwin, Proudhon, Bakunin, Kropotkin,
Landauer, Sorei) 298
4.4. Marxismus (Marx, Engels, Liebknecht, Bebel, Kautsky,
Lenin) 308
5. Kathedersozialismus 321
5.1. Staatssozialismus und gemiilligter Etatismus 322
5.1.1. Lorenz van Stein und die Sozialrechtler Onama-Stemegg,
A. Menger, L. Stein, Ihering, Gneist, Sanvey) 323
5.1.2. Exkurs: Juristische Staatslehren (Zoepfl, Schulze, Gerber,
Laband, Hănel, Jellinek) 343
5.1.3. Adolph Wagner und die gemiilligten Etatisten (Schmoller,
Scheel, Samter, Philippovich, Conrad, Schonberg, Cohn) 351
5.2. Sozialliberalismus 369
5.2.1. Albert Schăffle, Lujo Brentano und Epigonen 369
5.2.2. Neue Sozialpolitik und Bodenrefom1-Bewegung (Sombart,
Weber, Naumann, George, Dtihring, Oppenheimer) 381
5.3. Sozialistischer Reformismus (Webb, Jaures, Malon, Vollmar,
Bemstein, Calwer) 394
6. Staatstheorie und Staatstâtigkeit (Ergebnis) 407
Literaturverzeichnis 426
Namensregister 466
1. Staatliche Steuerung als politik- und verwaltungswis
senschaftliches Paradigma
Die Aufgabe des Staates bestebt einzig darin, fiir Zucbt und Wohlfahrt zu sorgen,
soll Goethe gesagt haben (Sbanahan 1962, S. 48). Napoleons Finanzminister
Nicolas-Fran\(Ois Mollien (1758-1850) verglich den Staat mit der Sonne: Er babe
dafiir zu sorgen, daB sicb die gesellschaftlicben Institutionen wie Himmelskorper
in geregelten Bahnen, in allgemeiner Harmonie um ibn bewegen, obne jemals aus
dieser Bahn auszubrecben (Scbăffle 1896 II, S. 450 Fn. 1). Zwei Jahrbunderte
zuvor batte der Spanier Antonio Perez in einer Adresse zum Regierungsantritt
Pbilipps III. betont, wie wesentlicb es sei, daB es im Staat an nicbts Notwendigem
feble. Eine gute Verwaltung und gute Beamte b6ten die beste Voraussetzung dafiir.
MiBstiinde seien mit Methode und nicbt mit Palliativen zu bekampfen, denn sonst
kehrten sie friiher oder spater mit gewaltiger Explosion zuriick 1.
Dies batte so auch im 19. Jahrbundert geschrieben werden konnen. Die Frage
nacb ihrer Handlungskompetenz bat die Regierungen zu allen Zeiten bescbăftigt,
wobei Kompetenz nicbt recbtlicb-restriktiv verstanden werden darf, sondem im
Sinne der instrumentellen Fahigkeit, bestimmte gewiinscbte Zustiinde im jeweili
gen Staat zu verwirklicben. Vergleicbt man umgekebrt Fragestellungen und Ant
worten der Autoren des letzten Jahrhunderts mit denen, die in den beutigen Policy
Sciences diskutiert werden, so verbliifft die groBe Zahl sogenannter "deja vu"
Erlebnisse (Nonnenmacber 1984, S. 245). Was z.B. beute unter dem Sticbwort
"Verrecbtlicbung" diskutiert wird, bat im 19. Jahrbundert zahlreicbe Theoretiker in
ahnlicber Weise bescbăftigt. Oft gleichen sicb nicbt nur die Fragen, sondem aucb
die Antworten.
In der vorliegenden Arbeit wird versucbt, Staatstheorien des 19. J ahrbunderts
in ihrer ganzen Heterogenitat auf Aussagen zur Staatstătigkeit und zu staatlicbem
Handeln in der Innenpolitik zu durcbforsten. Unter Staatstbeorien werden dabei
generell normative Aussagen iiber staatlicbes Handeln verstanden - der Begriff
wird also sebr weit gefaBt. Allerdings interessieren nicbt die Staatstheorien als sol
cbe, sondem nur jenes Segment, das sicb mit dem tatsacblicben (innenpolitischen)
Handeln, dem politikfeldbezogenen Agieren von Regierungen und Verwaltungen
bescbăftigt. Dieses staatlicbe Handeln als Gegenstand staatstheoretiscber Literatur
des 19. Jahrbunderts bildet damit den Gegenstand der Arbeit. Staatstatigkeit bietet
sicb als Oberbegriff an, da die Autoren des Untersucbungszeitraums auf eine tbeo-
Vgl. Perez 1867, S. 275 und 289; Perez (1540-1611), der friihere Sekretăr Philipps IL, befand sich
damals im englischen Exil.
8 Kapitel1
retische Kllinmg sich iiberlagemder Tennini wie Staatsaufgaben, Staatsfunktionen,
(Staats-)Intervention, Staatshilfe, Staatseingriff, Staatseinwirkung oder die
"Dazwischenkunft" des Staats iiberwiegend verzichtet haben. Alle diese Vokabeln
werden hier unter Staatstătigkeit subsumiert. Der Begriff leitet die systematische
Durchsicht des Quellenmaterials an. Ziei ist es, auf diesem Wege zu einer
Geschichte der nom1ativen Theorie des Staatshandelns im 19. J ahrlmndert zu
gelangen.
Ausgangspunkt der Untersuchung ist das Paradigma der Policy Sciences in der
heutigen Politik- und Verwaltungswissenschaft. Gegenstand dieser von der ameri
kanischen Politikwissenschaft iibemommenen Teildisziplin sind alle Fragen irn
Zusammenhang mit materiellen Politikinhalten, in Abgrenzung zu polity (Fragen
der politischen Ordnung) und politics (Fragen, die den politischen ProzeB betref
fen). Was der Staat angesichts bestimmter Problemkonstellationen tut bzw. tun
soli, und welcher Instrumente er sich bedient bzw. bedienen soli, um die selbstge
steckten Ziele zu erreichen, sind die zentralen Fragestellungen der Policy Sciences,
sei es in deskriptiver, sei es in prăskriptiver Absicht. Prăskriptiv, im Sinne einer
Beratungswissenschaft, versuchen die Policy Sciences Modelle bzw. Strategien
anzubieten, die der Politik bei der Optimierung von Staatstătigkeit behilflich sein
konnen. Fiir ein solches spezifisch zielorientiertes, absichtsvolles, Verănderungen
anvisierendes staatliches Handeln hat sich der Begriff der Steuerung eingebiirgert,
insbesondere in Abgrenzung zu jener staatlichen Tătigkeit, die auf Kontinuităt und
VerlăBlichkeit abzielt.
Der Steuerungsbegriff wird in den Policy Sciences recht global verwendet,
gelegentlich synonym mit dem Begriff der Regelung bzw. Regulierung. Urspriing
lich handelt es sich um Lehnwărter aus der Kybemetik, die von Karl Deutsch in
die "Politische Kybemetik" (1963) iibemommen worden sind. Deutsch nennt vier
Voraussetzungen fiir Steuerungssysteme. Das zu steuemde System muB sich
gegeniiber der AuBenwelt in einer Zielsituation befinden, es muB Informationen
aufnehmen, um das Verhăltnis zwischen der eigenen Position und dem angesteu
erten Ziei bestimmen zu konnen, es muB zur Reaktion auf diese Informationen in
der Lage sein, und die Zielerreichung muB eine systeminteme Spannungsvermin
denmg zur Folge haben (Deutsch 1973, S. 257). Von einer Steuerungstheorie kann
bei Deutsch noch keine Rede sein. Ihm geht es in erster Linie darum, das
Begriffsinventar der (naturwissenschaftlichen) Systemtheorie auf politisches Ver
halten zu iibertragen, um aus den abstrakten Aussagen iiber Systemverhalten Ana
logien fiir den politischen ProzeB ableiten zu konnen. Deutsch macht deutlich, daB
die Systemsicht des politischen Prozesses im Grunde eine Weiterentwicklung der
mechanistischen Staatsauffassung der Aufklărung (Kant, Schlozer) und der organi
zistisch-biologischen Sicht des 19. Jahrhunderts (von Adam Miiller bis Schăffle)
darstellt. Wăhrend Deutsch das kybemetische Begriffssystem mehr heuristisch zur
Kennzeichnung politischen Verhaltens iibemimmt, orientiert sich Naschold (1969,
S. 25) streng an der kybemetischen Definition von Steuerung und Regelung,
wonach Steuerung lediglich ein theoretischer Grenzfall von Regelungssystemen
Staatliche Steuerung 9
ist. Ein Steuerungssystem fiihrt nur unter der Voraussetzung vollstăndiger Infor
mation zum Ziel. Das System ist offen; das Ziei kann nur erreicht ader verfehlt
werden. Dagegen erlauben die Regelungssysteme Fehlversuche durch einen inte
grierten Lernmechanismus. Wird das Ziei zunlichst verfehlt, so gelangt die Infor
mation des Fehlversuchs iiber eine Riickkoppelungsschleife zur Regelungszentrale
zuriick. Ein neuer Versuch kann gestartet und das Ziei nach mehr ader weniger
hliufigen Riickkoppelungen auf dem Wege einer sukzessiven Approximation
erreicht werden (S. 24). Lehnt man sich an diesen engen kybemetischen Steue
rungsbegriff an, so diirfte er auf offene, hochkomplexe soziale Systeme eigentlich
gar nicht angewendet werden, da Kenntnis aller Interventionsvariablen
(vollstăndige Information) praktisch nie gegeben ist. Dennoch spricht die politi
sche Systemtheorie wie iiberhaupt die sich immer mehr des systemtheoretischen
Begriffsgeriists bedienende Politik- und Verwaltungswissenschaft stăndig von
Steuerung, Regelung ader Regulierung, wlihrend der Begriff der Lenkung eber
dem wirtschaftspolitischen Vokabular entstammt.
In der Theorie der Wirtschaftspolitik ist der Steuerungsbegriff nicht erst seit
der Globalsteuerung etabliert. Nach Recktenwald (Lexikon der Staats- und Geld
wirtschaft, Munchen 1983) wird unter Steuerungstheorie die Suche nach mathe
matischen Verfahren verstanden, mit deren Hilfe man das Verhalten eines dynami
schen Systems zweckgerecht lenken kann. Was aher ist lenken? Laut Handlexikon
Organisation (hrsg. von der Akademie fiir Organisation, Frankfurt am Main 1976)
bildet Lenkung den Oberbegriff zu Steuerung und Regelung. Recktenwalds Defi
nition enthlilt eine Riickkoppelungsschleife.
Da sich der enge kybernetische Steuerungsbegriff fiir soziale Systeme nicht
eignet, llige es nahe, von Regelung zu sprechen. Dieser Begriff bat sich gegen den
der Steuerung allerdings nicht durchsetzen konnen, zumal er semantisch anders
besetzt ist. Regelung wird im politikwissenschaftlichen Sprachgebrauch hliufig mit
Regulierung gleichgesetzt und im Sinne von Steuerung durch Recht verwendet,
was in Begriffen wie "regulative Politik", "regulative Programme" ader "regulati
ves Recht" (Voigt), aher aueh in Deregulierung (aus dem englischen "deregula
tion", der Aufhebung von als iiberfliissig erachteten Rechtsnormen) zum Ausdruck
kommt. Je hliufiger der Steuerungsbegriff in der politik- und verwaltungswissen
schaftlichen Literatur auftaucht, je mehr er sich einbiirgert, desto weniger wird
iiber seine theoretischen Implikationen reflektiert2. Selbst Deutsch, dessen bahn
brechende Arbeit den Steuerungsbegriff in der Politikwissenschaft popular machte,
liefert keine exakte Definition. Er setzt Steuerung mit Regulierung, Lenkung und
Leitung gleich (Deutsch 1973, S. 128) und greift bei aller einschlligigen Termino
logie auch auf die etymologische Wurzel zuriick, indem eran die Entwicklung des
lateinischen Verbums gubemare zum mademen government bzw. gouvemement
erinnert (S. 255). Steuem hie6e also regieren schlechthin:
2 Vgl. Ellwein 1987, S. 200 Fn. 6, wonach eine theoretische Klărung des Begriffs nach wie vor fehlt;
vgl. auch Mayntz 1987, S. 91.