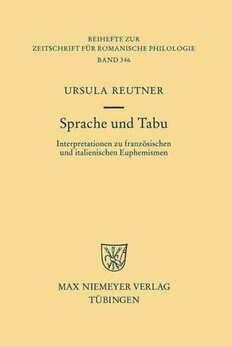Table Of ContentBEIHEFTEZUR
ZEITSCHRIFTF(cid:1)RROMANISCHEPHILOLOGIE
BEGR(cid:1)NDETVONGUSTAVGR(cid:2)BER
HERAUSGEGEBENVONG(cid:1)NTERHOLTUS
Band346
URSULA REUTNER
Sprache und Tabu
Interpretationen zu franzçsischen
und italienischen Euphemismen
n
MAX NIEMEYERVERLAG T(cid:1)BINGEN
2009
Gedruckt mit Unterstützung des Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft der VG Wort
BibliografischeInformationderDeutschenNationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie;detailliertebibliografischeDatensindimInternet(cid:1)berhttp://dnb.ddb.deabrufbar.
ISBN978-3-484-52346-3 ISSN0084-5396
(cid:2)MaxNiemeyerVerlag,T(cid:1)bingen2009
EinImprintderWalterdeGruyterGmbH&Co.KG
http://www.niemeyer.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich gesch(cid:1)tzt. Jede Verwertung
außerhalb derengen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes istohne Zustimmungdes Verlages
unzul(cid:3)ssigundstrafbar.Dasgiltinsbesonderef(cid:1)rVervielf(cid:3)ltigungen,(cid:4)bersetzungen,Mikro-
verfilmungenunddieEinspeicherungundVerarbeitunginelektronischenSystemen.
PrintedinGermany.
Gedrucktaufalterungsbest(cid:3)ndigemPapier.
Satz:JohannaBoy,Brennberg
Gesamtherstellung:Hubert&Co.,Gçttingen
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung. Zielsetzung und Aufbau der Untersuchung . . . . . . . . . . . 1
2. Begriffl iche Vorklärungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Tabu und Tabuisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.1 Zum Tabubegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.2 Vom Themen- zum Lauttabu. Ein Kontinuum . . . . . . 12
2.1.3 Tabuisierung aus zeichentheoretischer Sicht . . . . . . . . 14
2.2 Tabuisierung und Enttabuisierung. Der Euphemismus . . . . . . . 19
2.2.1 Auswertung historischer und aktueller
Defi nitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2.2 Über Motive und Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.3 Zu Euphemismen aus soziolinguistischer Sicht . . . . . 31
2.3 Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3. Tabubereiche im französischen und italienischen Wortschatz . . . . . 37
3.1 Technische Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.1.1 Zur Wahl lexikographischer Korpora . . . . . . . . . . . . . . 37
3.1.2 Zur Erstellung und Darstellung der Korpora . . . . . . . 39
3.2 Euphemismen einzelner Bereiche im Vergleich . . . . . . . . . . . . . 42
3.2.1 Glaube, Aberglaube und Magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2.2 Sterben und Tod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2.3 Krankheiten und andere Einschränkungen . . . . . . . . . 53
3.2.4 Eigenschaften und Verhaltensweisen . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2.5 Liebes- und Sexualleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.6 Körperteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.2.7 Weiblicher Lebenszyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.2.8 Toilettengang und Toilette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.2.9 Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung und Militär . . . . . . 80
3.3 Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4. Auswertung der Korpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.1 Zur lexikographischen Behandlung von Euphemismen . . . . . 85
4.1.1 Zur Systematik der Markierungskennzeichnung . . . . 85
4.1.2 Markierungsangaben im Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.1.3 Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
V
4.2 Vergleiche zu den von Sprachtabus belegten
Themenbereichen der Korpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.2.1 Der euphemistische Ertrag beider Korpora
im Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.2.2 Sprachtabus als Ergebnisse von Umfragen . . . . . . . . . 109
4.2.3 Weitere Aufstellungen zu Euphemismen . . . . . . . . . . . 116
4.2.4 Resüme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.3 Zum Kontinuum der Arten euphemistischer
Neuperspektivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.3.1 Formale Modifi kationen des Signifi kanten . . . . . . . . 121
4.3.1.1 Kürzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.3.1.2 Deformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
4.3.2 Semantischer Ersatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.3.2.1 Lexikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4.3.2.2 Vom Lexikon zur Morphosyntax . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
4.3.3 Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5. Zur Einteilung und Raison d’être der Euphemismen . . . . . . . . . . . . . 155
5.1 «Ethik und Religion». Sprachliche Verhaltenskodizes
zwischen Furcht und Scham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.1.1 Mythisch-religiöses Sprachdenken und
Wortverständnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.1.2 Blasphemie auf der Basis von Christentum,
Kirche und Magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
5.1.2.1 Das Alte Testament. Vom Dekalog bis Hiob . . . . . . . 161
5.1.2.2 Über Blasphemie in Kirchengeschichte
und weltlicher Legisl ative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
5.1.2.3 Psychologische Aspekte blasphemischen
Fluchens. Zur Funktion tabuisierter Ausdrücke
und zur Genese von Euphemismen . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.1.2.4 Zu Veränderungen im Charakter der Flüche.
Le mot de Cambronne als Wendepunkt. . . . . . . . . . . . 176
5.1.3 Sprachtabus bei Krankheit und Tod . . . . . . . . . . . . . . . 182
5.1.3.1 Krankheiten zwischen Furcht und Scham . . . . . . . . . . 182
5.1.3.2 Das Ende des Lebens. Zwischen Furcht
und Hoffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
5.1.4 Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
5.2 «Ethik und Ästhetik». Rücksichtnahme im Verhalten
und Sprachverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
5.2.1 Die Epoche von Renaissance und Humanismus
als Markstein im Zivilisationsprozess. Italien
als Ausgangspunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
5.2.1.1 Zum Stellenwert der Sprache in Castigliones
Cortegiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
VI
5.2.1.2 Giovanni della Casas Galateo als Schule
der Höfl ichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
5.2.1.3 Stefano Guazzos Civil conversazione . . . . . . . . . . . . . . 212
5.2.1.4 Zwischenresümee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
5.2.2 Die Entwicklung in Frankreich. Von der Kritik
am Hofl eben zum Preziösentum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
5.2.2.1 Heinrich IV. und das Hôtel de Rambouillet . . . . . . . 216
5.2.2.2 Sprachethik, Ästhetik und Distinktionswille.
Die Preziösität und der Euphemismus . . . . . . . . . . . . 222
5.2.2.3 Zwischenresümee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
5.2.3 Zur allgemeinen Charakteristik der weiteren
Entwicklung der Manieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
5.2.3.1 Die Verinnerlichung des Schamgefühls . . . . . . . . . . . . 234
5.2.3.2 Das Abstecken der Schamgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
5.2.4 Achtung und Selbstachtung im Spiegel
des Wortschatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
5.2.4.1 Liebes- und Sexualleben im Wandel
des Schamgefühls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
5.2.4.2 Nacktheit und Prüderie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
5.2.4.3 Der weibliche Lebenszyklus zwischen
Dämonisierung und Normalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
5.2.4.4 Skatologie. Von der Unbefangenheit zur Scham . . . . 261
5.2.5 Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
5.3 «Ethik und Sozialpolitik». Die Politische Korrektheit
und vergleichbare Entwicklungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
5.3.1 Entstehung und Geschichte. Die Wurzeln
in den USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
5.3.1.1 Der soziokulturelle Kontext der Entstehung . . . . . . . 270
5.3.1.2 Die Gesellschaft der Opfer sowie Ridikülisierung
und Erweiterung des Ausdrucks politically correct . . 275
5.3.2 Zur Kontroverse um den Sinn «politisch
korrekten Sprachgeb rauchs» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
5.3.2.1 Die Macht der Sprache und ihre
Ideologiebesetztheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
5.3.2.2 Die Frage der Wertepräferenz innerhalb
einer Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
5.3.2.3 Der Euphemismus zwischen Sprache und Denken . . 296
5.3.3 Vom politically correct zum politiquement correct
bzw. politicamente corretto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
5.3.3.1 Der unterschiedliche soziokulturelle Kontext . . . . . . . 312
5.3.3.2 Die Ausweitung des Begriffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
5.3.4 Politisch korrekte Euphemismen thematisch
geordnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
5.3.4.1 Rasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
VII
5.3.4.2 Physische Einschränkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
5.3.4.3 Alter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
5.3.4.4 Sexuelle Identität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
5.3.4.5 Geringes Sozialprestige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
5.3.5 Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
5.4 «Ethik ohne Moral». Profi t- und Profi lierungsdenken
im öffentlichen Leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
5.4.1 Defi nitorische Fragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
5.4.1.1 Die Notwendigkeit der Abgrenzung zur
Politischen Korrektheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
5.4.1.2 Die Unterschiede zum doublespeak . . . . . . . . . . . . . . . 370
5.4.1.3 Sprachtäuschung, Lüge und die Frage
der Relation zwischen Bezeichnung und Realität . . . 372
5.4.1.4 «Ethik und Sozialpolitik» oder
«Ethik ohne Moral» als Frage der Perspektive . . . . . 374
5.4.2 Euphemismen ohne Moral unter thematischem
Aspekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
5.4.2.1 Arbeit, Arbeitslosigkeit und die neue
Wirtschaftsordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
5.4.2.2 Kriegsereignisse und kriegerische Handlungen . . . . . 383
5.4.3 Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
6. Schlussbetrachtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
6.1 Rückblick: Lexikographische und kulturhistorische
Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
6.2 Refl exe: Qualis homo, talis eius oratio? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
6.3 Resümee: Das Phänomen Euphemismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Wortregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
VIII
1. Einleitung. Zielsetzung und Aufbau der Untersuchung
Sprachwissenschaft, richtig verstanden, ist Erfors chung
der Welt mit allem, was darin ist, allem Irdischen und
allem Seelischen, ist Form und Inhalt des menschli-
chen Denkens.
Elise Richter
Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein bestimmter Tabus in einer
Gesellschaft ist ein exzellentes Kriterium, um Aussagen zum Entwicklungs-
stand ihrer civilité und zu ihrem kulturellen Selbstverständnis zu treffen, und
kann als Ausdruck ihrer Mentalität und ihrer Wahrnehmung der Realität
interpretiert werden. Es handelt sich dabei um Verhaltensgebote mythisch-
religiöser oder profaner Natur, teilweise sogar um strafbewehrte Verbote,
deren Existenz und Stellenwert dem gesell schaftlichen Wandel unterliegen
und daher je nach Gesellschaft und Zeitr aum unterschiedliche Ausprägungen
erfahren. Als Bestandteile eines Verhaltenskodexes betreffen Tabus immer
auch sprachl iches Verhalten, in dem sie in einem Kontin uum greifbar wer-
den, das vom Schweigen oder vom Verschweigen tabuisierter Themen oder
Aus drucksweisen bis zu deren vielfältigen euphemistischen Ersatzmöglich-
keiten reicht. Aufgrund der soziokulturellen Bedingtheit von Tabus impli-
ziert dies eine in jeder Sprachkultur unterschiedlich erfolgende Entwicklung
von Bezeichnungsmöglichkeiten, mit deren Hilfe die jeweils wirksamen Ar-
ten sprachlicher Tabuisierung in der Gesellschaft um gangen werden können.
Dabei drängt sich zunächst die Frage auf, ob angesichts der heute weit-
gefassten Semantik von Tabu, die ursprünglich auf den kultischen Bereich
begrenzt war, (2.1.1) die verschiedenen Arten sprachlicher Äußerungsbe-
schränkungen immer noch unter einem einzigen Begriff, dem des sprachli-
chen Tabus, subsumiert bzw. auf einen gemeinsamen Nenner gebracht wer-
den können (2.1.2). Schließlich handelt es sich dabei um Phänomene, die
entweder aus der Tradition heraus okt royiert erscheinen oder mit unter-
schiedlicher Zielsetzung und Beg ründung meist zeit- und gesellschaftsspezi-
fi sch neu oder wiederholt selbst aufer legt werden. Zu Ersteren gehören vor
allem die Tabus des magischen und religiö sen Bereichs, zu Letzteren, den
profanen Tabus, so unterschiedliche Erschei nungen wie das viel leicht zuviel
belächelte Preziösentum im Frankreich des 17. Jahrhunderts oder neueren
Datums die Politische Korrektheit. Dazu stellt sich auch die von der Dis-
1
kussion oft auf Sach- oder Sprachtabu zentrierte Frage, was denn eigentlich
tabui siert wird, eine Frage, die zeichentheoretisch klar beantwortet werden
kann (2.1.3). Die damit präzisierte sprachliche Tabuisierung hängt genetisch
eng mit der von ihr ausgelösten Enttabuisierung zusammen. Letztere fi ndet
ihren Ausdruck in den vielfältigen Erscheinungsformen, die unter dem Be-
griff des Euphem ismus zusammengefasst werden. Dieser vielschichtig gese-
hene Begriff ist auf der Basis der bestehenden Defi nitionen nicht einfach zu
greifen (2.2.1) und in seinen Motiven und Funktionen (2.2.2) sowie soziolin-
guistisch (2.2.3) zu erfassen, kann aber unbestrit ten als der geeignetste Maß-
stab für das Erkennen und Bewerten sprachlicher Tabuisierung im Wort-
schatz gelten. Denn er dient dazu, den sprachl ichen Tabubruch zu vermeid en,
der eben erst durch die euphemistische Bezeichnung als onomasiolo gische
Umgehung von Sprachtabus greifbar wird.
Obwohl diese Sachverhalte weitgehend bekannt sind, fanden der Ver-
gleich zweier Sprachen und damit auch die sich aus ihm möglicher weise
ergeben den Erkenntnisse in der Sprachtabuforschung bislang noch keine
systematische Beachtung. Hierfür wurden die französische und italienische
Sprache ausgewählt, deren Sprecher sich zwar in ihrem Sprachverh alten und
ihrer Mentalität sowie in ihren traditionellen Sitten und Gebräuchen klar un-
terscheiden, die aber gleichzeitig zu zwei für die europäische Kulturgeschichte
phasenweise besonders richtungsweisenden Sprachkulturen gehören, deren
Entwicklung über Jahrhunderte eng miteinander vernetzt war, so dass sich
die jeweils zivilisatorische Bedingtheit von Tabu und Euphemismus hier in
exemplarischer Weise auftut. Dabei lässt sich sehr schnell erkennen, dass die
Euphemismusforschung in den beiden Sprachen bisher sehr unterschiedlichen
Stellenwert hat. Seit Nyrop (1913) im siebten Buch des vierten Bandes seiner
Grammaire historique eine aus führliche und materialreiche Behandlung des
Themas vorgelegt hat, sind zum Französischen keine vergleichb aren Darstel-
lungen mehr erschienen, sondern led iglich Aufsätze zu Einzelphän omenen
oder -fragen. Lebsanft bezeichnet es daher zu Recht als «parent pauvre ro-
manistischer Sprachtabu- und Euphemismusfors chung» (1997, 112) und gibt
selbst einen sehr anregenden «Anstoß zu einer neuen Form der Analyse von
Sprachtabu und Euphemismus als sprach- und kult urhistorischen Phänome-
nen» (1997, 125). Für das Italienische ist als umfas sende Untersuchung v.a.
diejenige von Nora Galli de’ Paratesi (1964) zu nennen, ferner die thematisch
auf Ers atzmechanismen begrenzte Arbeit von Widłak (1970) und die dem
Teilbereich des sexuell-erotischen Vokabulars gewidmete Studie von Radt-
ke (1980), die auch Hinweise auf andere romanische Sprachen enthält. Es
handelt sich also durchweg um ältere Arbeiten, die angesichts der Ent- und
Neutabuisierung, wie sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgte,
den aktuellen Euphemismenstand nicht mehr belegen können.1
1 Zum Stand in anderen romanischen Sprachen cf. zum Portugiesischen die material-
2