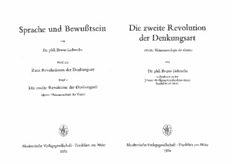Table Of ContentSprache und Bewußtsein Die zweite Revolution
der Denkungsart
Dr' Phil' Bruno Liebrucks HEGEL: Phänomenologie des Geistes
Band 4/5 von
Zwei Revolutionen der Denkungsart Dr. Phil. Bruno Liebrucks
B d o.Professor an der
an 5 Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
Frankfurt am Main
Die zweite Revolution der Denkungsart V
HEGEL: Phänomenologie des Geistes
Akademische Verlagsgesellschaft - Frankfurt am Main AkademischeVerlagsgesellschaft - Frankfurt am Main
1970 1970
Bruno Liebrucks Sprache und Bewußtsein Band 5
Corrígenda
S.41 Zeile 3 von oben. Hinter μñöv lies statt štegovı tuütóv, ëtegou
S 52 Zeile 6-7 von oben lies statt Einkäuferin: ››Höl<ersfrau« (Z. 6)
statt »I-Iökersfrau<<: Einkäuferin (Z. 7)
4 Zeile8 vonuntenliesstattDazu,müssen: Dazumüssen
6 Zeile 8vonuntenliesstattSo: Sie
Zeile I3 von oben liesstatt anderes das Wesen: anderes, dasWesen
mmuıg/› H\Ooo0<›-#~›-\1D Zeile 1 von unten lies stattdas es für: daß es für
S 154 Zeile 13 von unten liesstattdn: den
S 163 Zeile 19 von unten lies statt Weltlauf-: Weltlauf
S 181 Zeile 9 von unten lies stattRecht.: Recht:
S 196 'Zeile 5 von oben lies stattGlanzen: Glanze
S 237 Zeile 8 von unten lies statt darum-: darum
S 246 Zeile 6 von unten lies statt Untergang.: Untergang,
S 2.58 Zeile I6 von unten lies statt wesentliche: Wesentliche
S 285 Zeile 3 von unten lies statt gottliche: göttliche
S 32.7 Zeile 1 von unten lies statt ››Saltomortali«: »Salto mortale«
S 344 Zeile I4 von oben lies statt liegen innerhalb: liegen, innerhalb
S 364 Zeile zo von unten lies statt verkehrten: verkehrte
S 37o Zeile 1.von oben lies statt Subjekt spricht: Subjekt, spricht.
S. 376 Zeile 2.2.lies statt Außerhalb der: Ohne die
Letzte Seite Anzeigenteil Zeile 8 lies statt zweigrößte: zweitgrößte.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zu Band 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. VII
Einleitung
DieSprachlichkeitdes Denkens innerhalb derDialektikvon I-IEGE.Ls »Phäno-
menologie des Geistes« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Diezweite Revolution derDenkungsart . . . . . . . . . . . . . _ . 5
I.Teil;H1zGEL:Phänomenologie des Geistes . . . . ._ 7
A. Bewußtsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Selbstbewußtsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . . . 73
C. Vernunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 111
Der Geist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 182.
Die Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 2.62.
Das absolute Wissen . . . . . . . .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 2.88
II. Teil: Schlußbemerkung zu Band 4 und 5 - - . - . - . . .. 2.93
III. Teil: Die Einleitung und die Vorrede zur
Phänomenologie des Geistes . . . . . . . . . . . . . . .. 317
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Vorrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
© 1970 Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main
OhneausdrücklicheGenehmigungdesVerlages istesauchnichtgestattet,diesesBuch oder
Teile daraus auf photomechanischem Wege (Photokopie, Mikrokopıe) zu vervıelfaltıgen
Printedin Yugoslavia. Ges-amtherstellung: DELO, Ljubljana
Vorwort zu Band 5
An die Stelle der transzendentalen Bestimmung der logischen Form des Denkens
überhaup t durch KANT tritt indiesem Band dieBestimmung des mensch -
lichen Denkens als existíerender spekulativer Satz. Dieses Denken tritt hier als
erscheinendes Denken, d. h. in unserem Zusammenhang als Geist im Sinne seiner
Bestimmung als menschlicher Weltumgang auf.
Erst in der Logik (››Sprache und Bewußtsein« Band 6) wird sich die Bedeutung
davon, daß Sein die Unmittelbarkeit des Begriffs ist, zeigen, wenn wir durch die
Interpretation der »Phänoınenologie des Geistes« so weit vorbereitet sind, Unmit-
telbarkeit als Gegenständlichkeit zu lesen. Die Relativität einer als vom Menschen
unabhängigvorgestellten Welt zumMenschenisterstdann in ihrem nichtidealisti-
schen Charakter zu begreifen, wenn man gelernt hat, daß »Unabhängigkeit vom
Begriff« nur dann mit Sinn zuverbinden ist, wenn sie in einer Existenzweise nicht
mehr vorgestellt, sondern gedach1:ist, die innerhalb des Begriffs ihre Bewegung
hat, nachdem ihr Stattfinden als Verstand als ihr Moment erkannt ist. Ich habe
deshalb den Kommentar zur »Phänomenologie des Geistes« an vielen Stellen mit
Hinweisen auf den Anfang der Logik HEGELS versehen, die selbst als immer-
währender Anfang existiert. Deshalb erlaube ich mir auch die Antizipation, daß
sich erst in der Logik HEGELS zeigen wird, daß dem Satz von der logischen Vor-
ordnung der logischen Form vor der grammatischen der Sprache nur dann Wahr-
heit innewohnt, wenn ihm zugleich der Satz von der logischen Vorordnung der
grammatischen Form der Sprache vor der logischen als Gegensatz entgegentritt.
Erst damitwerden wir das bis heute unbekanntgebliebene Verhältnis von Sprache
und Denken, das WILHELM von HUMBOLDT vorgetragen hat, in die Philosophie
eingeholt haben.
Dieser Band dientderEinübungin einen derZugänge zummenschlichen Begriff,
mit dem die Logik HEGELS beginnt. In ihm handelt es sich um die Erkenntnis der
Existenz des spekulativenSatzesinjeder Stufe des Bewußtseins. Was eine Stufedes
Bewußtseins sagt, wissenwir erst von der Kenntnis aller Stufen her, die erst als
dasGanzedasWahresind.UmgekehrtgiltderSatz,daßdieKenntnis undErkennt-
nis des Ganzen erstvon den Teilen her zu gewinnen ist. Als identische Gegenteile
Werden sich Ganzes und Teil allerdings erst im zweiten Teil der Logik HEGELs vor
den Menschen stellen. Daher pflegen alle Einzelzitate aus den 1-Iegelschen Haupt-
WerkendasbekannteidealistischeMärchen vonseinerPhilosophievorzutragen, das
den spekulativen Machenschaften eines Großbürgertuıns entspricht, welches sich
in diesen Tagen nicht nur im Europa unseres Jahrhunderts zum zweiten Male an-
schickt, den Geist, d. h. den menschlichen Weltumgang, an die heraufziehenden
neuen Ungetümezu verraten.
Dieser Band will mit den hier angedeuteten Richtstrahlern zur Logik gelesen
werden, ist aberzunächstals KomplementbandzurKantuntersuchung aufzufassen.
Deshalb hätteer, wieursprünglichgeplant undvorgelegt,gleichzeitigmitBand 4
erscheinensollen. EswarenlediglichtechnischeGründe, die sein Erscheinenum ein In jener Ansicht aber zeigt sich der neue Gegenstand als
ganzes Jahr verzögert haben. geworden durch eine Umkehrung des Bewußt-
Frau Zimbrich und Herr Dr. Gutterer haben mich freundlicherweise seins selbst.
von den Korrekturen fast völlig entlastet. Ich danke ihnen dafür. Wegen des nicht
HEGEL: Phänomenologie des Geistes. Einleitung.
sehr großen Umfangs desBandeswurdevonHinweisen abgesehen. Der Leserwird
(Felix Meiner 1949. 5. Auflage. S. 74.)
den durchgehenden Zug des Aufweises der Sprachlichkeit des menschlichen Den-
kens von der ersten Zeile an auch dort erkennen, wo HEGEL sie entsprechend der
jeweiligen Lage und Bewegung des Bewußtseins zwar immer zeigt aber nicht aus-
spricht.
Frankfurt am Main, im Dezember 1969
BRUNOLınßiwcks
Einleitung
Die Sprachlichkeit des Denkens innerhalb der Dialektik
von Hrcıars ››Phänomenologiedes Geistes«
Die Grenze zum dialektischen Denken ist überschritten. Nach der in Bd. 3 von
»Sprache und Bewußtsein« gegebenen Einführung in dialektische Grundbegriffe
soll die Sprachlichkeit des dialektischen Denkens auf dem Rücken der Errungen-
schaften KANTS im sphärenmischenden Komponieren von Kommentar und Kritik
an der »Phänomenologie des Geistes« aufgezeigt werden (Vgl. Vorrede zu Bd. 1-6
S. 37).
DieSprachlichkeitdesdialektischenDenkenskannjetztinihrerVerwandtschaftzu
Humboldt und in ihrem Abstand von KANT verdeutlichtwerden. Die Bestimmung
derlogischen Formzu urteilenwar insofern transzendental, als KANT alleErkennt-
nis ››transzendental« nannte, ››die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern
mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, insofern diese a priori möglich sein
soll, überhauptbeschäftigt« (Kr.d.r.V. B25). Die transzendentallogische »Erörte-
rung«, also Ortsbestimmung oder Topologie, bestand in der transzendentalen
Reflexion am SchlußdeserstenTeiles der »KritikderreinenVernunft«. Einesolche
Erörterung sollte zeigen, »woraus die Möglichkeit anderer synthetischer Erkennt-
nisse a priori eingesehen werden kann« (B40). Dazu mußte unsere Erkenntnisart
von Gegenständen selbst zum Gegenstand gemacht werden, was nur dadurch ge-
lang, daß die Erörterungen bereits unter der Botmäßigkeit der Kategorie der
Zweckmäßigkeit stattfanden. Die synthetischeEinheitdertranszendentalenAppet-
zeption stand noch unter der systematischen Einheit der Vernunft, letzten Endes
der Lehre vom höchsten Gut. Die transzendentalen Beweise, auf die KANT beson-
»ders in der zweiten Auflage immer mehr rekurrierte, erwiesen sich als dialektisch,
Weil in ihnen gezeigt werden sollte, wie ihr Beweisgrund, die Erfahrung, selbst
möglich sein sollte. Der Beweis hätte die Möglichkeit der Möglichkeit der Erfah-
rung zeigen müssen. Diese zweite Möglichkeit ist die Erfahrung des Bewußtseins,
V0n der jetzt die ››Wissenschaft« gegeben wird.
HEGEL fragt nicht, wie Bewußtsein verstanden werden müsse, wenn es wissen-
Schaftlich genannt werden können soll, sondern gibt die Wissenschaft von dieser
Möglichkeit. Es ist die Wissenschaft von der Erfahrung des Bewußtseins, die nur
Einleitung 3
,_ Einleitung
auf welchen Gebieten auch immer, machen und dann in einem zweiten Reflexions-
durch das Bewußtsein selbst erstellt werden kann. Das scheint in Analogie zum
akt nach den Bedingungen ihrer Möglichkeit fragen. Daß aber die Erfahrung und
Verfahren der »Kritik der reinen Vernunft« zu stehen, das auch eine Kritik der
dieReflexion auf sie eodem actu vollziehbar ist, daß z.B. die Vergleichung zweier
Vernunftvermögen war, sofern diese in steigendem Maß unter den höchsten For-
Erkenntnisformen wirklich stattfindet, zeigt hier dieErfahrung vom ersten Augen-
derungen der Vernunft selbst erstellt wurde. Vernunft ermöglichte die Objekti-
blick an als vernünftige Erfahrung. Vernunft hat hier eine andere Bedeutung als
vierung der Erkenntnisvermögen in der transzendentalen Reflexion. Diese Objekti-
bei KANT. Das giltfür sämtliche Kategorien, die wir bei HEGEL antreffen werden.
vierung war schon metaphysisch. Die Einheit der transzendentalen Apperzeption
Er läßt das erfahrende Bewußtsein damit Ernst machen, daß wir die Totalität der
war in ihr nur noch Moment, wobei doch angenommen werden mußte, daß sie
Bedingungen, die bei KANT aufgegeben war, niemals erreichen können. Dieses
noch hinter der Reflexion stehen müßte, was doch wieder unmöglich war, weil es
Bewußtseinarbeitetnicht als KnechtunterdenTotalitätsforderungen derVernunft,
sich hier nicht mehr um die Versammlung von Anschauungsrnannigfaltigkeiten in
sondern hat diese in sich selbst als Forderungen im Bewußtsein. Auch Totalität
derSynthesis und unterdem PrinzipderEinheitdertranszendentalenApperzeption
wird bei Hi-:Gı~:L eine andereBedeutung haben als bei KANT.
handelte.
Deshalb ist, bevor wir unmittelbar in die unterste Stufe des Bewußtseins
Ich habe die Problematik des Ganzen so weit entwickelt, daß das Verfahren
einsteigen und die Reflexion ihrer Erfahrung durch sprachliche Versetzungs-
HEGELSdavon abgehoben werden kann.Dabeistellt sichheraus, daß bei ihm nicht
schritte mitvollziehen, eine Bemerkung darüber zu machen, weshalb hier Philo-
mehr von einem unmittelbaren Verfahren gesprochen werden kann. Hegel geht
sophie nicht in der Form von Grundsätzen auftritt. Während bei KANT die
insofern sprachlich vor, als er von vornherein nicht in der Subjekt-Objektrelation
Bestimmtheit der Urteile durch die Annahnıe der Totalität der Bedingungen
denkt, sondern in der Subjekt-Subjekt-Objektrelation. Wenn ich eine Wissenschaft
im regulativen Vernunftgebrauch erstellt wurde, weiß dieses Bewußtsein von
von der Erfahrung des Bewußtseins, eine Wissenschaft davon geben will, wie das
vornherein um die Unwahrheit dieses Vorgehens. Denn wenn die Totalität
Bewußtsein seine Gegenstände erfährt undwiees sich darin selbst erfährt,so kann
aufgegeben bleibt, dann bleibt auch die Bestimmtheit der Urteile Aufgabe. Sie
ichnichtmehr das transzendentallogischeVerfahren üben, in dem »Erkenntnis von
ist also prinzipiell niemals erstellbar. Die Annahme ihrer Erstellbarkeit»war die
Gegenständen« selbst zum Gegenstand gemacht Wird. Ich muß vielmehr dem
Errichtung der Welt der Positivität. Die Grenzüberschreinıng, die jetzt vorgenom-
Bewußtsein in seinen Erfahrungen zusehen. Ich muß mir von ihm auch dann noch
men wird, ist zunächst die Reflexion darauf, daß auch noch die Grundsätze er-
sagen lassen, wie es seine Erfahrungen macht, wenn diese Erfahrungen die von
schlichen waren, wenn sie doch am regulativen, von KANT allerdings innerhalb der
einem anderen Bewußtsein sein werden. Bewußtsein ist hier Denken. Es ist die
Welt der Positivität mit Recht legitim genannten Vernunftgebrauch hingen. Nicht
Exposition davon, wie Denken als die Erstellung des Unterschiedes von Denken-
die einzelnen Erkenntnisse innerhalb der Welt der Positivität waren erschlichen,
dem und Gedachtem, von Subjekt und Objekt, zugleich die Erstellung des Unter-
sondern diese als Ganze. KANT hat das gewußt. Deshalb stellte er sie unter das
schiedes von Denkinhalt undDenkgegenstand ist. Da das nach KANTnicht möglich
Pauschalurteil,daßwirinnerhalb ihrerselbstnurErscheinungenerkennen könnten.
ist, weil Selbstbewußtsein niemals Selbsterkenntnis sein kann, kann hier Denken
Das habenwir niemals bestritten. Dann abermußdieDefinition des Urteils außer-
nicht mehr der reine Verstandesbegriff oder der reine Vernunftbegriff KANTS sein.
halb der Welt der Positivität, wenn seineabsolute Gültigkeit nicht erschlichen sein
Das ganze Verhältnis von Denken und Anschauung muß eine Verkehrung er-
soll, aufgegeben werden. Wenn eingesehen ist, daß kein einziges Urteil im vollen
fahren. Das Denken der vorkantischen Metaphysik hielt sich für reines Denken,
Sinne des Wortes wahr sein kann, da seine Bestimmtheit an den nur regulativen
warabernicht rein,weiles innerhalb seinerselbstseine Geneseanden Erfahrungs-
Prinzipien der Vernunít hängt, besteht dieKritik der »Kritik der reinen Vernunft«
gegenständen hatte. H1-:GEL scheint also hinter KANT zurückzugehen.
darin, daß wir uns dazu bequemen, dem Stand unserer Unwissenheit Rechnung
Es ist zu zeigen, daß er nicht zur alten Metaphysik zurückkehrt, sondern sie
zutragen.
selbst innerhalb seiner Philosophie versammelt. Das gelingt dadurch, daß sein
Das Wissen davon, daß wir in keinem Urteil nur wissen, sondern in jedem
Denken dieKonsequenz aus derKonsequenz KANTs zieht. Dazu scheintSprachlich-
genauso nicht Wissen, ist immer von der Einsicht begleitet, daß zu jedem Urteil
keit noch nichterforderlich. Es ist daher zu zeigen, daß derWeg zurSprachlichkeit
über jeden vorkommenden Sachverhalt die Totalität aller übrigen Urteile gehörte,
des Denkens dieKonsequenz der Konsequenz KANTs ist. Wir haben von der ersten
die über diesen Sachverhalt gefällt werden müßten. Sofort bemerken wir, daß wir
Zeile des Werkes an nicht nur ein Bewußtsein, sondern deren zwei. Das eine voll-
diese Totalitätnicht haben und niemals erstellen können. In dieser Lage äußersten
ziehtseineErfahrungen, das andere schaut diesem Bewußtsein zu, indem es in sich,
kritischen Bewußtseins greift Dialektik zu einem Hilfsmittel, das nicht als Regel
nicht diegleichen,sondern diederjeweiligen StufedesBewußtseins entsprechenden
an die Hand gegeben werden kann, sondern in der jeweiligen konkreten Lage am
Erfahrungenvollzieht. DasersteBewußtseinmachtwirklicheErfahrungenundvoll-
konkreten Gegenstand gefunden werden muß. Sie bildet einen Satz, von dessen
zieht dabei zugleich immer die Reflexion auf ihre Möglichkeit. Diese Tätigkeiten
Wahrheit sie zunächst überzeugt ist, dessen prinzipiell mitlaufende Unwahrheit sie
scheinen an zwei Bewußrseinsweisen verteilt. Dann hätte das erste Bewußtsein im
Bathos seiner Erfahrungen keine Entwicklung. Es könnte immer nur Erfahrungen, aber durch die nicht mehr transzendentale, sondern dialektische Reflexion a priori
4 Einleitung
kennt. Daher wird sie als die Minimalforderung bei der Aufstellung von Sätzen,
die sie um der Unterscheidung von den Kantischen Urteilen willen nicht mehr
Urteile nennt, verlangen, daß jeder Satz sich nicht selbst widerspreche. Sie wird
zugleich verlangen, daß jedem Satz sein Gegensatz hinzugefügt werde, der sich
gleichfalls nicht widersprechen darf. Die beiden Sätze müssen einander wider-
sprechen. Der Satz ist dabei im Bild des Halbkreises vorzustellen, der ihm wider-
sprechende im Bilde des zu ihm passenden anderen Halbkreises. Beide erstellen
dieDefinition der unberührbaren Einheit derWahrheit der ››Sache«.
Hierbei kommt es darauf an, daß dieses Verfahren nicht formal ist. Es ist keine
Die zweite Revolution
Regel, unterder ich nurdie Gegensätze zu bilden habe, um wenigstens den Umriß
des Ganzen zu erhalten. DerGegensatzdes Satzes mußvielmehraus derBewegung
der Denkungsart
der Erfahrung des Bewußtseins selbst hervorgehen. Beide Sätze opponieren ein-
ander, aber sie opponieren als Gleichberecbtigte. Sie stehen nicht mehr im Herr-
schaft-Knechtschafisverhältnis, in dem bei KANT Vernunft und Verstand, Verstand
und Sinnlichkeit zueinander standen. Ferner ist - analog zu KAN1' - als systema-
tischerHintergrund~eineSittlichkeítschoninnerhalbdeserkennendenBewußtseins
vorausgesetzt, wie bei KANT die Moralität innerhalb des Geschäfts der Erkennt-
níserstellung der Welt der Positivität federführend war. Drittens kommt alles dar-
auf an, daß an dem -gegenüber KANT- gesteigerten Grad von Kritikfestgehalten
wird, derschoninderForderungbesteht,daßkeinSatzohneseinenGegensatz Gül-
tigkeithat.SoistBewußtseinniemalsnuridentischmitsich selbst,wenn es so etwas
wieeineSynthesiszustandebringen können soll.Es istgleichfalls niemals nur nicht
identisch mit sich selbst, wenn es als Bewußtsein nicht verloren gehen soll. Ist es
also die unberührbare Einheit der Wahrheit zwischen beiden Sätzen, so wird es
mit jeder Erfahrung, die es als bewegte Sichselbstgleichheit macht, eine neue Be-
stimmung erfahren, die seine eigene ist und in der Form zweier einander wider-
sprechender Sätze auftritt. In diesem Sinn ist Bewußt-Sein Gespräch. Wie das
Gewissen des Menschen das Gebirge ist, aufdem sich die einzelnen Berge erheben,
soistdasBewußt-Sein das Gespräch, auf dem sichdie einzelnen Sprachen erheben.
Eine dieser Sprachen ist die cler exakten Wissenschaften und die des technisch-
praktischen Weltumgangs. Wir werden ihr immer wieder begegnen. Aber es wird
sich die Toleranz zwischen den Bewußtseinsweisen ergeben, die aus dem Wissen
resultiert, daß keine absolut ist. Dennoch bilden sie kein Durcheinander. Sie ver-
mitteln sich zum absoluten Wissen und zur Idee. Sie hängen aber nicht an ihnen,
weil sie noch leben und daher solcher Galgen entbehren müssen. So haben auch
»absolutesWissen« und››Idee« bei Hegel nichtdieBedeutung, diesiein der abend-
ländischen Philosophie vor ihm innehatten. Wir befinden uns in einer verkehrten
Welt, in der jede Kategorie erst auf ihre Bedeutung hin zu befragen ist. ]ede Ka-
tegorie erhält die Bedeutung aus der Bewegung auf das absolute Wissen, auf die
Idee, zu. In dieser Bewegung liegt das höchste Glück des Menschen, sowohl als
Organismus als seiner unterbewußten Bewußtseins- und Sprachlage, wie in allen
seinen Bewußtseins- und Sprachlagen. Das Glück besteht darin, daß das Denken
des Menschen sichselbstaufsein Ziel zubewegtundnicht nur an ihm hängt.
I. Teil
HEGEL= Phänomenologie des Geistes
A. Bewußtsein
l. Die sinnliche Gewi/šheit;oder dasDiese und das Meinen
Die dialektische Erfahrung beruht nicht auf Antizipationen,wenngleich innerhalb
ihrer solche auftauchen. Deshalb steigen wir sofort in die unterste Stufe, um uns
vom Bewußtsein sagen zu lassen, was es erfährt. Es ist noch untersprachlich, weil
es nicht sagen kann, was ihm widerfährt. Es wird des zweiten Bewußtseins be-
dürfen, das ihm die Menschlichkeit der Anerkennung entgegenbringt, obwohl es
noch untermenschliches, d. h. untersprachliches Bewußtsein ist. Die Bedingung der
Möglichkeit der Anerkennung durch das zweiteBewußtsein stammt aus der letzten
Stufe des Bewußtseins, dem absoluten Bewußtsein. Ohne die Gegenwart der
letzten Stufe wäre der Mensch so wenig einer Bewußtseinsregung fähig wie ohne
die Gegenwart Gottes eines Atemzuges.
Dieser Satz, schon an dieser Stelle, ist heute schockierend. Ihn nicht auszuspre-
chen, wäre gleichbedeutend mit der völligen Verachtung des Lesers. Es wäre
so, als wenn man mit jemand spräche, ohne den Sinn des ganzen Satzes zu
konzipieren, sondern die Wörter auf gut Glück einzeln aus dem Munde purzeln
ließe. Da wirunsinunseremZeitalteran die Konversation in Formvon inrichtiger
Grammatik einherschreitenden Satzgewändern, unter denen nur noch Marionetten
bewegtwerden, die mit ihrenFäden an Prinzipien gebunden sind, gewöhnt haben,
erfahren wir eine Schockwirkung, wenn etwas von der Bedingung der Möglichkeit
menschlichen Sprechens und Hörens gesagt Wird. Das Erwachen aus dem Schlum-
mer in Signifikationssystemen erscheint uns als unzeitgemäß.
› Nach KANTkann es keine Phänomenologie des Bewußtseins geben. Dazu müßte
.es dem Menschen als Erkennendem möglich sein, aus der Welt der Positivität
iherauszutreten. HEGEL gibt eine Phänomenologie des Bewußtseins, wie er in der
Rechtsphilosophie die Phänornenologie der Freiheit gegeben hat.
1 Das Wissen ist »unser Gegenstand«. Das setzt nach KANT schon voraus, daß
dieser Gegenstand erschlichen ist. HEGEL wird das gar nicht bestreiten. Bei KANT
ließensichallenfallsPrinzipien, Grundsätze,Anschauungsbedingungen, Verstandes-
bedingungen und solche der Vernunft für das Wissen angeben. Aber dazu mußten
giwir doch schon wissen, was Verstand, Vernunfl und Anschauung sind. Wir haben
šgesehen, wie ihre Verhältnisse so bestimmt wurden, da/3 sie die Bedingungen der
§Möglichkeit von positivem Wissen erstellten. HEGEL dagegen nennt Wissen selbst
(feinen Gegenstand, was uns den Eingang in die »Phänomenologie des Geistes«
Üsofort versperrte, wenn wir nicht gesehen hätten, daß KANT ohne eine solche
ifisubreption auch nicht ausgekommen ist. Dieses Wissen istnicht objektiver Gegen-