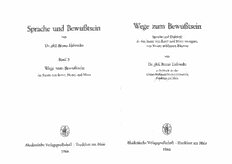Table Of ContentSSpprraacchhee uunndd BBeewwuußßttsseeiinn WWeeggee ZZuumm BBeewwuußßttsseeiinn
SSpprraacchhee uunndd DDiiaalleekkttiikk ~~
VVOOII11
iinn ddeenn iihhnneenn vvoonn KKAANNTT uunndd MMAARRXX vveerrssaaggtteenn,,
DDrr.. pphhiill.. BBrruunnoo LLiieebbrruucckkss vvoonn HHEEGGEELL eerrööffffnneetteenn RRääuummeenn
VVOOII11
BBaanndd 33
DDrr.. pphhiill.. BBrruunnoo LLiieebbrruucckkss
WWeeggee zzuumm BBeewwuußßttsseeiinn
oo.. PPrrooffeessssoorr aann ddeerr
iimm RRaauumm vvoonn KKAANNTT,, HHEEGGEELL uunndd MMAARRXX JJoohhaannnn--WWoollffggaannggffGGooeetthhee--UUnniivveerrssiittäätt
__''MM,,aaaaiinnmm
AAkkaaddeemmiisscchhee VVeerrllaa ss eesseellllsscchhaafftt -- FFrraannkkffuurrtt aamm MMaaiinn
AAkkaaddeemmiisscchhee VVeerrllaaggssggeesseellllsscchhaafftt -- FFrraannkkffuurrtt aamm MMaaiinn __ gg gg
11996666
11996666
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zu Band 3 . _ _ . . . . _ . . . _ _ . . _ . _ _ . _ _ _ . _ . _ . . _ . . . . . . _ . . . . _. IX
A. Metaphysisches Vorspiel
. I.Grundbegriffe . . . . . . _ . . . . _ _ _ . . _ _ . . _ _ _ . _ _ . . . _ . _ _ . . . _ _ __ 1
1. Wahrheit . _ _ . . . . . _ . . . . _ . . . _ . . . . _ . . . . _ . . . _ . _ . . . . _ _ . _ . _ _ _ _ 1
2. Die Grundgestalt _ _ . . . . _ . . . . . . . . . . . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . _ . _ _ . 15
3. Verschlossenheit - Offenheit . . . . . . . . . . . . _ . . . _ . . . . . . . . . . . . _. 21
4. Ansich, Fürsich, Anundfürsich _ . . . _ _ . _ _ . . . . _ _ . _ _ _ . _ . . . . _ _ . _ . 28
5. Widerspruch . _ _ _ _ _ . . . . _ . _ . _ _ . _ _ . _ . _ _ _ _ . . _ _ _ . _ . . . . . . _ _ . _ _ 37
6. Die Grunclfigur . _ _ . _ . . . . . . . _ . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . _ . _ . 66
7. Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins . . , . _ . . . . . . _ _ . _ _ _ _ 70
8. Bewußt-Sein . . _ . _ . _ . . . _ . . . . _ . _ . . . . _ . _ . _ . . . . . . . . . . _ . . _ . _ _ S1
9. Stufen cles Bewußtseins: Knechtschaft, Moralität, Liebe, Religion_ _ 97
10. Subjektivität . . . . . . _ . . . _ . . . . . . . _ . . . _ . . . . . . . . _ . . _ _ _ . . . . _ _ _ 114
II. Positivität . . . . . _ . _ _ _ . . . . . . . _ . . _ . . . . . . . _ . . . . . . .. . . _ . . _. 120
Einleitung. Philosophie, Religion, Volksreligion _ . . . . . _ _ . . _ . _ . _ . _ _ 120
1. Posicivicät und Objektivität . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . _ . _ . _ . . _ 136
2. Positivität und I-Ierrschaflzswissen . _ . . . _ . _ . _ . . . _ . . . _ _ . . _ _ . . _ _ 145
3. Positivität und Wunder . _ . . . . . . . . . . . . . . _ _ . _ . . . . . . _ _ . . . _ _ _ 148
4. Positiviräc und Geschichrlichkeic . . . . . . _ . . _ _ . _ . . . . . . . . . . . . . _. 150
5. Posiriviräc und Moralirät . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . _ _ _ . . . . . _ _ _ . ._ 152
6. Positivitär und Liebe _ _ _ . . . . _ . . _ _ _ . _ . _ . _ _ _ . _ _ . _ . _ . . . . . . . _ _ 155
7. Positivität und Religion . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . _ _ . _ . . . _. 171
a) Sein als Vereinigung _ . _ . . _ . . . _ . . _ . _ . _ . . . . . . . _ . . _ . . . . . ._ 172
b) Moralität, Liebe und Religion . . . _ . _ . . . _ . . _ . . _ . . _ _ . _ _ _ _ _ _ 180
c) Das Abendmahl und die Taufe . . . _ . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 186
Cl) SCl1luß . . _ . . . _ . . . . . . . _ . . . _ . . . . . . . . . . . _ . . . . _ . . . . . . _ . __ 192
III. Leben und Schicksal _ . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . _ _ . _ . _ . . . _ . __ 197
1. Leben . . _ . . . _ . . _ . . . _ . . . . . _ . _ . _ _ _ _ _ . . _ . . _ . _ . _ . _ _ . . . . _ . _. 197
© 1966 Akademische Verlagsgesellscl1aPc, Frankfurt am Main
_. . - ' ' ' B ch cl 2. Schicksal _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . _. 218
Ohne ausdrudslıche Genehmigung des Verlages ısı es auch mehr gestattet, dıesesı lıšäl .0 er
~ fh ch W Photokopıe, Mıkrokopıe) zu vervıe tigen a) Strafe als Gesetz _ . . . . . _ . . . _ . . . . . . . . . . . _ . . . . _ . . . . . . _ _ _. 219
TeııeI§1:ihafieıiil::iı`ifGP::ıfi)ıi:tııı;'e äciiımiıxliıerstílglišırfg: Buchdruckerei Tölle 8: Co, Dfifm°1d b) Strafe als Schicksal _ _ . _ _ . _ . _ . . _ . _ . _ . _ _ . _ . _ . . . . . . _ _ . _ . _. 221
Inhaltsverzeichnis V
VI Inhaltsverzeichnis
C. Wer lebtauf dieserErde?
B. Kritik
Recht, Moralität und Sittlichkeit bei 1-IEGEL 487
I.Der Begriff des Zwecks beiKAN'r und HEGEL _ _ _ _ _. 239
Einleitung . . _ . _ _ _ . . _ . _ . . . . . . _ . . . . . . . . _ . . . . . _ _ . . . _ _ . . _ . . _ ._ 487
1. Der Begriff des Zwecks bei KANT _ _ . _ _ . . _ . . . . . . . _ . . . _ . . . . _ _ 241 1. Redıt . _ _ . _ . _ . . . _ . _ . . . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ _ _ _ . . . _ . . _ _ _ ._ 515
2. Zweckmäßigkeit _ _ _ . . _ . . . . . . _ . . _ . _ . _ . . _ _ . . . . . . . . . . . _ _ . _ ._ 246 2. Moralität _ . _ _ . _ _ . . . . _ _ . _ _ . . _ _ . _ . . _ _ _ . . _ _ _ _ _ . _ . _ _ . _ _ _ _ _ 533
3. Naturzwecke . _ . . _ . . . . . _ _ _ . . . . . . . . _ . . . _ . . . _ . . . . _ _ _ _ _ . _ . _. 247 3. Sittlichkeit . _ . _ . _ . . . _ _ . _ . _ . _ _ . _ . _ . _ . _ _ _ . _ . . . _ _ _ _ . ._ 551
4. Absichtslose Zwecke _ _ _ _ . _ . . . _ . _ . . _ _ . _ . . _ . . . . . _ . . _ _ . . . _ . __ 270 Einleitung . . . _ _ . _ _ _ _ . . . _ . . _ . . _ . . . _ _ _ _ . . . . . _ . . _ _ _ _ _ _ 551
5. Zweck und Mittel. Enclzweck _ . . . _ _ . _ . _ . . _ . . . . . . _ . . _ _ _ . . . _. 273 ß) Familie . . _ . . . . . _ . . . . . . _ . . . _ . _ . _ . . _ . . . _ . . . . . . _ . . . . . ._ 570
6. Bestirnmende und reflektierende Urteilskrafh _ . . . . _ . . . _ . . . _ _ . _ _ 289 b) Die bürgerliche Gesellschaft _, . . . . . . . . . _ . . . . . . . _ . _ . . . _ _. 579
7. Die Prinzipienfrage . _ _ . _ . . . . . _ _ _ _ . . . _ . . . _ . . . . _ _ _ _ . . _ . . . _. 293 C) Der Staat (mit Berücksichtigung der Kritik der Staatsphilo-
sophie I-IısGELs durch KARL MARX) , _ , , , _ _ _ „ _ _ _ , _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ 605
8. Möglichkeit, Wirklichkeit, Positivität . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . _ . _. 295
9. Der Wahrheitsbegriíf in diesen Untersuchungen _ . _ . _ . _ _ . _ _ _ _. 298
. _ . _ . . _ _ _ . _ _ _ . . . . _ . . . . _ . . . . . . . _ _ _ _ . . . . _ _ . . . _ . _ _ . . . . ._ ses
10. Organismus und Sprache als Analoga . _ _ . . . . . _ _ . . . . . . . _ _ . _ __ 301 Hinweise _ _ _
11. Stellungnahme zu KANT und Übergang zu HEGEL . . _ _ . . . _ _ . _ _ _ 309 Namenregister . . _ . . . . _ _ . . _ . _ _ . . _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ers
a) Der Widerspruch innerhalb der Konzeption der reflektierenden
Urteilskraft als reflektierender und seine gegenständliche Er-
scheinung . _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ . . . . . _ . _ _ . . . . . . . . . _ _ _ _ _ . _ . _ __ 309
b) Die Unendlichkeit in der zwecktätigen HerstellungvonWerken
der Hand und Werken der Kunst . . . . _ . . _ . . . . . _ _ _ . . _ . _ . _ _ 312
c) Das zweckmäßige Geschehen der Organismen . _ _ _ . . . _ . . _ . _. 316
d) Werkzeugcharakter und Kreisprozesse in Technik, Sprache und
Wachstum . _ . . _ . . . _ . . _ _ _ _ _ . . _ . _ _ . . _ . . . . _ . . _ . . _ . . _ _ . _. 317
e) Verschiebung des Mittel-Zweckcharakters in den Erfindungs-
prozessen unserer Zeit. Darwinistische Momente innerhalb des
experimentierenden Denkens _ _ _ _ . . _ . _ . . _ _ . _ . . . . _ _ _ . . . _ _ _ 321
12. Zum Begriff des Zwecks bei HEGEL _ . . _ . . _ . . . . . . . . . . . _ _ _ . . __ 322
a) Einheit von Subjektivität und Objektivität, Realität und
Idealität im Begriff der Zweckmäßigkeit . . . . . . . _ . . . . . . _ _ ._ 322
b) Zum Zweckbegriff bei I-IEGEL . . . . _ . . _ . _ . . . . . . _ . . . . . . _ . __ 327
c) HEGELs Stellungnahme zu KANT . . . _ _ . _ _ . . . _ . . . . . _ _ . . . ._ 337
II. Sittlichkeit . _ . _ . _ _ _ . . _ . . . . _ . . _ _ _ . . . . . . . . . . _ _ . _ . _ . . . . ._ 340
1. Das Problem bei KANT . _ _ . . _ _ . _ _ . . _ . _ . . . . . . . _ . . . _ . . . . . . _. 340
a) KANTsMethodederScheidungdesEmpirischenvomRationalen 340
b) Erste Stellungnahme dazu und KANTs möglicher Einwand
gegen sie _ . . _ _ . . . . _ _ . _ . . _ . _ . . . . . _ _ . _ _ . . _ . . . _ . . _ _ . . . _ ._ 341
c) Die Kantischen Imperative und ihre Leistung . . . . _ _ . . . . . . _ _ 342
cl) KANTs Methode in der „Kritik der praktischen Vernunft“ _ _ _ _ 368
e) Schlußbetrachtung . _ _ . . . . _ _ _ _ . . . _ . . . _ . _ . _ _ . . . . . . _ . . . . __ 379
2. Das Problem beim jungen HBGEL _ _ _ _ _ _ . . . _ . . _ . . . _ _ . _ . _ . . _ _ _ 384
Vorwort zu Band 3
Mit diesem Band beginnt die Arbeit, die bisher vorgelegte Sprachbetrachtung in
die Philosophie einzuholen. Die Materialien, an denen der Gedanke seine Form
gewinnt, sind Schriflen des jungen HEGEL, zwei Kritiken KANTs sowie HEGELS
Rechtsphílosophie mit den Einwänden von KARL MARX.
In der Gestalt eines metaphysischen Vorspiels (A) werden einige in die Denk-
weise I-IEGELs einführende Grundbegriffe (I.) expliziert_ Was Positivität (II.) ist,
muß stets gegenwärtig bleiben, damit man weiß, wogegen Dialektik sich absetzt.
Die Begriffe Leben und Schicksal (III.) sind bereits so weit dialektisch, daß sie
im Gegensatz zu ihrer Bedeutung bei KANT mit der Freiheit des Menschen in Ein-
klang stehen.
Der zweite Teil (B) stellt sich der Kritik KANrs_ „Zweck“ und „Sittlichkeit“
(Moralität) bei KANT werden von den ersten Auseinandersetzungen Heoets mit
ihnen abgehoben.
Der dritte Teil (C) behandelt die Frage, ob der Hegelsche Rechtsbegriff Begriff
im Kantischen Sinn geblieben ist oder von einem „Recht“ spricht, das in allen
Situationen für alle Menschen auf dieser Erde nicht nur notwendig, sondern immer
auch wirklich ist. Unter Recht ist dabei weder Naturrecht noch positives Recht
zu verstehen, sondern das jeweilige Verhältnis beider zueinander. Der Durchgang
durch die Rechtsphilosophie zeigt sidı als Bedingung der Möglichkeit dafür, die
Hegelsche Rechts- und Staatslehre nicht nur mit KARL MARX zukritisieren,sondern
darüber hinaus einer radikaleren Kritik vom dialektischen Gedanken I-IEGELs her
zu unterwerfen. Einer solchen Kritik unterliegt auch noch die von KARL MARX.
Man wird diesen Partien in dem Maße folgen können, in dem man sich die beiden
ersten Teile des Bandes vergegenwärtigt hat. „Kritik“ ist hier nicht irn Sinn des
bekannten Scheidungsverfahrens von KAN1' zu verstehen, sondern im Sinn einer
Antwort auf die in der Enzyklopädie und Rechtsphilosophie gegebene Kritik der
Kritik. Wenn Dialektik sich als Kritik der Kritik konstituiert, indem sie die Un-
Wahrheit des Kantischen Scheidungsverfahrens aufzeigt, sofern es nicht Moment in
einem hier zunächst als größer zu bezeichnenden Ganzen bleibt, kann sie nicht
Selbst einerKritik unterliegen, die unaufhebbaresMoment innerhalb ihrer selbst ist.
Dabei wird die bisher mitgeführte Frage, ob sprachliches Denken als Bewußt-
Sein mit den Mitteln des formallogischen oderdenen der Kantischen Kritik er-
kennbar gemacht werden kann oder auch nur zu diesen Denkweisen affin ist, an
die behandelten Materien angelegt. Wege zum Bewußtsein sindWege zu den Gren-
X Vorwort zu Band 3
zen eines solchen Denkens. Ob die Einhaltung' dieser Grenzen das notwendige
Ingredicns aller Philosophie wie alles menschlichen Verhaltens auf dieser Erde
oder den Verzicht auf Philosophie und menschliches Verhalten auf dieser Erde an-
zeigt, ist eine Frage, die sich auch in diesem Band erst langsam, aber um so deut-
licher erhebt, je mehr wir uns dieser Grenze nähern. Keiner der drei Teile gibt auf
diese Frage eine bündige Antwort. Sie mögen jedoch in der vorliegenden Gestalt,
die immer noch einiger metaphysischer Antizipationen bedarf, der Förderung des
Bewußtseins davon dienen, daß Philosophie sich nicht durch Entsprachlichung,
Bewußtsein sich nicht untersprachlich konstituiert. Mehr ist noch nicht beansprucht.
Wenn der Existenzbeweis der Philosophie von AR1sTo'rELEs bis KANT am
Existenzbeweis Gottes hing, so scheint er heute am Existenzbeweis des Menschen
zu hängen. Die Frage, warum es solch eines Beweises überhaupt bedarf, deutet auf
das in Philosophie, Kunst und Religion gesichts- und sprachlos gewordene Antlitz
unserer technischen Zeit.
Die Frage, warum Sprache und Bewußtsein überhaupt etwas und nicht nichts
A. Metaphysisches Vorspiel
sind, ist auch in diesem Band als Leitfaden mitzuführen.
Dem Verlag sei auch hier gedankt. Ebenso den Herren Dr. Simon, Dr. Rader-
macher und Dr. Röttges wie Fräulein Scheer für Hilfe bei den Korrekturen und
Herstellung der Hinweise und des Namenregisters.
Frankfurt am Main, im Juli 1966
Bruno Liebruoës
I. Grundbegriffe
1. Wahrheit
Jeder Mensch, der zu einem anderen Menschen spricht, hat bewußt oder un-
bewußt vorausgesetzt und anerkannt, daß es Wahrheit gibt. Jeder Mensch, der
einen Satz schreibt, sei es auch nur in der Absicht, ihn sich selbst wieder einmal
vorzulegen, hat vorausgesetzt, daß es Wahrheit gibt. Die Bedeutung vonWahrheit
bleibt dabei so unbestimmt, daß sie nicht als Probierstein oder Werkzeug in meiner
Hand fungiert. Was die Voraussetzung von Wahrheit in einem solchen Sinn ver-
mag, zeigen die Wissenschaften, heute vornehmlich die von der Natur. In der
Philosophie stellen wir die Frage, inwiefern wir die Einheit von Geltung und
Dasein von Wahrheit auch dann vorausgesetzt haben, wenn wir sie leugnen_ Jede
Verneinung von Sinn setzt Sinn voraus.
Jede Verneinung bestimmter Wahrheit setzt Wahrheit als solche voraus. Gestal-
tungen im geschichtliclı-gesellsdıaftlichen Zusammenleben des Menschen wechseln,
verändern sich, werden wissentlich und willentlich verändert, nicht weil es über-
haupt keine Wahrheit gibt, sondern weil sie, wie man sagt, unwahr geworden
sind. In jeder Form menschlich-geschichtlichen Zusammenlebens ist daher das Ent-
haltensein der Wahrheit dieses Lebens vorausgesetzt. Nur unter der Bedingung
dieser Voraussetzung ist die Infragestellung der Wahrheit von Institutionen mög-
lich. Dieses Verhältnis ähnelt dem bei HUMBOLDT entwickelten der Einzelsprachen
zur Sprache. Wie Sprachlidıkeit nicht ungeschichtlich vorstellbar ist und doch nicht
der Irrationalität einer vermeintlichen Geschichtlichkeit des Menschen ausgeliefert
wird, so ist auch Wahrheit nidıt aus dem Spannungsverhältnis von allgemeiner
und bestimmter Wahrheit herauslösbar. Dieses Spannungsverhältnis ist im Pro-
blem der Sittlichkeit das der besonderen Maxime zum allgemeinen Gesetz, in der
Rßchtsphilosophie das des positiven Rechts zum allgemeinen.
Die Endlichkeit des menschlichen Bewußtseins besteht darin, daß es einen Wahr-
heitsbegriff bestimmen muß. Die jeweiligen Wahrheitsbegriffe erwiesen sich noch
immer, in ihrem Wahrheitsgehalt zeitlich zu sein, unwahr zu werden. Jeder
Wandel in den gesellschafilichenVerhältnissen ist von einemWandel inder Bestim-
mung von Wahrheit begleitet. Die Notwendigkeit von Veränderungen gesellschaft-
lifiher Verhältnisse setzt keine beharrende Substanz, sondern die Gegenwart
der transzendenten Wahrheit innerhalb dieser Verhältnisse voraus. Dialektik ist
darin immer zugleich übergeschichtlich-geschichtlich_ Von HEGEL pflegt man zu
Sagen, daß er die Metaphysik in die Geschichtsphilosophie verwandelt habe. Die
2 I. Grundbegriffe 1.Wahrheit 3
historischen Wissenschaften behielten die „Geschichte“ in der Hand und verloren gehaflsdenken zu Denkende, die ins Bewußtsein erhobene Meiıschwerdung des
die Metaphysik. Das ist die Situation des Historismus, der nur aus heilsamer Menschen. Sprachlichkeit ist das Zeichen auf den Menschen, wie er immer war und
Inkonscqenz lebt. Der Mensch wird als Resultante von seienden Abhängigkeiten sein wird und wie er sich immer verändert, da er weder nur Indi 'd dq
gesehen. Seine Produktionsweisen, die Weisen seines Verkehrs, die gesamte ge- Gesellschaftswesen, da er weder nur Sein noch nur bewußt, sonderhlaliulriidliiiiduliiiıii
schichtlich-gesellschaftliche Situation sollen ihn bestimmen. Innerhalb dieser Situa- Gesellschaflıswesen, als Gesellschaftswesen Individuum, als Seiendes bewußt als
tion muß die Spontaneität des einzelnen alsGesellschaftswesenihrMitbestimmungs- Bewußtheit seiend, als Übergeschichtliches geschichtlich und nur als geschichrliehes
recht behalten. MARX würde antworten: Die Verhältnisse sind so, daß der einzelne Wesen übergeschichtlich ist. Nun sind unsere gesellschaftlichen Verhältnisse heute
nur ein erträumtes Mitbestimmungsrecht hat. Aber noch das Aussprechen und das 50, daß diejenigen, die das zu reflektieren beginnen, dort Platonismus sehen müs-
praktische Sichaufbäumen gegen Verhältnisse, von denen wir annehmen, daß sen, wo nur ein Wort auf -keit erscheint.
ihre Veränderung in der Macht des Menschen läge, die also nicht als ein den Men- Da kein Mensch außerhalb des herrschenden Weltumganges seiner Gesellschaft
schen notwendig Determinierendes da sind, setzt voraus, daß wir ihre Unwahrheit 8tël'lf› ist auf diesen Rücksidit zu nehmen. Er gebietet bei jeder Annäherung an
sehen können, daß also in diesem Weltumgang Wahrheit sein könne. Wird das die Hegelsche Philosophie die Abwehr des Verdachts es ha d l 'di R `
nicht vorausgesetzt, so haben wir die absolute Praxis, die vormenschliche Ge- 8fifl2fi0I1, Erneuerung usw. HEGEL war der letzte, iier philoššpliisehugıhhíllíit
schichte des Menschen, in der nur Machtverhältnisse gegenMachtverhältnissestehen, Zur Darstellung brachte. Heute haben die Wissenschaften das für sich in Anspruch
Bewußt-Sein kein Mitspracherecht hat. âClf0âm<lf11›dWCr12 auch niclit mehr unter dem Namen der Wahrheit. Nur in
Deshalb besteht der Dienst der Philosophie an der Gesellschaft, in der wir heute rie' en an un zur.Zeit des sogenannten deutschen Idealismus brachte Philo-
leben, zunächst darin, daß sie das menschliche Denken davor bewahrt, in einem âophie es zišm Beweås ihIi;eií'El›:is:ienz. Spnst stand Philosophie immer angelehnt an
zuerst amüsanten, dann blutigen Relativismus zu versinken. Sprachlichkeit des estimmte ormen er o ıti , er Re igion, schließlich der Wissenschaften. Auch
Menschen thront nicht übergeschichtlich über den Gesellschaften. Sie und Wahrheit Zezdílllí Abâlangıcgıkelät von den gesellschafilidâín Zuständen ins Bewußtsein trat,
sind immer die Bewegung vom Allgemeinen zum Besonderen und von diesem zum a un ges ie t es in einer so unmitte aren Weise, daß man sich an die
Allgemeinen. Beide geben innerhalb der geschichtlichen Veränderungen die Bedin- i(;PS%1SCh2;šfi anlehnšwielan eineâ Felsín,Ãnstštlt ihn zu besteigen, die Verhältnisse
gungen der Möglichkeit dafür her, daß der Mensch sich verändern kann und daß ewu tseın au zune men. eute äu P iosophie den Ereignissen und den
er in diesen Veränderungen Mensch bleibt, weil er nadi beiden fragen kann. Das fišzıkfeílt l\š2=_ltul:Wıssenschaften cl;1inı?ıerher,fv\í1as fast dasselbe ist. Philosophie ver-
Menschbleibeii des Menschen, seine immer von neuem zu vollziehende Mensch- . me e is eute immer no 1 re Er a rungen im Hofe eines Grundprinzips.
werdung ist nicht das Sichdurchhalten einer übergeschichtlichen Substanz, sondern ?I::;L\;ersammlurèg unåerzdiild sieDvon den Kcdnsten und Wissenschaften. Auch
die Erhaltung seiner Offenheit als nicht festgestelltes Tier. at einen run ge an en. ieser ist ni t P ' z' , 1 'Ch H '
Selbstkritik verbietet zu sagen, daß wir alles Weltanschauliche fahrengelassen der Darstellung Verstandes- und Vernunftprinzipien iihnteiíchziílıdiıg el EGEL m
haben. Darin liegt vielmehr die Absicht der hier zu entwickelnden dialektischen So schwer es den Griechen unter den Fragen des Soitimres geworden ist, das
Weltansicht. Der Weltumgang des Menschen war stets dialektisch. Mit dem Augen- šššfakt Aligemfiifie aus den uns Langeweile bereitenden Beispielen herauszu-
blick, in dem wir das ins Bewußtsein aufnehmen, ändert sich die Szene. Vorurteile fßsez, 2:; scBwer 'es unsdheute, die -Einheit der dialektischen Gegensätze zu
sind die Urteile unserer Vorfahren, wie Werte die Erhaltungs-Steigernngsbedin- ıøägkêit 3) híwlll)fß ëcllil 2; henken, weil hier nicht Langeweile, sondern Sinn-
gungen einer reif gewordenen, sich ihrem Ende zuneigenden Zeit sind. Unsere r0 . a ie t S ' d ' ~ ~
Verhältnisse sind nicht so, daß in ihr viele Ohren auf den Sprachton Dialek- f°fmâll0gischen Denken nichineiiigelie): Ešlbleliblt bgilıdlieis dlemlii'“iin dein
die Jünglinge des Soxiınrizs bei ihren Beispielen Wir haben hetifie dibiıltstšleni'Vcilie
tik gestimmt sein könnten. Der Mensch ist immer Bewußt-Sein. Er steht mit
ü . “ _ __ _ ' ' 0 si, 3-5 IS C
einem Fuß im Einzelnen, mit dem anderen im Allgemeinen, mit dem Kopf in išgšëåíšfi IW?? UHS, Seidel: Ein hartngckcilges Zeitalter, das fur Theorie erklärt,
beiden. Deshalb müssen wir die verschiedenen Weisen des dialektischen Gedankens re ativ zur na st ö eren Stu e es dialektischen Denkens als technisch-
mk ' - ._ . . _
bei I-IEGEL als Wege zum Bewußt-Sein, der Einheit von Bewußtheit und Sein, gí8yf1flSd1esbI.Tmglehen mit der Welt enthullt. _Dialektisches Denken scheint der
verfolgen. Diese Arbeit beginnt jetzt, nachdem wir in den beiden ersten Bänden wasParS2ıEJ eit g ríchzukommlen, elišie Zeiihaus ihrem Weltumgang herauszuheben.
den Menschen auf dem Striche angesiedelt fanden, der hinter den beiden ersten S nterne men einz ` ' b' ~
Hoffnung begonnen werdeneEEE onquid otäzrie“ liebe, kann daher nur .in der
Silben des Wortes Bewußt-Sein steht. Dieser Strich ist das noch untersprach- solchem Welt h › h bGS „anch:li eit ist, daß die Zeit selbst sich aus
liche Zeichen für die geschichtlich-übergeschichtlich bewegte Ausgespanntheit des FüalektísdıenuDmšnaknšn ekraanunszu _;en ans ä' Di'e Bese'ıt^i„„une„ der Sperre vor dem
Menschen. Voraussetz d V .1 11:1: t eiâma inauguriert werden, wenn nicht die
Sprachlichkeit ist keine Hinterwelt, aus der Gesellschaft und Geschichte hervor- dier Menschuennggdears ofruGrteid âte ste t, daß di'e Ze'it selbst, sei- es i-m Bewußtsei-n
träten. Sprachlichkeit ist die Einheit von Prozeß und Produkt, das für kein Herr- au run er veranstalteten Katastrophen, mit an der Arbeit
1.Wahrheit 5
4 I. Grundbegriffe
sophie waren zwar nicht gelehrt. Sie nahmen das Fremde nicht einfach als Frem-
ist. Nur wenn die Zeit, „in Gedanken gefaßt“, über sich selbst hinausweist, ist
des. Es wurde in die eigene Philosophie hineingearbeitet, was seit dem Vorgehen
solches Unternehmen von Hoffnung begleitet. `
des Aiusroristts in der „Metaphysik“ keine Neuigkeit war. Heoizts Geschichte
Die Analogie zum sokratischen Verfahren wird hier festgehalten, wenngleich
der Philosophie umfängt die Philosophien, durchdringt sie aber nicht mehr. Er
dort der Weg vom „Konkreten“ der Vorstellung zur Abstraktion eingeschlagen
findetdas Eigene nichtmehr im Fremden, sondern im Fremden - etwaszuschnell-
wurde, während wir von den abstrakten Allgemeinbegriffen zum Konkreten wirk-
das Eigene.
licher, menschlicher Erfahrung gelangen wollen. Der Weg führt aus dem vermeint-
In SOKRATES löste sich die unendliche Subjektivität aus den partikularen Bin-
lichen Himmel der Begriffe auf die Erde, wobei der Himmel mitgenommen wird,
dungen heraus. Sie waren ihr wirklich, aber nicht mehr wahr. Die neue Stufe des
der immer nur auf dieser Erde war. Wurden dem Soıtiuiriss am Leitfaden seiner
Bewußtseins erscheint als Verderben. Die Athener vor SOKRATES waren nach
Frage einzelne Wissenschaften verdächtig, so uns die Wissenschaftlichkeit einesZeit-
HEGEL sittliche, nicht moralische Menschen. SOKRATES führt zum Allgemeinbegriff
alters, in dem sie in die Praxis übergegangen ist. Wie die Wissenschaften der Zeit
und der dazugehörigen Moralität. Im Sdiidtsal des SOKRATES wird nach HEGEL
des SOKRATES erst später ihre große Entwicklung gefunden haben, so wird es wohl
die Tragödie Athens aufgeführt. Er ist noch Heros, während erst PLATO welt-
auch mit der Wissenschaftlichkeit des Weltverhaltens unserer Zeit sein. Die Ver-
historische Persönlichkeit ist. Im metaphysischen Gewande wird HEGEL von der
mutung, daß ein solcher Weltuingang noch untersprachlich ist, zwingt uns in die
Tragödie der Sittlidikeit sprechen, wobei wir darauf vorbereitet werden, im dia-
philosophische Auseinandersetzung. Es bedarf dabei des Umweges über das Ge-
Iektischen Begriff die Aufhebung der Tragödie der Sittlichkeit zu denken. Das ist
birge HEGEL, das wir bis zu einer Paßhöhe besteigen müssen, die einen Ausblick
auf die unüberschreitbaren Höhen und die andere Seite gestattet. Was bisher an ungeheurer Vorgriff, den wir heute, in der nachmetaphysiscben Sprache unserer
Zeit, nidit eingeholt haben. „Alle Dialektik läßt das gelten, was gelten soll, als ob
nachhegelischer Philosophie ersdıienen ist, war Wiederheraufholung vorhegelischer
es gelte, läßt die innere Zerstörung selbst sich daran entwickeln, - allgemeine
Philosophie. Man hielt sich diesseits des Passes auf. Darin liegt der philosophische
Ironie der Welt“ (ebd. S. 62). Die Ironie der Welt steht sowenig außerhalb der
Anachronismus unserer Zeit.
Welt wie die Ironie des SOKRATES. Sie ist unbefangenes Aussprechen des Guten,
Dialektik und Sophistik werden seit Aiusrornıes ofl: in einem Atemzuge ge-
wogegen zu jeder Zeit die jeweiligen Gesellschaften aufgestanden sind, als wären
nannt. ANAXAGORAS und die Sophisten machten alles für fest Gehaltene flüssigf.
sie ein Mann.
Das Sophistiscbe ist immer ein Moment innerhalb des sich bildenden Begriffs.
V In allen bisherigen Gesellschaffen kam die ihnen entspredıende Sittlichkeit als
„Die Sophisten sind gerade das Gegentheil von unserer Gelehrsamkeit, welche nur
Institutionen gegenständlich auf sie zu. Das gehört zu jeder Bewußtseinsstufe. Die
auf Kenntnisse geht und aufsucht, was ist und was gewesen ist, - eine Masse
Isolation des einzelnen aus der Gesellschafl ist relativ dazu, auch wenn sich in ihm
empirischen Stofis, wo die Entdeckung einer neuen Gestalt, eines neuen Wurms
die höhere Stufe vorbereitet, Verbrechen. Soitimriss bringt zum Bewußtsein, „daß
oder sonstigen Ungeziefers und Geschmeißes für ein großes Glüds gehalten wird.
Unsere gelehrten Professoren sind insofern viel urischuldiger als die Sophisten; um Sitten, sittliche Gesetze in ihrerBestimmtheit, in ihrer Unmittelbarkeit schwankend
Sind“ (ebd. S. 79). Da immer erst das bestimmt geformte Gute, die jeweiligen
diese Unschuld giebt aber die Philosophie nichts“ (ebd. S. 5,6). Wir halten heute
eınzelgesetzlichen Gestalten Antwort auf die Frage geben, was zu tun sei, ist es
selbst die Beschäftigung mit Würmern für so unschuldig nicht. Der Satz von der
V_0nphilosophischer Relevanz, zu sehen, daß Hiacizi. die dauernde Revisionsbedürf-
Unschuld der Gelehrten aber gilt zu allen Zeiten. In ihr liegt ihre Ehre und
tigkeit aller gesellschaftlich-konkreten Bestimmungen des Guten gesehen hat.
Grenze, wenngleich heute angesichts der Ungeheuerlichkeiten unserer Zeit die Un-
GDas Verbrechen des SoKi<A'rEs bestand darin, die für überzeitlidi angesehenen
schuld etwas weit getrieben wird. Das Problem des Verhältnisses zwischen Philo-
Netze und. Institutionen als beschränkt anzusehen, ohne daß von ihm „die Be-
sophie und Gelehrsamkeit werden wir beim jungen I-IEGEL mit größerer philo-
Sdirankung in ihrer Bestimmtheit erkannt“ wurde (ebd. 5.92, dort nicht direkt
sophischer Krafl: vorgetragen finden. Die Sophisten haben Verwirrung angeriditet.
::fe_SOKRATEs bezogen, B.›L.). Das vermag der einzelne nicht. HBGEL hilfl: sich,
Sie brachten die Bildung in das Volk, was auch heute die Absicht ist. Obgleich
die Bildung die größte Widersacherin der Philosophie ist, gibt es keinePhilosophie ”Die1l1å von heute nicht mehr vollziehbareStaatsgläubigkeit ausweichend.
ohne Bildung. So waren damalige und heutige Sophistik notwendig. hat in eíítze, 1;Sittlín, die Regierung, das Regieren, das wirkliche Staatsleben
HEGEL hat in den Jugendschriften seinen eigenen Gedanken gegen die Auffas- stimmtSi I slíin prre tiv gegen das Inkonsequentf, was darin liegt, solchen be-
sehen Eli n ıa t as absolut geltend auszusprechen (ebd. S. 92,93). Wir werden
sung der Philosophie als der Geschichte von ihr gefunden. Dann hat er selbst Vor~
lesungen über die Geschichte der Philosophie gehalten. In der Spannweite dieses geheáívfuweitWiíhmitKaiâr kommen,wenneinunbestimmterInhaltalsunbedingt
Widerspruchs liegt sein Werk. Seine Vorlesungen über die Geschichte der Philo- immer Síttslgâsíro en wårug Daran bricht das Problem der Sittılichkeit auf, die
gemeinen die eit .inner a eiiler Gesellschaft ist. „Dıe 'Beschrankung des All-
1 Vgl. Hesel.: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 2. Band, Sämtliche
d.h daS›An so eintritt, zu er ennen, so .daß sie feste ist, nicht zufallig wird,
Werke, ed. I-Ii-:RMANN GLOCKNER, jubiläumsausgabe 18. Band, Frommanns-Verlag Stutt-
- gemeine in seiner Bestimmtheit zu erkennen, - ist nur möglich im
gart 1959, S. 5ff.
1.Wahrheit 7
6 I. Grundbegriffe
jedes Positive dadurch definiert ist, daß es das Gegenteil seines Gegenteils ist, so
ganzenZusammenhange einesSystems derWirklichkeit“ (ebd. 5.92). DiesesSystem,
muß das Negative dadurch definiert sein, daß es das Gegenteil seiner selbst ist.
so sagt man heute, haben wir nicht. Wir tragen es als uns selbst, als zugleich ge-
Wer das begrifien hat, hat die dialektische Stufe in der Sprachlichkeit des Men-
schlossenes (System) und offenes (bestimmte Negation dieses Systems) mit uns.
schen erreicht. Das Negative „gibt es“ nicht, wie die contradictio in adjecto zeigt.
Audi darin ist immer schon Wahrheit vorausgesetzt. Wir setzen sie als voraus-
Es gibt es in der Tat nicht, sondern im sprachlichen Weltumgang des Menschen.
gesetzt, was bisher alle Welt getan hat, wenn auch nicht mit ausdrücklichem Be-
Geist ist immer nur das, was nicht „der Fall“ ist. Bewußt-Sein ist als Einheit von
wußtsein davon.
Bewußtheit und Sein sich bewegendes Sein des Nichtseienden.
Das „Verbrechen“ des SOKRATES lagnichtdarin,neueGöttereinzuführen, wiedie
Wir haben die Sorge hinter uns gelassen, ob wir damit der heute in Europa
naiveAnklagelautete,sonderndarin, die objektiven Dämonen in die Unendlichkeit
lebenden Gesellschaft einen Dienst leisten. Die Einsicht in die Größe der Aufgabe
des eigenen Daimonions hineinzuziehen. DasEinführen neuerGötterwäre dagegen
bewahrt vor der Überschätzung unserer Kraflz. Philosophie kann niemals als
eine harmlose Angelegenheit gewesen. SOKRATES anerkenne auch nicht mehr das
zu dem bestimmten Götterglauben gehörende bestimmte Redıt. Darauf wird ihm Mittel angesehenwerden, geschichtlich-gesellschaftlicheBewegungen auf eine direkte
Weise heraufzufiihren. Darin liegt die alte Faszination, die in der Bestimmung
in seiner Gesellschafl notwendig die Antwort desTodesurteils. Erst wenn das Recht
des menschlichen Wesens als eines handelnden durch die Jahrtausende gegangen ist.
als solches nicht mehr „heilig“ ist, haben wir den Abgrund des weltgeschichtlichen
„Ein junger Fürst, und hinter ihm, neben ihm stehteinWeiserMann,einPhilosoph,
Verbrechens unserer Zeit (vgl. S. 551ff.).
der ihn unterrichtet, inspirirt; - dieß ist eine Vorstellung, die in sich hohl ist“
SoKRA'rEs soll die Unendlichkeit der Subjektivität des Menschen entdeckt haben.
(ebd. 5.174).
„Er ist der Heros, der an die Stelle des delphischen Gottes das Princip aufgestellt
KANT hatte das Prolegomenon zu einer jeden künfligen Philosophie, „die als
hat: Der Mensch wisse in sich, was das Wahre sey, er müsse in sidı schauen“
Wissenschaft wird auftreten können“, geschrieben. Ist Wissenschaft ein System ein-
(ebd. S. 107). HEGEL hat in der Reclitsphilosophie versucht, die Unendlichkeit der
deutiger Sätze, die an einsiclitigen Prinzipien hängen, so kann Dialektik nicht als
Subjektivität in die Gesellschaft zurückzuführen. Hat Philosophie hierzu dieDenk-
Wissensdıaft bezeichnet werden. Darüber sollten solche Titel, wie „Wissenschaft
mittel bereitgestellt? Was ist das für eine Revolution? Führt sie zur Sprachlichkeit
des Menschen oder führt sie aus ihr heraus? In dieser Spannweite liegen die Fragen der Logik“, nicht hinwegtäuschen. Der jungeHEGEL hat in der Difierenzschrifl: das
dieses Bandes. Bedürfnis nach der Philosophie von dem nach denWissenschaftenabgehoben.Wann
Die Gewinnung des dialektischen Denkens durch HEGEL entsprach der Revo- entsteht das Bedürfnis nach der Philosophie? Wodurch ist die Situation gekenn-
zeichnet, auf die nicht Wissenschaften, Kunst oder Technik notwendige Antworten
lution der Denkungsart durdi Soiciuirrs. Die Revolution der Denkungsart durch
KANT entsprach der des SOKRATBS nicht, da sie auf dessen Boden blieb. Erst I-Iizctt sind, sondern Philosophie? Es ist die Situation, in der Philosophie mit ihrer Ge-
begann mit derjenigen, um die die Auseinandersetzung seitdem sowohl in der Sdıichte identisch geworden ist. Die Historie erstreckt sich auf schlechterdings alles.
Der Mensch versteht sich darin als ein großes Okular, als eines seiner Werkzeuge,
Weltgeschichte wie in der Reaktion der Wissenschaften und Philosophien auf sie
ging. In beiden war die Auseinandersetzung mit HEGELs einzigem Gedanken, dem die er sich erschuf. Nur .dasjenige wird in der Aussage „zugelassen“, was in der
des Bewußt-Seins, unbewußt. eindeutiger Qbjektivität erscheint. Objektivität kommt dem zu, was die Er-
ung fur eindeutige und notwendige Urteile bietet. Nadi GÜNTHER PATziG ist
Wer heute von Wahrheit spricht, ist in der Lage eines Mannes, der auf der Erde
lebte, die eine einzige Fabrikstadt geworden wäre, in der die „Menschen“, zur „Der Satz X ist eine Tatsache. . . dann wahr, wenn es einen Satz p einer Sprache S
Bewegungslosigkeit übergegangen, sich von Maschinen am Leben erhalten ließen, gibt, derart, daß x eine Erfüllung der Wahrheitsbedingungen von p ist“2. Was
Wahrheitsbedingungen eines Satzes sind, ist vorher festgelegt, als Tatsache kann
in der die Nahrung von anderen Sternen besorgt würde, ohne daß man selbst
dannunur noch das zugelassen werden, was in einem Satze einer beliebigen Sprache
dorthin gelangen könnte. Fragte nun jemand, was Natur sei, von der in alten
„Erfullung“ eben dieser seiner Wahrheitsbedingungen ist. In der Vorsicht, keine
Büchern immer die Rede sei, so wäre die Darstellung dieses Gegenstandes so
schwierig wie die von Wahrheit und Bewußt-Sein, weil die Auskunflz, Natur sei “llbemerkten Widersprüche durdisdilüpfen zu lassen, mag man so etwas morgen
das Nichts, das bestimmte Nichts dieser einzigen Stadt, Natur in eine erträumte íllders formulieren. KANT sprach von Kategorien als den Bestimmtheitsmöglich-
Jenseitigkeit zu verschieben scheint. Ist Bewußt-Sein das bestimmte Nichts aller Såíten an Anschvauungsgegrenstanden, was gar nicht so weit davon entfernt ist.
Chen Gegenstanden bleibt der Mensch gegenüber. Er kann mit ihnen nicht
Gegenständlichkeit, so sind wir in seiner Beschreibung im entsprechenden Falle.
Seine Transzendenz schließt ein, daß in ihm Verhältnisse herrschen müssen, die im ››$YII1pathisieren“, von Identifikation zu schweigen. Der Mensch versteht sich als
Verhältnis derBewußtheit zum Sein von einer seiner ursprünglichenHerstellungen,
Vergleich zu Gegenstandsverhältnissen als verkehrte zu bezeichnen sind. Hizcizi.
hat sehr lange gebraudit, bis er den Gedanken des Negativen im zweiten Teil der
„Logik“ zu denken vermochte. Dazu war dieKritik derPositivität notwendig, die = Argumentatı-onen. Festschr.ift fu..r Joser Ko._ma ed. HARALD Drıuus und GÜNTHER
im ersten Teil dieses Bandes vorgeführt wird. Es schreibt sich leicht hin: Wenn P^TZIG› Vandenhoeck ôc Ruprecht 1964 S. 191.
3 I. Grundbegriffe 1.Wahrheit 9
dem Raume, her. Schießlidı wird Bewußtsein als Gegenstand unter Gegenständen fügbarkeiten. In solcher Abstraktion liegt virtuelles Töten, das in allem Denken
angesehen, da man sonst in Widersprüche gerät. Die Gedanken der Philosophen ist, bevor es im dialektischen Denken zumMoment herabsinkt. Wo dieHerstellung
stehen einer solchen Ansicht nach nicht in einer sidı durch die Geschidite hindurch- solcher Verfügbarkeit die geheime Triebfeder alles sich Erkenntnis nennenden Ver-
ziehenden Gegenwart ihrerVergangenheiten, sondern sindverfügbareGegenstände, fahrens ist, wird sie notwendig abgedeckt. Die Abstraktion von der Lebendigkeit
wie Steine und Hölzer, die man init Werkzeugen bearbeitet. Das geschichtliche läßt den Gegenstand als einen fremden erscheinen, vor dem jede Scheu verschwin-
Bedürfnis ist in der eindeutigen Bestimmung dessen, was gedacht worden ist, be- det. Darin wird alleWissenschaft, die Philosophie als einen historischenGegenstand
friedigt. Darin erscheint audi der gegenwärtge Gedanke als bereits derVergangen- betrachtet, eine ihrer obersten Tugenden erblicken. Töten bleibt auch hier noch
heit angehörig. Der treibende Impuls war nicht, ihn zu denken, sondern ihn als vornehm, wenn es auch „nur“ noch virtuell geschieht. Die Virulenz ist da. Da das,
einen solchen herzustellen, der in unsere Verfügbarkeit gelangt, wie man bei dem was in den folgenden Sätzen, den ersten der Schrift über die „Differenz des
Aufsatz von PATZIG gut sehen kann. Sätze der Philosophie werden vor der Wirk- Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie. . .“ steht, heute längst in
lichkeit als Fallen aufgestellt, in denen sich das Wild verfängt. Es handelt sich um die Praxis des Weltumgangs des Menschen hinein verschwunden ist, fallen sie uns
eine Jagdkunst.WirsindimmernochbeimvielleichtältestenWerkzeugdesMenschen. nidit auf. Man liest sie allenfalls als eine Erklärung für das, was SCHOPENHAUER
Der Mensch in der historisierenden Stufe seines Bewußtseins ist dadurch charak- das „metaphysische Bedürfnis“ des Menschen genannt hat, das heute nur noch
terisiert, daß er eine Menge solcher Verfügbarkeiten um sich herumstellt. Der psychologisch oder soziologisch erklärbar scheint. Schon in derVorerinnerung hatte
treibende Impuls in der Herstellung von Gegenständlichkeit innerhalb der Er- HEGEL gefragt, wann ein philosophisches System Glück mache. „Wenn man von
kenntnis ist der gleiche wie der in der Herstellung von Werkzeugen, wie den eben einem System sagen kann, daß es Glückgemacht habe, so hat sich ein allgemeineres
angeführten Fallen. Die Konzeption der Wirklichkeit als Inbegriff soldier Gegen- Bedürfnis der Philosophie, das sich für sich selbst nicht zur Philosophie zu ge-
stände ist die Konzeption aller Wirklichkeit vor Rohren, die zu ihrer Vernichtung bären vermag _ denn damit hätte es sich durch das Schaffen eines Systems befrie-
aufgestellt sind. Nur noch durch die an ihnen angebraditen Visiere wird sie er- digt -, mit einer instinktartigen I-Iinneigung zu demselben gewenclet, und der
blickt. Wirklich ist das, was im Schußfeld liegt. Auf Grund derselben Wissensdiaft Sdiein der passiven Aufnahme rührt daher, daß im Innern das vorhanden ist,
hat die Technik heute diesen Wirklichkeitsaspekt so weit realisiert, daß die Mög- was das System ausspricht.. .“” Das ist sprachlich gedacht. Nidiı: passives Auf-
lidikeit der Vernichtung des Menschen gegeben ist. Aufwachen ist bei Todesstrafe nehmen allein bewirkt die Aufnahme einer neuen Philosophie. Vielmehr muß es
verboten, nämlich, wie man sich ausdrückt, bei Strafe des Widerspruchs. Ein Be- insofern „an der Zeit“ sein, als Sehnsucht und Verlangen einer Gesellschaft ihm
wußtsein, das im 19. Jahrhundert diesen Nihilismus sowohl der historischen wie entgegenkommen. Der Leser muß beim Aufnehmen die Begriffein sich „erwecken“,
der Naturwissenschaften erkannte, Fiıiiaoiucri Nii=.'rzsci¬iis, ging ins Irrenhaus. wie HUMBOLDT sagte. In diesem Sinne muß der Möglichkeit nach in ihm das vor-
HEGEL weiß mehr. Ein Bewußtsein, das eine Menge von Verfügbarkeiten um handen sein, was ihm entgegenkommt. Das gilt für jede Zeit. Die ersten Sätze,
sich herumgestellt hat, gibt sich damit den Schein, das zu sein, was es um sich die von der „geschichtlichen Ansicht philosophisdier Systeme“ handeln, nennen
herumgestellt hat, eine Totalität. Diese Bewußtseinsstufe ist dadurch charakteri- 'dagegen die Philosophieverlassenheit einer Zeit mit Worten, die heute noch ge-
siert, daß sie die Frage nach der Wahrheit aufgegeben hat. Sie weiß sich im fflignet sind, den Zustand zu beschreiben, in dem wir uns heute - sowohl psycho-
historisdien Verfolgen von Problemen gebildet. Dieser Zustand wird in der logisch wie soziologisdi - befinden. Metaphysikverlassenheit ist heute nicht ein
„Phänomenologie des Geistes“ als der derBildung erscheinen. Hierwird er alsVer- Zustand edler oder unedler Seelen, sondern steht als Welt der von ihr her-
knöcherung beschrieben, was terminologisch zu lesen ist. Dazu gehört die Ver- gestellten Gegenstände um uns herum. Sie ist im harten, unmittelbar populären
wesung, die scharfe Trennung von Ereignissen und ihrem sogenannten Wesen. Sinne objektiv geworden. Die Sätze lauten: „Ein Zeitalter, das einc solche Menge
Kommt es nur auf das Wesen an, so ist das Ereignis darin verschwunden. Von ihm Plıilosophischer Systeme als eine Vergangenheit hinter sich liegen hat, scheint zu
wird nur noch hergestellt, was an ihm wesentlich sein soll, es wird verwest. Die derjenigen Indifferenz kommen zu müssen, welche das Leben erlangt, nachdem es
populäre Bedeutung des Ausdrucks Verwesung ist dabei mitzuführen. Heute gibt Slßh in allen Formen versucht hat. Der Trieb zur Totalität äußert sidi noch als
es bereits „Waffen“, die den Menschen bei lebendigem Leibe in Verwesung über- Trieb zur Vollständigkeit .der Kenntnisse, wenn die verknöcherte Individualität
führen, während die hergestellten Gegenständlichkeitcn, die Fabriken usw., un- S1Ch nicht mehr selbst ins Leben wagt; sie sucht sich durch die Mannigfaltigkeit
beschädigt bleibenf* Unter Verknöcherung sei hier die Abstraktion von der in Clesseti, was sie hat, den Schein desjenigen zu verschaffen, was sie nicht ist. Indem
den Gegenständen der menschlichen Erfahrung entgegenkommenden Lebendigkeit Sle die Wissenschaft in eine Kenntnis umwandelt, hat sie den lebendigen Anteil,
verstanden. Solche Abstraktion ist erste Bedingung zur Herstellung von Ver- den die Wissenschaft fordert, ihr versagt, sie in der Ferne und in rein objektiver
* Vgl. die Nachricht über die sogenannte „Neutronenbombe“ in der „Frankfurter Rund- F 3_G. HEGEL: Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie.
schau“ vom 11.4. 1963. Seitdem war davon wenig zu hören. elix Meiner, Hamburg 1962, S.6.