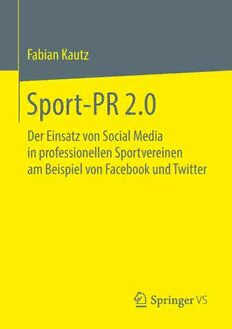Table Of ContentFabian Kautz
Sport-PR 2.0
Der Einsatz von Social Media
in professionellen Sportvereinen
am Beispiel von Facebook und Twitter
Sport-PR 2.0
Fabian Kautz
Sport-PR 2.0
Der Einsatz von Social Media
in professionellen Sportvereinen
am Beispiel von Facebook und Twitter
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Michael Schaffrath
Fabian Kautz
München, Deutschland
Vollständiger Abdruck der von der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften
der Technischen Universität München zur Erlangung des akademischen Grades eines
Doktors der Philosophie genehmigten Dissertation.
Titel: Sport-PR 2.0. Eine empirische Untersuchung zum Einsatz von Social Media-
Angeboten in der Sport-PR professioneller Sportvereine am Beispiel von Facebook
und Twitter.
Erstprüfer: Prof. Dr. Michael Schaffrath.
Zweitprüfer: Prof. Dr. Filip Mess.
Vorsitzender: Prof. Dr. Jörg Königstorfer.
OnlinePlus Material zu diesem Buch finden Sie auf
http://www.springer.com/978-3-658-22249-9
ISBN 978-3-658-22248-2 ISBN 978-3-658-22249-9 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-22249-9
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Für meine Schwester Isabelle
Danksagung
Mein Dank gilt zuvorderst meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Michael
Schaffrath. Ich möchte mich bedanken für die akademische Beratung, für
die Steuerung und Zielführung, mit der er dieses Projekt in jeder Phase
stets engagiert begleitet und unterstützt hat. Weiterhin gilt mein Dank mei-
nem Zweitprüfer, Herrn Prof. Dr. Filip Mess, sowie dem Vorsitzenden der
Prüfungskommission, Herrn Prof. Dr. Jörg Königstorfer.
Meinen Eltern Dagmar und Gerhard danke ich für die enorme Unterstüt-
zung sowie die Bewirtung und Rücksichtnahme in der intensiven End-
phase des Projekts. Für die wertvollen Ermutigungen und Ermunterungen
danke ich meiner Schwester Isabelle. Herzlichen Dank an meine Familie
für die ungezählten Stunden des Korrekturlesens und die Akribie bei dieser
Aufgabe. Ihr seid der sichere Fels, auf dem ich stehe und an den ich mich
anlehne, wenn ich neuen Herausforderungen begegne. Gleichenteils be-
danke ich mich bei meinem Freund Nikolaus Hämmerle für die Zeit, die er
für das Korrekturlesen meiner Doktorarbeit uneigennützig investiert hat.
Ein wichtiger Vorteil der Einbindung in akademische Strukturen ist die
Möglichkeit des Austausches. Und so danke ich ganz besonders Sabrina
Lucke für die wertvollen Anregungen und Diskussionen und Sebastian
Wenninger für Informatiker-Fachwissen zur rechten Zeit.
Abschließend ein großes Dankeschön an meine Freunde, die mich auf ver-
schiedene Art und Weise in dieser Zeit unterstützt haben.
München, im März 2018,
Fabian Kautz
Geleitwort
Fluch oder Segen? Evolution oder Revolution? Chance oder Risiko?
In solch plakativ-bipolaren Überschriften artikuliert sich die öffentliche und
manchmal auch akademische Unsicherheit im Umgang mit den so ge-
nannten Sozialen Medien, die auch zu „asozialen“ Medien mutieren kön-
nen, wie vor allem Shitstorm-Geschädigte bestätigen und beklagen.
Klar ist: Facebook, Twitter und Co. haben das Kommunikationsverhalten
massiv verändert – national wie international. Die klassischen Sender-
Empfänger-Modelle müssen ersetzt werden von Sender-Sender-Konzep-
ten. Und das gute alte Watzlawick Motto „Man kann nicht nicht kommuni-
zieren“ bekommt noch tiefere Dimension und ungeahnte Aktualität. Denn
kaum einer kann sich der Permanenz-Kommunikation heutzutage noch
entziehen.
Es wird gepostet, geshared, geliked und verlinkt, was die Smartphones
hergeben. Manchmal sind die Kommunikate gut und wichtig, oftmals aber
auch unbedeutend und belanglos.
Für den Spitzensport eröffnet Web 2.0 innovative Kommunikationsmög-
lichkeiten, Vermarktungsoptionen und Public-Relations-Varianten – inklu-
sive gleichzeitiger Autonomie vom traditionellen Journalismus und zuneh-
mender Unabhängigkeit von klassischen Medien. Doch wie effizient und
effektiv läuft das in der Sport-Praxis tatsächlich ab?
Zurecht ging Fabian Kautz im Rahmen seines Promotionsprojekts der kon-
kreten Frage nach: „Wie setzen Profi-Sportvereine in Deutschland Soziale
Medien im Rahmen ihrer Sport-PR ein?
Das von ihm konzipierte und durchgeführte Forschungsprojekt ist dreifach
einmalig: erstens in der Breite – bezogen auf die Anzahl und Varianz an
vier Ligen (Fußball, Handball, Basketball, Eishockey) und 16 Vereinen
(vom FC Bayern München bis zu den Schwenninger Wild Wings); zweitens
1X0 GGeeleleititwwoorrtt
in der Tiefe – bezogen auf die Vielzahl an formalen und inhaltlichen Kate-
gorien und drittens vom Innovationspotential – bezogen auf die erstmalige
Erhebung der Relevanz ausgewählter Nachrichtenfaktoren in der Social-
Media-Sport-PR.
Die Studie von Fabian Kautz wurde als Dissertationsschrift von der Fakul-
tät für Sport- und Gesundheitswissenschaften der Technischen Universität
München angenommen und anerkannt.
Wer sich künftig zu Social Media im Sport äußern möchte, egal ob Wis-
senschaftler, PR-Praktiker oder Journalist, wird das Buch von Fabian
Kautz lesen und zitieren müssen!
München, den 10.03.2018 Prof. Dr. Michael Schaffrath
Leiter des Arbeitsbereichs für
Medien und Kommunikation
Fakultät für Sport- und
Gesundheitswissenschaften sowie
Erstgutachter der Dissertation
Inhaltsverzeichnis
Danksagung ............................................................................................ VII
Geleitwort ................................................................................................. IX
Inhaltsverzeichnis ..................................................................................... XI
Abbildungsverzeichnis ........................................................................... XXI
Tabellenverzeichnis ............................................................................ XXVII
1 Einleitung ................................................................................... 1
1.1 Forschungsstand Social Media ................................................ 3
1.1.1 Forschung zu Social Media und Sport .............................. 5
1.1.2 Kurzcharakterisierung ausgewählter Studien .................... 7
1.1.3 Forschungsstand in Deutschland .................................... 11
1.2 Fazit Forschungsstand ........................................................... 17
1.3 Ziele der Arbeit und Beitrag zur wissenschaftlichen
Forschung .............................................................................. 20
1.4 Aufbau der Arbeit ................................................................... 21
2 Social Media ............................................................................. 23
2.1 Entstehung ............................................................................. 23
2.2 Begriffsbestimmung und -abgrenzung ................................... 27
2.3 Arten von Social Media .......................................................... 29
2.4 Charakteristika von Social Media ........................................... 33
2.4.1 User Generated Content ................................................. 33
2.4.2 Selbstorganisation ........................................................... 35
2.4.3 Deinstitutionalisierung, Deprofessionalisierung .............. 35
2.4.4 Destabilisierung von Texten ............................................ 35
2.4.5 Content-Zugang ............................................................... 36
1X2I I Inhaltsverzeichnis
2.4.6 Vernetzung ...................................................................... 36
2.4.7 Nutzerfokus und Personalisierung .................................. 36
2.4.8 Transparenz .................................................................... 37
2.4.9 Interaktion/Konversation/Rückkopplung .......................... 37
2.4.10 Persistenz und Kontrollverlust ......................................... 38
2.4.11 Modularität ....................................................................... 38
2.4.12 Variabilität ........................................................................ 39
2.4.13 Automatisierung ............................................................... 39
2.5 Online-Kommunikation ........................................................... 39
2.6 Zusammenfassung................................................................. 44
3 Twitter ...................................................................................... 47
3.1 Entstehung ............................................................................. 47
3.2 Geschäftsmodell .................................................................... 50
3.3 Funktion und Kommunikationsangebote ............................... 51
3.3.1 Das Twitter-Profil ............................................................. 52
3.3.2 Tweet ............................................................................... 56
3.3.3 Like .................................................................................. 57
3.3.4 Retweet (Teilen) .............................................................. 57
3.3.5 Erwähnung (@Mention)................................................... 58
3.3.6 Antwort (@Reply) ............................................................ 58
3.3.7 Weitere Kommunikationsformen ..................................... 60
3.3.8 Hashtags # ...................................................................... 60
3.3.9 Newsfeed-Algorithmus .................................................... 62
3.4 Kommunikationsstruktur ........................................................ 64
3.5 Nutzung .................................................................................. 68
3.6 Nutzungsmotive ..................................................................... 70