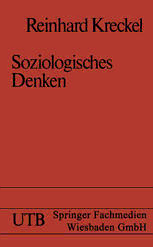Table Of ContentU ni-Taschenbiicher
UTB
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Birkhiiuser Verlag Basel und Stuttgart
Wilhelm Fink Verlag MUnchen
Gustav Fischer Verlag Stuttgart
Francke Verlag MUnchen
Paul Haupt Verlag Bern und Stuttgart
Dr. Alfred HUthig Verlag Heidelberg
Leske Verlag + Budrich GmbH Opladen
1. C. B. Mohr (Paul Siebeck) TUbingen
C. F. MUlier luristischer Verlag - R. v. Decker's Verlag Heidelberg
Quelle & Meyer Heidelberg
Ernst Reinhardt Verlag MUnchen und Basel
F. K. Schattauer Verlag Stuttgart-New York
Ferdinand Schoningh Verlag Paderbom
Dr. Dietrich SteinkoptTVerlag Darmstadt
Eugen Ulmer Verlag Stuttgart
Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen und ZUrich
Verlag Dokumentation MUnchen
Reinhard Kreckel
Soziologisches Denken
Reinhard Kreckel
Soziologisches Denken
Eine kritische Einfiihrung
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
IC1eckeJ, Reinhard
Soziologisches Denken : e. krit Emf. -2.AufI.
Springer Fachmedien Wiesbaden
(Uni-Taschenbiicher ; 574)
ISBN 978-3-322-95514-2 ISBN 978-3-322-95513-5 (cBook)
DOI 10.1007/978-3-322-95513-5
Reinhard Kreckel, Soziologisches Denken
Eine kritische Einfiihrung
2. Auflage April 1976. 224 Seiten
ISBN 978-3-322-95514-2
© 1975 by Springer Fachmedien Wiesbaden
UrsprOnglich erschienen bei Leske Verlag + Buderich GmbH, Opladen 1975
Inhalt
Vorbemerkung. . . . . . . . . . . . . . . 7
Erster Teil: Zur Standortbestimmung der Soziologie
Kapitel I: Der allgemeine Problemhorizont der Soziologie . . . 13
I. Das Erkenntnisinteresse der Naturwissenschaften:
Naturbeherrschung . . . . . . . . . . . . 14
2. Die Doppelfunktion aller Kultur: Entlastung und Zwang. IS
3. Die historische Hypothek: Kultur als Ausdruck
gesellschaftlicher Ungleichheit. . . . . . . . . .. 18
4. Das Erkenntnisinteresse der Humanwissenschaften: Zwischen
Anpassung und Emanzipation. . . . . . . . . . .. 21
5. Das wissenschaftliche Ziel der Soziologie: Aufdeckung von
Bedingungen fUr Stabilitiit und Wandel sozio-kultureller
Wirklichkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kapitel II: Eine gesellschaftstheoretische Orientierung fliT die
Soziologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
I. Zur Verkniipfung von empirischer Forschung und Theorie:
Das Konzept des soziologischen Strukturmodells . . .. 33
2. Ein Bindeglied zwischen Theorie und Praxis: Das Konzept der
gesellschaftstheoretischen Orientierung . . . . . . .. 37
3. Geschichtlichkeit oder Universalitat: Das Problem des raum-
zeitlichen Geltungsbereiches . . . . . . . . . . .. 43
4. Die gesellschaftstheoretische Orientierung: Gesellschaft als
sozio-kulturelle Ungleichheitsordnung. . . . . . .. 47
Zweiter Teil: Elemente einer empirisch-kritischen Soziologie
Kapitel III: Der "Positivismusstreit" ais wissenschafts-
theoretischer Hintergrund . . . . . . . . . . . . . . 63
5
1. Gemeinsame Ausgangslage . . 66
2. Kritischer Rationalismus. . . 69
3. Dialektisch-kritische Soziologie 84
4. Konsequenzen. . . . . . . .106
Kapitel IV: Soziologische Grundbegriffe . .117
1. Begriffliche Ausgangspunkte soziologischen Denkens: Kultur
und soziales Handeln . 117
2. Klassische Beitriige . 130
a) Max Weber . . . 131
b) Emile Durkheim . 140
c) Talcott Parsons .149
3. Ein begriffliches Bindeglied zwischen Kultur und sozialem
Handeln: Das Rollenkonzept . . . . . . . . . .. . 162
4. Begriffliche Grundlegung fUr eine gesellschaftstheoretisch
orientierte Strukturanalyse . 181
Literaturverzeichnis . .215
Register . . . . . .220
6
Vorbemerkung
Auf dem westdeutschen Buchmarkt ist eine betrachtliche Anzahi all
gemeinverstandiicher Textbiicher zur Einfiihrung in die Sozioiogie
erhaltlich. Eine Einflihrung, die der sogenannten "kritischen Gesell
schaftstheorie" oder "Frankfurter Schuie" groj),eres Gewicht be i
mij),t, liegt jedoch nicht vor. Dies mag erstauniich anmuten - zumai,
wenn man bedenkt, daJl, die kritische Gesellschaftstheorie von vieien
international en Betrachtern ais der weitaus bemerkenswerteste west
deutsche Beitrag zur Entwickiung sozioiogischen Denkens in den
ietzten lahrzehnten angesehen wird. Wer allerdings genauer mit der
Argumentationsweise der kritischen Gesellschaftstheorie vertraut ist,
muj), erkennen, daj), sie sich in systematischer Weise gegen Verein
fachung und Allgemeinverstandiichkeit sperrt. Denn es ist ein Haupt
merkmal kritischer Gesellschaftstheorie, daj), sie nur in Auseinander
setzung mit den jeweiis fortgeschrittensten "konventionellen" Theo
rien und Methoden entfaltet werden kann. Die Foige ist, daj), die
Bedeutung der kritischen Gesellschaftstheorie flir die Sozioiogie
bestenfalls von Eingeweihten zur Kenntnis genommen werden kann,
wahrend flir den Laien nur sozioiogische Hausmannskost iibrigbieibt.
Gegen diese Sachiage wendet sich die vorliegende Schrift. Ihr Verfas
ser ist in seinem Denken zwar nachhaltig von der kritischen Gesell
schaftstheorie beeinfluj),t; er steht ihr aber in vieier Hinsicht kritisch
gegeniiber, was vor allem in Teil II deutlich werden wird. Er ist der
Auffassung, daJl, die Gegensatze zwischen "traditionellen" und "kri
tischen" Stromungen im sozioiogischen Denken nicht vollkommen
uniiberbriickbar sind; und er ist der Hoffnung, daj), sich dies durchaus
auch auf verstandiiche, wenngieich nicht immer ganz einfache Weise
darstellen Jaj),t.
Aus dem bisher Gesagten geht eines kiar hervor: "Die" Sozioiogie ais
ein festumrissenes Geflige von allgemein anerkannten wissenschaft
lichen Ergebnissen und Methoden gibt es nicht. Es gibt zwar den
Beruf des "Sozioiogen"; es gibt auch eine allen Sozioiogen gemein
same Fachtradition und einen bestimmten Fundus von Forschungs
themen, Grundbegriffen, Hypothesen und Forschungstechniken, mit
7
denen sich Anhlinger der unterschiedlichsten soziologischen Lehrmei
nungen gleichenn~en auseinandersetzen. Aber eine gemeinsame
theoretische Perspektive ist nirgends zu sehen. Soziologie kann des
haIb nicht einfach "beschrieben" werden. Jeder Versuch einer sol
chen Beschreibung mOOte unweigerlich auf die DarsteUung einer
bestimmten Soziologie hinauslaufen, die dann womoglich aIs "die"
Soziologie ausgegeben wiirde.
Immerhin ware aber eine Vorgehensweise denkbar, die lediglich
darauf abzielte, die wichtigsten Erscheinungsfonnen von Soziologie,
wie sie heute im akademischen Bereich und in der Forschungspraxis
vorzufinden sind, nebeneinander zu steUen und nachzuzeichnen. Bei
naherer Oberlegung erweist sich ein derartiges Verfahren aber aIs
unzweckma~ig. Ein "objektives Abbild" der verschiedenen Erschei
nungsformen von Soziologie, das dem Leser als neutraleEntschei
dungsgrundlage flir seine eigene Meinungsbildung dienen konnte, ist
auch auf diesem Wege nicht zu verwirklichen. In der Auswahl und
Darbietung des Stoffes mUssen sich in jedem Faile die theoretischen
Praferenzen des Verfassers widerspiegeln.
Nun kann es aber nicht die Aufgabe dieser einflihrenden Schrift sein,
lediglich mit einer bestimmten Lehrmeinung Uber andere Lehr
meinungen vertraut zu machen. Dem Leser, der sich einer kaum Uber
schaubaren Vielfalt von soziologischen Einzelerkenntnissen und Kon
troversen gegenUber sieht, soU vielmehr als erstes ein strukturierender
.. Durchblick" geboten werden, der ihm ein zusammenhlingendes
gedankliches Instrumentarium zur wissenschaftlich-kritischen Erfas
sung und Interpretation sozio-kultureller Wirklichkeit vermittelt. Die
begrifflichen Grundlagen soziologischen Denkens sowie deren wis
senschafts- und gesellschaftstheoretische Zusammenhlinge sind des
halb das Thema der vorliegenden Schrift. Soziologische Theorien im
engeren Sinne, empirische Befunde und Forschungstechniken werden
hingegen nicht systematisch dargestellt und diskutiert werden. Denn
es geht darum, dem Leser zunachst ein allgemeines gedankliches
Grundgeriist zu vermitteln, auf dem er dann - kritisch und selbstkri
tisch - sein weiteres soziologisches Denken und Arbeiten aufbauen
kann.
Wer die Absicht hat, einen klarenden Durchblick durch das Unter
holz soziologischer Hypothesen, Lehnneinungen und Kontroversen
zu gewinnen, mu~ - wie gesagt - einen eindeutigen Standort ein
nehmen, und zwar einen Standort, der eine moglichst gUnstige Per
spektive hierflir bietet: Der wissenschaftliche Standort, von dem aus
die vorliegende Schrift konzipiert ist, beruht auf der Idee, da~ es
sowohl erfahrungswissenschaftlich wie gesellschaftspolitisch frucht-
8
bar sei, hochindustrialisierte Gesellschaften kapitalistischen und so
zialistischen Typs als sozio-kulturelle Ungleichheitsordnungen aufzu
fassen. Die Brauchbarkeit dieser Perspektive kann sich nur in der
Anwendung erweisen. Sie soll dem Leser jedoch keineswegs still
schweigend aufgedrangt werden, und sie darf ihn auch nieht korsett
artig einengen. Sie wird in Teil I schrittweise eingefiihrt und begrUn
det werden. In Teil II soll dann auf dieser Ausgangsbasis eine detail
liertere Einflihrung in Grundfragen soziologischen Denkens gegeben
werden.
Diese Vorgehensweise birgt eine gewisse Schwierigkeit in sieh: In
Teil I wird ein allgemeiner gesellschaftstheoretischer Rahmen als
generelle "Perspektive" vorgestellt, bevor der Leser mit dem hierfiir
eigentlich erforderlichen fachwissenschaftlichen Instrumentarium
bekannt gemacht werden kann. (Umgekehrt ware es freilich ebenso
schwierig, zuerst mit dem speziellen Teil der Argumentation zu be
ginnen und dabei stets implizit auf den allgemeinen Teil vorgreifen zu
mUssen.) Das Dilemma wird angegangen, indem in Teil I versucht
wird, den gesellschaftstheoretischen Rahmen auf dem - relativ -
festen Boden der Alltagssprache zu erriehten und plausibel zu ma
chen. Es kann dabei von einer "gehobenen Alltagssprache" ausgegan
gen werden, denn es wird unterstellt, da~ die hauptsachliche Ziel
gruppe dieser Schrift - Studenten, Lehrer, the ore tisch und politisch
Interessierte - bereits mit einer intellektualisierten Sprache, jedoch
nicht mit speziell soziologischer Terminologie vertraut ist.
Der Teil II ist im Vergleich dazu in Sprache, Argumentationsweise
und au~erer Form sHirker fachwissenschaftlich gehalten, und er ist
mit Literaturhinweisen und ausfiihrlichen Anmerkungen versehen.
Denn der Leser solI in die Lage versetzt werden, jetzt - nachdem er
in Teil I auf die allgemeine Thematik "eingestimmt" worden ist -
den Vorgang der Entfaltung einer wissenschaftstheoretischen Argu
mentation sowie die sich daran anschlie~ende Entwicklung von sozio
logischen Grundbegriffen m6glichs"t genau mitzuvollziehen und,
unter RUckgriff auf die angegebene Literatur, se1bstandig weiterzu
denken. Indem der Verfasser sich bemiiht, seine wissenschaftstheore
tischen, gesellschaftstheoretischen und begriffiichen Pramissen und
Entscheidungen Schritt fUr Schritt offenzulegen und zu begrUnden,
bietet er dem Leser die M6glichkeit, sieh mit seiner Auffassung kri
tisch auseinanderzusetzen und einen eigenen Standpunkt zu erarbei
ten.
Der vorliegende Text kann und will kein Handbuch oder Nachschla
gewerk sein, sondern eine kritische EinfLihrung in ein kontroverses
intellektuelles Terrain. Sein Inhalt ist kein "Lemstoff', der sich
9
passiv rezipieren und abfragen la~t - er mu~ aktiv durchdacht werden.
Deshalb stellt dieses Buch einen Anspruch an seinen Leser: Es will im
Zusammenhang gelesen und kritisch diskutiert werden.
10