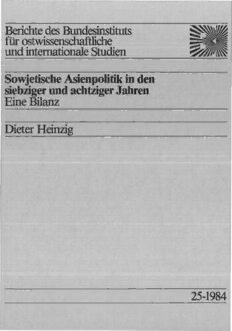Table Of ContentBerichte des Bundesinstituts S ^ lP
für ostwissenschaftliche "^~"^
und internationale Studien
Sowjetische Asienpolitik in den
siebziger und achtziger Jahren
Eine Bilanz
Dieter Heinzig
25-1984
Die Meinungen, die in den vom BUNDESINSTITUT FUR
OSTWISSENSCHAFTLICHE UND INTERNATIONALE STUDIEN
herausgegebenen Veröffentlichungen geäußert werden, geben
ausschließlich die Auffassung des Autoren wieder.
© 1984 by Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und
internationale Studien, Köln.
Abdruck und sonstige publizistische Nutzung - auch auszugsweise -
nur mit vorheriger Zustimmung des Bundesinsitut sowie mit Angabe
des Verfassers und der Quelle gestattet.
Bundesinstitut
für ostwissenschaftliche und internationale Studien,
Lindenbornstraße 22, D-5000 Köln 30, Telefon 02 21/522001
INHALT
Seite
Kurzfassung 1
"Sozialistische Staaten" in Asien
als Trittsteine des sowjetischen
Expansionismus 3
Vorsichtige Entspannung im Konflikt
mit China 4
Glücklose Japan-Politik 7
Erfolge in Südostasien: Die Etablierung
der Achse Moskau-Hanoi 9
Zwiespältige Ergebnisse des afghanischen
Abenteuers 11
Konsolidierung gegenüber Indien, Ter
rainverluste in Südwestasien 14
Bilanz 16
Summary 17
Juli 1984
Dieter Heinzig
Sowjetische Asienpolitik in den siebziger und achtziger Jahren
Bericht des BlOst Nr. 25/1984
Kurzfassung
Im sicherheits- und interessenpolitischen Kalkül der Kremlführer
rangiert, regional gesehen, Asien nach Europa an zweiter Stelle.
Hauptziel sowjetischer Außenpolitik ist die Garantie der territo
rialen Integrität der UdSSR und des Fortbestands ihres Gesell
schaftssystems. Mit Blick auf Asien folgt - entsprechend der Tra
dition der zaristischen Asienpolitik - sodann in Moskaus Prioritä
tenkatalog das Bemühen um Expansion, d.h. um Ausdehnung des Ein
flusses bis hin zur Kontrolle. Für das operationale Verhalten der
Sowjetunion ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, allen Bestre
bungen entgegenzuwirken, die die Verfolgung dieses Zieles zu be
hindern oder zu vereiteln geeignet sind. Seit Anfang der siebziger
Jahre, als sich die UdSSR angesichts der erfolgreichen chinesi
schen Politik der Öffnung gegenüber den Vereinigten Staaten und
deren Bündnispartnern mit einer neuen Herausforderung konfrontiert
sah, bedeutete dies vor allem, die Volksrepublik China einzudämmen
und/oder mit ihr zu einem modus vivendi zu gelangen, den Einfluß
der Vereinigten Staaten in Asien zurückzudrängen und ein enges
politisch-militärisches Zusammenwirken zwischen den USA, China und
Japan zu verhindern.
In dem vorliegenden Bericht wird der Versuch unternommen zu bilan
zieren, zu welchen Ergebnissen die entsprechenden sowjetischen
Bemühungen seither geführt haben. Der Verfasser stützt sich hier
bei auf Primärquellen, wissenschaftliche Sekundärliteratur, Mel
dungen und Analysen internationaler Medien sowie Gespräche mit
2
Politikern, Diplomaten und Wissenschaftlern asiatischer Staaten.
Mit Blick auf den essayistischen Charakter des Berichts wurde auf
einen Anmerkungsapparat verzichtet.
Ergebnisse
Die Resultate der sowjetischen Asienpolitik der siebziger und
achtziger Jahre bieten ein gemischtes Bild. Den eindrucksvollsten
Erfolg erzielte die UdSSR - wenn auch um den Preis hoher wirt
schaftlicher Belastungen - durch die Aufnahme bündnisähnlicher
Beziehungen zu Vietnam, wodurch sie erstmals in Südostasien poli
tisch-militärisch Fuß fassen konnte. Das Vordringen nach Afghani
stan muß unter dem Aspekt einer Kosten-Nutzen-Rechnung eher skep
tisch beurteilt werden. Der sowjetische Einfluß in Südwestasien
ist insgesamt zurückgegangen, während das freundschaftliche Ver
hältnis zu Indien weiter stabilisiert werden konnte. Die gespann
ten Beziehungen zu Japan haben sich eher verschlechtert. Gegenüber
Peking kam es bilateral zu einer gewissen Entlastung. Durch Hanois
Anbindung an den Sowjetblock und den damit in Zusammenhang stehen
den sino-vietnamesischen Konflikt konnten Fortschritte bei der
Eindämmung Chinas erzielt werden. Der Ausgang des Zweiten Indo-
chinakrieges erbrachte zunächst Pluspunkte im Bereich der Rivali
tät mit den Vereinigten Staaten, die aber dadurch - zumindest
teilweise - wieder aufgewogen wurden, daß sich als Folge der Eta
blierung der Achse Moskau-Hanoi und des sowjetischen Abenteuers in
Afghanistan in vielen asiatischen Staaten die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit mit den USA verstärkte. Eine Verdichtung der chine
sisch-japanisch-amerikanischen Kooperation konnte die UdSSR nicht
verhindern. Die mit der sowjetischen Idee eines Kollektiven
Sicherheitssystems in Asien (KSA) verbundenen Hoffnungen erfüllten
sich nicht. Insgesamt gesehen führte das Bemühen der Sowjetunion
um die Erweiterung ihres Einflusses in Asien somit zu sehr unter
schiedlichen Ergebnissen.
3
Im sicherheits- und interessenpolitischen Kalkül der Kremlführer
rangiert, regional gesehen, Asien nach Europa an zweiter Stelle.
Hauptziel sowjetischer Außenpolitik ist die Garantie der terri
torialen Integrität der UdSSR und des Fortbestandes ihres Gesell
schaftssystems. Mit Blick auf Asien folgt - entsprechend der Tra
dition der zaristischen Asienpolitik - sodann in Moskaus Priori
tätenkatalog das Bemühen um Expansion, d.h. um Ausdehnung des
Einflusses bis hin zur Kontrolle. Für das operationale Verhalten
der Sowjetunion ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, allen Be
strebungen entgegenzuwirken, die die Verfolgung dieses Zieles zu
behindern oder zu vereiteln geeignet sind. In den siebziger und
achtziger Jahren bedeutete dies vor allem, (1) die Volksrepublik
China einzudämmen und/oder mit ihr zu einem modus vivendi zu ge
langen, (2) den Einfluß der Vereinigten Staaten in Asien zurückzu
drängen und (3) ein enges politisch-militärisches Zusammenwirken
zwischen den USA, China und Japan zu verhindern.
"Sozialistische Staaten" in Asien als Trittsteine des sowjetischen
Expansionismus
Als Trittsteine der Ausbreitung sowjetischen Einflusses in Asien
sollen asiatische "sozialistische Staaten" dienen, die von einer
kommunistischen Partei kontrolliert werden, die ihrerseits mit der
KPdSU verbündet und von dieser in einem möglichst hohen Maße wei
sungsabhängig ist. Sieht man von der Mongolischen Volksrepublik
ab, auf die diese Kriterien eines sowjetischen Satellitenstaates
von Anfang an und bis heute zutreffen, so entstanden noch zu Sta
lins Lebzeiten drei Länder, die diese Voraussetzungen hätten er
füllen können: Nordkorea, Nordvietnam und die VR China. Ihre Ent
stehungsbedingungen waren allerdings unterschiedlicher Natur.
Während das Kim-I1-Sung-Regime mit Hilfe sowjetischer Bajonette
oktroyiert wurde, vollzog sich die kommunistische Machtübernahme
4
in Nordvietnam und in China ohne größeres Zutun der UdSSR. Daß
Moskaus Kalkül im Hinblick auf die den drei Ländern zugedachte
Rolle nicht voll aufging, ist vor allem im Zusammenhang mit dem
Zerfall der sino-sowjetischen Allianz zu sehen. Peking entzog sich
seit dem Ende der fünfziger Jahre gänzlich einer sowjetischen
Einflußnahme, während Pyongyang bis heute und Hanoi bis 1978 den
Konflikt zwischen den beiden kommunistischen Großmächten dazu
nutzten, eine Politik des Schaukeins zwischen Moskau und Peking zu
verfolgen und so mehr innenpolitische Selbständigkeit und außen
politischen Spielraum zu gewinnen.
Kambodscha seit Mitte der siebziger Jahre und Afghanistan seit
1978 passen insofern nicht in den beschriebenen Raster, als sie
nicht von einer kommunistischen Partei voll kontrolliert werden
und von Moskau bis heute nicht als "sozialistische Staaten" aner
kannt sind. Bei Laos ist diese Kontrolle zwar im Prinzip gegeben,
und um 1977 erhielt es den sowjetischen Gütestempel "soziali
stisch". Doch hier verhindert der Nationalismus der vietnamesi
schen Kommunisten, gepaart mit deren eigenem hegemonistischen
Anspruch im indochinesischen Raum, eine vollen sowjetischen Zu
griff auf Vientiane - wie auch auf Hanoi selbst und auf Phnom
Penh. Hieraus folgt, daß heute in Asien nur die Mongolische Volks
republik im Sinne der genannten Kriterien als echter sowjetischer
Satellit gelten kann. Somit war auch, gemessen an Moskaus Maximal
vorstellungen, die auf eine Instrumentalisierung kommunistischer
Staaten gerichtete sowjetische Asienpolitik nur begrenzt erfolg
reich.
Vorsichtige Entspannung im Konflikt mit China
Der Bruch mit Peking stellt den eindrucksvollsten Mißerfolg der
sowjetischen Nachkriegspolitik in Asien dar. Er bildet eine deut
liche Zäsur und wirkt sich bis heute mehr oder weniger auf Moskaus
5
Beziehungen zu den anderen asiatischen Staaten aus, die in hohem
Maße zu einer Funktion des entstandenen Konflikts degenerierten.
Die Vision der Kremlführer von einem sino-sowjetischen Kondominium
über Asien mit der UdSSR als primus inter pares, wie sie sich in
den fünfziger Jahren umrißhaft abgezeichnet hatte, war um 1960
längst zerstoben. In weiten Teilen der sowjetischen Bevölkerung
entwickelte sich, vor allem seit dem Chaos der Kulturrevolution
und den blutigen Grenzgefechten des Jahres 1969, die Furcht vor
einem feindlich gesonnenen und dabei unberechenbaren, weil irra
tional handelnden China. Bedrohliche, rassistisch unterlegte Vor
stellungen von einer "gelben Gefahr" (russ. 2eltaja opasnost')
lebten wieder auf, die seit dem Tatarenjoch des 13. und 14. Jahr
hunderts dem Bewußtsein der Russen nie ganz entschwunden waren.
Auch wenn solche rational kaum faßbaren Ängste, soweit sie über
haupt die sowjetische Führungselite erreichten, sich hier ange
sichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen und militärischen
Schwäche Chinas allenfalls auf eine fernliegende Zukunft beziehen
können, so mußte Moskau sich dennoch durch die Aussicht auf be
achtliche Anstrengungen und hohe Kosten beunruhigt fühlen, die
nötig sein würden, um den von China ausgehenden Irritationen ent
gegenzuwirken .
Die sowjetischen Besorgnisse verstärkten sich, als Peking die
Doppelkonfrontation mit Moskau und Washington beendete und Anfang
der siebziger Jahre einen Prozeß der Annäherung an die Vereinigten
Staaten einleitete, der binnen kurzem die Aufnahme diplomatischer
Beziehungen Chinas zu den Verbündeten der USA und und damit auch
zu Japan und zur Bundesrepublik Deutschland zur Folge hatte. Das
in Moskau gefürchtetste Szenario für Asien, dasjenige einer ameri
kanisch-japanisch-chinesischen Entente (unter Einbeziehung Südko
reas) rückte in den Bereich des Vorstellbaren.
6
Bilateral entwickelte die Kremlführung gegenüber Peking nun eine
Doppelstrategie, die der militärischen Eindämmung eine beschwich
tigende Komponente hinzufügte. Der gewaltige Aufmarsch an der
sino-sowjetischen und sino-mongolischen Grenze, der Mitte der
sechziger Jahre verstärkt eingesetzt und zur Stationierung von
einem Viertel der sowjetischen Landstreitkräfte geführt hatte,
wurde beibehalten. Daneben aber bot Moskau den Chinesen den Ab
schluß von Gewaltverzichts- und Nichtangriffsverträgen an und
drängte auf die Aufnahme von Normalisierungsverhandlungen.
Peking zeigte sich zunächst unnachgiebig und warb in der zweiten
Hälfte der siebziger Jahre im Westen sogar um die Bildung einer
internationalen antisowjetischen Einheitsfront. Erst seit 1979
ließ es eine gewisse Bereitschaft zur Verbesserung der Beziehungen
erkennen. Dies geschah im Rahmen einer veränderten, auf mehr
Selbständigkeit bedachten Außenpolitik und aus dem Wunsch nach
einer Kompensation für den gekündigten Bündnisvertrag von 1950
heraus sowie, später, auf Grund einer Abkühlung des Verhältnisses
zur Reagan-Administration wegen deren Haltung in der Taiwan-Frage.
Es kam zu dem bis heute andauernden sino-sowjetischen Entspan
nungsprozeß. Er brachte zwar keine Fortschritte im Bereich der
drei großen Konfliktfelder, die von Peking als Ausdruck des so
wjetischen Versuchs einer strategischen Einkreisung Chinas defi
niert werden (Militärpräsenz an Chinas Grenze zur UdSSR und zur
Mongolischen VR einschließlich der Stationierung von 135 exklusiv
oder primär auf asiatische Ziele ausgerichteten Nuklearraketen des
Typs SS-20, Intervention in Afghanistan, Unterstützung der viet
namesischen Intervention in Kambodscha), führte aber zu vorsichti
gen Annäherungsschritten in den bilateralen Beziehungen (Handel,
Kultur, Wissenschaft, Verkehrswesen u.a.).