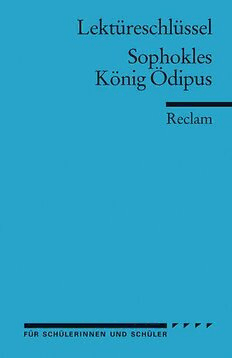Table Of ContentLEKTÜRESCHLÜSSEL FÜR SCHÜLER
Sophokles
König Ödipus
Von Theodor Pelster
Philipp Reclam jun. Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
© 2005, 2008 Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2008
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEKund
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEKsind eingetragene
Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart
ISBN 978-3-15-950434-4
ISBN der Buchausgabe: 978-3-15-015356-7
www.reclam.de
Inhalt
1.Hinführung zum Werk 5
2.Inhalt 8
3.Personen 17
4.Die Struktur des Werks 27
5.Wort- und Sacherläuterungen 32
6.Interpretation 37
7.Autor und Zeit 59
8.Rezeption 73
9.Checkliste 77
10.Lektüretipps 82
Anmerkungen 85
1. Hinführung zum Werk
Seit Sigmund Freud wichtige Erkenntnisse über die Trieb-
struktur des Menschen unter dem Stichwort
»Ödipus-Komplex« zusammenfasste, wird Ödipus-Komplex
die Gestalt des sagenhaften Königs von The-
ben nicht nur dort genannt, wo es um die griechische Tragö-
die des Sophokles geht, sondern auch da, wo Ergebnisse der
Psychoanalyse vorgestellt und diskutiert werden. Für Freud
war dieser König Ödipus eine literarische Gestalt, an der er
seine wissenschaftlichen Erkenntnisse veranschaulichen
konnte.
Der Mythos des Ödipus, dem schicksalhaft vorherbe-
stimmt ist, seinen eigenen Vater umzubrin-
gen und seine Mutter zu ehelichen, wird von Der Mythos des
Freud als Bild verstanden, an dem er demon- Ödipus
strieren will, welche Triebe im Menschen
angelegt sind. Allerdings sind Freuds Thesen umstritten.
Die wissenschaftliche Diskussion hat sich nicht nur an
den Einzelthesen dieser Theorie entzündet, sondern auch an
der Sammelbezeichnung »Ödipus-Komplex«. Unverkenn-
bar ist jedoch, dass Sigmund Freud ebenso wie der griechi-
sche Dichter Sophokles nach den tiefsten Beweggründen
menschlichen Handelns fragt. Die Geschichte des Ödipus
zeigt in beispielhafter Weise, wie ein Mensch aufbricht,
sich und seine Herkunft zu erforschen, und erfahren
muss, wie schmerzlich die Erkenntnis seiner selbst ist.
In der Tragödie des Sophokles wird Ödi-
pus zunächst als Herrscher der mächtigen Die Tragödie des
Stadt Theben vorgestellt. Er ist, wie allge- Sophokles
mein angenommen wird, als Fremder in die
6 1.HINFÜHRUNG ZUM WERK
Stadt gekommen. In einer schwierigen Situation hatte er
Theben von dem Unheil befreit, das von der Sphinx, einem
sagenhaften Ungeheuer, ausging. Er allein hatte die über Le-
ben und Tod entscheidende Frage der Sphinx beantworten
können, welches Lebewesen sich am Morgen auf vier Bei-
nen, am Mittag auf zweien und am Abend auf dreien fort-
bewegt. Mit seiner Antwort – »Der Mensch« – hatte er das
Rätsel gelöst und die Macht der Sphinx gebrochen. Die The-
baner machten ihn zum König, da Laios, der angestammte
Herrscher, auf einer Fahrt zum Delphischen Orakel um-
gekommen war.
Nun steht König Ödipus vor einer neuen Herausforde-
rung: In Theben ist die Pest ausgebrochen und die Bewoh-
ner erwarten, dass ihr Herrscher auch dieses Unheil besiege.
Ödipus schickt sich an, die Ursachen des neuerlichen Un-
heils ausfindig zu machen und das Übel an der Wurzel zu
packen. Der Gang dieses Geschehens wird dem Zuschauer
des Dramas vor Augen geführt. Sehr bald wird deutlich,
dass die Frage, was das für ein Lebewesen sei, das sich zuerst
auf vier, dann auf zwei und schließlich auf drei Beinen hält,
auf einer anderen Ebene weiter verhandelt wird; denn
auch in der Tragödie des Sophokles geht es
Fragestellungen um die Frage nach dem Menschen, den Be-
dingungen und Möglichkeiten menschlichen
Denkens, Wissens und Handelns.
Anfangs scheint nur die Rolle des Herrschers zur Dis-
kussion zu stehen: Was erwartet man von einem König,
der zugleich Regent und Richter ist? Wie verhält er sich
gegenüber den Göttern und gegenüber den Mitmen-
schen? Was kann, darf und soll er tun? Und wo sind die
Grenzen seiner Macht und seiner Fähigkeiten?
Bald aber zeigt sich, dass die Frage zu eng gestellt ist. An
1.HINFÜHRUNG ZUM WERK 7
König Ödipus erweist sich nur in herausgehobener Wei-
se, was jeder Mensch an sich erfahren kann. Der Mensch
ist nicht der Herr über alle Mächte und Gewalten. Be-
grenzt ist sein Wissen über sich selbst, über seine Her-
kunft und über den Lauf der Welt. Zu Hoch- und Über-
mut gibt es keinerlei Veranlassung. Allgemeinere und
drängendere Fragen stellen sich dem Zuschauer und dem
Leser: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf
ich hoffen? Was ist der Mensch?
Ödipus endet tragisch. Das ihm auferlegte Schicksal holt
ihn ein, sosehr er sich bemüht, diesem zu entgehen. Es
gibt Mächte, das ist die feste Meinung des Sophokles, die
über dem Menschen stehen und denen der Mensch ausge-
liefert ist. Sophokles nannte sie Schicksal, Freud glaubte,
sie in den Trieben und Anlagen des Menschen vorgefunden
zu haben. Weitere Ausdeutungen scheinen durchaus mög-
lich.
2. Inhalt
Die Vorgeschichte der in der Tragödie gezeigten
Handlung
Der Zuschauer im Dionysos-Theater von Athen, für den die
Tragödie König Ödipus verfasst und aufge-
Die Situation führt wurde, kannte die Geschichte, aus der
der Zuschauer ihm eine Szenenfolge gezeigt werden sollte,
in Athen in ihrem ganzen Umfang, bevor er das Thea-
ter betrat. Er konnte die Titelfigur und ihre
Lebensgeschichte dem thebanischen Sagenkreis zuordnen
und wusste, wer die Vorfahren und die Nachkommen dieses
Herrschers waren.
Die Familiengeschichte des Ödipus beginnt mit Kadmos,
dem sagenhaften Gründer der Stadt Theben.
Die Familien- Dieser Kadmos war aus der phönizischen
geschichte des Stadt Tyros auf das griechische Festland ge-
Ödipus kommen und hatte vom Delphischen Orakel
den Auftrag erhalten, in Böotien eine Burg-
stadt zu gründen, die Kadmeia, die Burg von Theben. Trotz
großer Schwierigkeiten setzte sich dieser Kadmos durch
und sicherte seine Herrschaft. Auch seine Nachkommen
hatten sich mit Gegnern aller Art auseinander zu setzen:
Labdakos, der Enkel des Kadmos, musste sich den Thron
hart erkämpfen; Laios, der Sohn des Labdakos, verbrachte
eine Zeit im Exil, ehe er den Thron wieder erringen konnte.
Im Exil hatte Laios sich den Zorn des Pelops, bei dem er auf-
genommen worden war, und der Göttin Hera zugezogen,
als er Chrysimos, den Sohn des Pelops, verführte. Seit dieser
Zeit lastete ein Fluch auf der Familie des Laios.