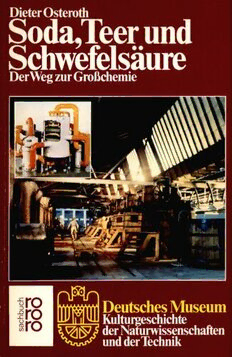Table Of ContentZu der Buchreihe
«Kulturgeschichte der Naturwissenschaften
und der Technik»
Naturwissenschaftliche und technische Gegenstände sind nicht
eindeutig, sondern vieldeutig. Ihre humanen, sozial- und geistes
geschichtlichen Beziehungen zeigen sich nicht in Funktionsbe
schreibungen. Ebenso sagt die rein fachliche Darstellung der Ge
schichte von Naturwissenschaft und Technik nichts aus über deren
gesellschaftliche, wirtschaftliche und allgemein geistesgeschicht
liche Voraussetzungen und über die sich ergebenden Konsequen
zen. Demgegenüber versucht die gemeinsam vom Deutschen
Museum und dem Rowohlt Taschenbuch Verlag herausgegebene
neue Buchreihe (Kulturgeschichte der Naturwissenschaften und
der Technik> auch jene Bezüge, welche die Fachgebiete übergrei
fen, zu beschreiben und durch Bilder zu veranschaulichen.
Die Bände richten sich an Lehrer und Ausbilder; doch sind sie so
gestaltet, daß jeder interessierte Laie sie verstehen kann. Es zeigt
sich, daß der Weg durch die Geschichte nicht eine zusätzliche Er
schwerung des Lehr- und Lernstoffes bedeutet, sondern das Ver
ständnis der modernen Naturwissenschaften und der Technik er
leichtert.
Dieter Osteroth
Soda, Teer und
Schwefelsäure
Der Weg zur Großchemie
ro
ro
ro
Deutsches Museum Rowohlt
Die Buchreihe zur Kulturgeschichte der Naturwissenschaften und der Technik
entstand im Rahmen zweier Projekte am Deutschen Museum, die vom Bun
desminister für Bildung und Wissenschaft und der Stiftung Volkswagenwerk
finanziell unterstützt wurden. Verantwortlich für die Konzeption der Reihe:
Bert Heinrich, Friedrich Klemm t, Michael Matthes, Jürgen Teichmann.
Die Interpretation der Fakten gibt die Meinung des Autors, nicht die des
Deutschen Museums wieder.
Redaktion im Deutschen Museum: Bert Heinrich
Bildredaktion: Ludvig Vesely
Bildrechte: Rolf Gutmann
Redaktionsassistentin: Edeltraut Hörndl
Diese VeröflentHchung wurde mit Mitteln des Bundesminteters
für Bildung und Wissenschaft gefördert
Originalausgabe
Umschlagentwurf: Werner Rebhuhn
(Ausschnitt aus dem Diorama der Farbenherstellung bei Bayer,
Abteilung Technische Chemie, Deutsches Museum.
Kleines Bild: Doppelkatalyse-Kontaktanlage zur Gewinnung
von Schwefelsäure 1960, Modell im Deutschen Museum)
Redaktion: Jürgen Volbeding
Layout: Edith Lackmann
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg, Januar 1985
Copyright © 1985 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
Satz Times (Linotron 202)
Gesamtherstellung Clausen & Bosse, Leck
Printed in Germany
1480-ISBN 3 499 17720 X
Inhalt
Einleitung 7
1. Die Ursprünge der modernen Technik 8
2. Die industrielle Revolution 10
3. Chemische Technik 11
4. Der Weg zum chemischen Prozeß 11
5. Ursprünge der chemischen Industrie 13
Zeittafel 15
l. Der Weg zur anorganischen Großchemie 27
1. Die englische Textilindustrie - Keimzelle der
Industriealisierung 27
2. Soziale Auswirkungen der industriellen Revolution 30
3. Der Beginn der chemischen Industrie 31
4. Schwefelsäure 32
5. Das Leblanc-Verfahren zur Sodaherstellung 36
6. Die Nebenprodukte der Leblanc-Industrie 43
7. Die Bedeutung der Leblanc-Industrie 48
D. Die Anfänge der Kohleveredlung
Leuchtgas, Koks, Teer und Ammoniak 51
1. Gaslicht 51
2. Die trockene Destillation von Kohlen 54
3. Gaswerk 54
4. Stahlrohre 58
5. Koks für Eisenhütten 60
6. Chemische Produktion schafft Umweltprobleme 63
7. Moderne Koksöfen 65
8. Die Gewinnung der Nebenprodukte bei der trockenen
Destillation von Steinkohlen 68
m. Teerchemie 71
1. Rohstoffquelle Teer 71
2. Farbe 74
3. Drogen und Drogenhandel 74
4. Umweltskandal Anno 1864 76
5. Die Aufarbeitung von Rohteer 78
6. Der Schlüssel zum Geheimnis der Farbstoffe 87
7. Der große Durchbruch 92
8. Die Teerfarbenfabrik 95
9. Heilmittel aus Teerprodukten 100
IV. Die anorganische Industrie der zweiten Generation 107
1. Solvay contra Leblanc 107
2. Der Solvay-Prozeß 111
3. Neue Wege zu Chlor und Alkalilaugen 118
4. Die Chloralkali-Elektrolyse 121
5. Die Revolution in der Landwirtschaft 127
6. Düngemittelindustrie 131
7. Kontakt-Schwefelsäure 136
8. Der Chemiegroßbetrieb 145
V. Mit Hochdruck ins 20. Jahrhundert 150
1. Die Aufgabe: Stickstoffdünger aus Luft 150
2. Bosch meistert das Stickstoffproblem 153
3. Die Haber-Bosch-Synthese 156
4. Oppau und Leuna 158
5. Ammonsulfat 160
6. Salpetersäure 162
7. Düngemittel-heute 167
8. Der <Kohle-Strang> 168
9. Ethylen und Acetylen 171
10. Petrochemie 177
VI. Mensch-Gesellschaft-Chemie 184
1. Mensch und Chemie 184
2. Die chemische Industrie 188
3. Menschen in der chemischen Technik 204
4. Der Chemiker und seine Helfer 227
5. Chemische Fabrik und Umwelt 235
VII. Stadien im Deutschen Museum
von G. Probeck 243
Anhang 248
Literaturverzeichnis 248
Personen- und Sachregister 250
Bildquellen 253
Einleitung
Chemie ist die Wissenschaft von den Stoffen und Stoffänderungen; die
chemische Technik befaßt sich mit der technischen und wirtschaftlichen
Nutzung chemischer Erkenntnisse. Neben der technischen Durchführung
von Vorgängen, bei denen stoffliche Umwandlungen stattfinden, spielt
die Gewinnung chemisch reiner Verbindungen aus Stoffgemischen eine
sehr große Rolle; ein Beispiel hierfür ist die Isolierung von Zucker aus
Zuckerrohr oder Zuckerrüben.
Die Anfänge chemisch-technischer Betätigung reichen weit in die Ge
schichte zurück, und das ist leicht verständlich: Besteht doch der Zweck
dieser Tätigkeit darin, mineralische, pflanzliche und tierische Rohstoffe
so umzuwandeln, daß sie dem Menschen für seine Ernährung, Beklei
dung sowie insgesamt für die Sicherung seiner Existenz in einer ihm
ursprünglich feindlichen Umgebung dienen können. Backen von Brot,
Bereitung von Bier und Wein, Herstellung von Tonziegeln, Glas und ke
ramischen Erzeugnissen, Metallgewinnung zur Herstellung von Geräten,
Waffen und Schmuck, Bleichen und Färben tierischer und pflanzlicher
Fasern oder das Sieden von Seife sind Beispiele, die umfangreiche, empi
risch gewonnene Kenntnisse bei der Durchführung von Stoffumwandlun
gen bezeugen. Die frühen Hochkulturen am Nil sowie an Euphrat und
Tigris sind ohne solide «chemische Kenntnisse> nicht vorstellbar. So hatte
die «Zähmung des Feuers« zur Herstellung von Tongefäßen und zur Glas
macherei geführt; ein weiterer wichtiger Technologiezweig war die Zie
gelbrennerei. Auch die Gewinnung von Metallen basiert auf der Beherr
schung des Feuers: Holzkohle und Blasebalg waren die Hilfsmittel, die
eine fast bis zum Ende des 18. Jahrhunderts unveränderte Metallurgie
ermöglichten. Aber auch Stoffumwandlungen auf «kaltem Wege> waren
bekannt; Gärungsvorgänge wurden z. B. für die Herstellung von Bier,
Käse und Wein benutzt. Man kannte u. a. auch die Gewinnung von Farb
stoffen aus pflanzlichen und tierischen Materialien; die Farbstoffe dien
ten sowohl für die Färbung von textilen Materialien wie auch für kosmeti
sche Zwecke.
Die Welt des technischen Chemikers gilt als schwer zugänglich: Che
mie, Physik, Technik und Wirtschaft scheinen hierzu einem für den Laien
nicht überschaubaren Netzwerk verflochten zu sein; tatsächlich kann man
aber anhand einiger «roter Fäden> Verständnis für die chemische Technik
gewinnen.
Über die Ursprünge der modernen technischen Chemie gibt es einige
7
falsche Vorstellungen: Nur zu oft glaubt man, sie sei im Gefolge der gro
ßen chemischen Entdeckungen des 18. und 19. Jahrhunderts entstanden,
in jenen Jahrzehnten also, in denen die Chemie durch große Pioniere von
der Empirie zur exakten Wissenschaft entwickelt wurde. Nicht selten
wird dabei übersehen, daß die wirtschaftliche Entwicklung erst jenen
Punkt erreicht haben mußte, wo Interesse an einer industriellen Verwer
tung wissenschaftlich-chemischer Entdeckungen bestand: «Der Bedarf
also führt zur Ausnutzung aller Erfindungen - falls man sich an sie erin
nert - und regt zu neuen Erfindungen an» (W. Treue).
Andererseits bleibt Grundlagenforschung Voraussetzung aller chemi
schen Technik. Viele im Reagenzglas und in Laborapparaturen des For
schers glatt verlaufende Reaktionen sind für eine wirtschaftliche Produk
tion in großem Maßstab ungeeignet. Zahlreiche Gründe mögen dafür
maßgeblich sein: Die benötigten Rohstoffe können zu teuer oder nicht
verfügbar, die Reaktionsbedingungen (z. B. Druck, Temperatur) können
für die technische Umsetzung zu extrem, die Ausbeuten an gewünschter
Substanz zu gering und die Menge an unerwünschten Nebenprodukten zu
groß sein, und auch den Problemen einer Umweltbelastung durch chemi
sche Prozesse kommt - nicht erst in unseren Tagen! - ein hoher Stellen
wert zu. Die chemische Industrie will ja nicht nur produzieren - sie muß
vor allen Dingen wirtschaftlich und sicher produzieren. Wirtschaftliches
Produzieren verlangt aber, sich der jeweiligen Situation (z. B. veränder
ter Rohstoffsituation oder neuer Marktlage) anzupassen. Dies verlangt
ständige wissenschaftliche Arbeit in Laboratorien und Technika; kaum
irgendwo in Industrie und Wirtschaft ist Forschung von so fundamentaler
Bedeutung wie in der chemischen Industrie.
1. Die Ursprünge
der modernen Technik
Zünfte (d. h. örtliche Fachverbände, in denen die Handwerker pflichtge
mäß Mitglied sein mußten) und Universitäten schufen die Grundlagen für
die von der Technik mitgeprägte abendländische Kultur. Parallel zueinan
der begann im 13. Jahrhundert die Entfaltung der Universitäten und, ge
fördert durch das Zunftwesen, der Übergang von der Hauswirtschaft zum
marktversorgenden Gewerbe.
Die Universitäten sind Ausdruck einer geistigen Bewegung mit der
Zielsetzung, dem Menschen eine rationale Erfassung der Welt zu ermög
lichen. Sie entstanden fast gleichzeitig um 1200 herum in verschiedenen
Ländern Europas.
«In Europa entstand die Universität tatsächlich spontan, nicht aus staatlicher oder
kirchlicher Initiative, nicht aus sozialen oder wirtschaftlichen Beweggründen, son-
8
dem aus ursprünglichem Wissensdrang, aus Erkenntniswillcn und Wahrheitsstre
ben und ging ihre eigenen, oft unbequemen Wege. In ihrem Ursprung und Wesen
ist sie auf unabhängiges Denken, Forschen und Lehren gerichtet» (W. P. Neu
mann).
Der ursprüngliche Begriff Universität, die Gemeinschaft von Lehrern
und Schülern mit korporativer Selbstverwaltung ist zuerst 1213 in Paris
bezeugt. Die erste Universität auf deutschsprachigem Boden wurde 1348
von Karl IV. in Prag gegründet.
Der idealistische Wesenszug der alten Universitäten wurde aber
schließlich überdeckt von einer praxisbezogeneren Zielsetzung. Eine ih
rer wesentlichen Aufgaben im 18. Jahrhundert bestand darin, einen wis
senschaftlich geschulten Beamtennachwuchs für den absolutistischen
Staat heranzubilden. An die Stelle der Intemationalität der mittelalterli
chen Universität trat das Territorialprinzip. Die erste Universität der
Neuzeit, die 1694 gegründete Universität Halle a. d. Saale, war die <Ge-
brauchs-Universitäb der preußischen Monarchie.
Zur Heranbildung wissenschaftlich geschulter Techniker entstanden im
19. Jahrhundert Gewerbeschulen, Ingenieurschulen und Technische
Hochschulen, deren großes Vorbild die 1794 vom französischen National
konvent gegründete École Polytechnique in Paris war. Zugleich entstan
den an den Universitäten naturwissenschaftliche Disziplinen mit einer
wachsenden Anzahl von Lehrstühlen und angegliederten Instituten und
Laboratorien für experimentelle Forschung.
Im ausgehenden 11. bzw. in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts war
das Handwerk so sehr erstarkt, daß sich die Handwerker nach dem Vor
bild der Kaufmannsgilden genossenschaftlich zusammenschlossen; im
Verlauf des 14. Jahrhunderts setzte sich für diese Vereinigungen die Be
zeichnung <Zünfte> durch. Hauptaufgabe der Zünfte war die Wahrneh
mung der gemeinsamen Interessen der Zunftgenossen und die Sicherung
ihrer handwerklichen Tätigkeit. Die Zünfte übten Zunftzwang aus:
Handwerker desselben Gewerbezweiges, die der Zunft nicht angehörten,
durften sich in der Stadt selbst bzw. innerhalb der städtischen Bannmeile
nicht betätigen. Die Aufnahme in die Zunft erfolgte gegen eine Gebühr.
Die Zünfte kontrollierten die Qualität der von ihren Mitgliedern er
zeugten Waren und strebten an, daß möglichst nur einwandfreie Ware zur
Auslieferung kam. Sie kümmerten sich ferner um den Nachwuchs und
stellten Richtlinien für die Handwerkerausbildung auf; um Meister zu
werden, mußte vom betreffenden Gesellen ein Meisterstück vorgewiesen
werden. Jeder angehende Handwerker mußte eine Lehrzeit durchma
chen, die mehrere Jahre dauerte. Die Zünfte organisierten zuweilen ge
meinsam ihre Rohstoffe. Sie sorgten auch dafür, daß der einzelne Hand
werksbetrieb eine bestimmte Größe nicht überschritt.
Die Zünfte hatten Selbstverwaltung und kontrollierten durch ihre
9
Zunftverfassung den Arbeitsmarkt, indem sie die Anzahl der Meister
festlegten und auch bestimmten, wieviel Lehrlinge und Gesellen der ein
zelne Meister beschäftigen durfte.
Die Zünfte waren von größter Bedeutung für die Entwicklung der
Wirtschafts- und Gesellschaftsformen des Mittelalters bis zu dessen Aus
gang. Sie waren in dieser Zeit die Zentren des handwerklich-technischen
Fortschritts und trugen entscheidend dazu bei, von der Eigenversorgung
im Rahmen einer Hauswirtschaft zur Marktversorgung zu gelangen. In
späteren Jahrhunderten erwiesen sie sich beim Übergang auf neue Pro
duktionsformen als Hemmschuh der technischen Entwicklung. Erstarrt
in veralteten Gesellschaftsformen, und bedacht auf Wahrung ihrer Privi
legien, überlebten sie sich schließlich selbst.
Im 17. Jahrhundert zögernd beginnend, entstand im Zusammenhang
mit der merkantilistischen Wirtschaftsordnung und den sich stärker ent
wickelnden Manufakturen ein Interesse, die handwerklich-empirischen
Methoden wissenschaftlich zu untersuchen, zu durchdringen und zu ver
breiten. Dies führte im 18. Jahrhundert zum Entstehen der großen Enzy
klopädien, in denen handwerkliche Erfahrungen systematisch gesammelt
und geordnet wurden. Ein bedeutendes Beispiel dafür ist die 35bändige
Encyclopédie - davon 12 Tafelbände - von Diderot und d’Alembert, die
zwischen 1751 und 1780 erschien.
Naturwissenschaftliche Denkweise, die auf der Erkenntnis beruht, daß
- abgesehen vom freien Willen des Menschen - die Natur determiniert ist,
daß also Naturgesetze Gültigkeit haben, hatte sich durchgesetzt; die Na
tur wurde Gegenstand menschlicher Erkenntnis. Wichtige Wegbereiter
waren Nikolaus Kopernikus (1473-1543), Galileo Galilei (1564-1642),
Johannes Kepler (1571-1630) und Isaac Newton (1643-1727). Die Ar
beiten dieser Forscher führten zur Aufstellung von Naturgesetzen, die
mathematisch formuliert werden konnten. In dieser Zeit wurden auch die
Anfangsgründe der Differential- und Integralrechnung durch Newton
und Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) gelegt.
2. Die industrielle Revolution
Parallel zu der großen Französischen Revolution von 1789, deren Folgen
sich in Politik, Gesellschaftsstruktur, Kunst und Literatur dieser Zeit wi
derspiegeln, vollzog sich eine zweite, aus heutiger Sicht gleich folgen
schwere Revolution: Die moderne Technik entstand. Aus Handwerksbe
trieben und Manufakturen entstanden die ersten Fabriken, entwickelte
sich die Industrie. Besondere Bedeutung kommt der chemischen Indu
strie zu: Düngemittel, synthetische Fasem, Kunststoffe, Farbstoffe,
pharmazeutische Produkte, Waschmittel und Kosmetika gehören zu ih
10