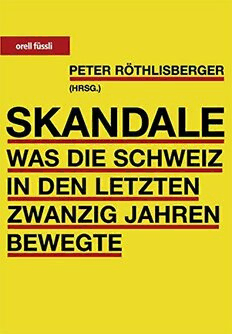Table Of ContentVorwort
Abhöranlagen Grosser Bruder Onyx
Von Urs Paul Engeler
Geheimbunker Wenn sich die Regierung vorm eigenen Volk verstecckt
Von Nikiaus Ramseyer
Dino Bellasi Eine Geschichte - zu gut, um nicht wahr zu sein
Von Christian Mensch
Oberst Nyffenegger eine helvetische Affäre
Von Urs Paul Engeler
Swissair-Grounding Unglaubliches Mass an Unvermögen
Von René Lüchinger
Werner K. Rey Des Schaefers Fluch
Von Res Strehle
Nachrichtenlose Vermögen «Mit Meili wurde die Geschichte interessant»
Von Pierre Weill
Konzern-Kollaps Die Erb-Schuld
Von Daniela Niederberger
Fluchtgelder Die heilsame Wirkung von Skandalen
Von Daniel Ammann
Martin Ebner Ein Genie mit Hang zur Selbstüberschätzung
Von Claude Baumann
Pasquale Brumann Der Mord von Zollikerberg
Von Peter Holenstein
Peter Aliesch Im geschenkten Nerz - eine griechische Tragödie
Von Matthias Ackeret
Pasquale Brumann Der Mord von Zollikerberg
Von Peter Holenstein
Peter Aliesch Im geschenkten Nerz - eine griechische Tragödie
Von Matthias Ackeret
Elisabeth Kopp «Tipps für eine zukünftige Bundesrätin»
Von Peter Röthlisberger
Raphael Huber Die Zürcher Wirte-Connection
Von Andreas Durisch
Borer-Affäre Nichts als Verlierer
Von Christian Mensch
Rita Dolder Unter der Gürtellinie
Von Michael Hug
Tommaso Ramundo «Das isch dä Fuessballer Moldovan gsi»
Von Matthias Ackeret
Spuckaffäre Überhitzung im Mikrokosmos Fussball
Von Flurin Clalüna
Was bewegt die Welt? Vertrauen, Reputation und Skandal
Von Kurt Imhof
Namenregister
Zu den Autorinnen und Autoren
Vorwort
Wann wird ein Skandal zum Skandal? Wenn er zum Tagesgespräch wird, wenn
er sich in der Aufmerksamkeitsökonomie der Öffentlichkeit während Wochen
oder gar Monaten auf einem Spitzenplatz zu halten mag. Am Anfang aller Skan-
dale steht ein Verstoss gegen strafrechtliche Bestimmungen, moralische Vor-
schriften oder gesellschaftlich vereinbarte Normen. Als Grundregel gilt: Die
Schwere des Skandals misst sich an der Fallhöhe zwischen den Erwartungen, die
die Öffentlichkeit an eine Person oder Institution hatte, und der Tat.
Skandale sind in ihrem Verlauf erstaunlich uniform: Verantwortungs- oder
Entscheidungsträger lösten sie aus, die Medien sorgen für die Verbreitung, das
Publikum für den Widerhall. Nach der Enthüllung kann sich der Fall in zwei
verschiedene Richtungen entwickelnde nach Abwehrstrategie der Protagonis-
ten. Geht der Tatverdächtige zum Angriff über, versucht er zu leugnen oder zu
vertuschen, zieht sich der Skandal in die Länge; gibt er aber sein Vergehen zu,
wird zur nächsten Phase übergegangen, zur Verarbeitung. Es folgt eine Ent-
schuldigung, die Täter werden sanktioniert, Sündenböcke geopfert, Strukturen
geändert, oder die Angelegenheit wird ausgesessen, bis der nächste Skandal den
vorherigen verdrängt.
Dabei bleibt die Frage ausgeklammert, wie bedeutsam der jeweilige Vorfall
denn wirklich gewesen ist. Die Bedeutsamkeit stand manchmal im direkten
Gegensatz zur veröffentlichten Erregung, und es ist mehr als verwunderlich,
wieso bestimmte Themen ein ganzes Land über Tage oder Wochen in Aufre-
gung versetzen konnten. Die Schweiz, das zeigen die Beispiele dieses Buches,
war in den letzten zwanzig Jahren alles andere als ein verschlafenes Gemein-
wesen.
Warum reagiert die Öffentlichkeit derart erregt? Die Gründe dafür sind viel-
faltig und ihre Analyse ist nicht einfach. Aber sicher scheint, dass wirtschaftliche
Unsicherheit auf nationaler und internationaler Ebene und der kollektive Ver-
trauensverlust in viele nationale Institutionen zur allgemeinen Orientierungs-
losigkeit beigetragen haben. Auch die Medien haben an diesem Prozess ihren
Anteil. Die Skandalisierung von Vorgängen und ihre Bewältigungsrituale sind
also auch ein Ausdruck dieser Krisen; sie sind die Erscheinung und nicht die
Ursache.
Dieser Definition folgend wurden für dieses Buch Skandale und Affiren aus-
gewählt, die sich in den letzten zwanzig Jahren in der Schweiz zugetragen ha-
ben und landesweit wahrgenommen und diskutiert wurden: 18 spektakuläre
Fälle aus den Bereichen Wirtschaft, Armee, Justiz, Politik, Verwaltung, Medien
und Sport. Die Auswahl ist komplett, aber unvollständig. Die Gewichtung ge-
ben unsere Definition und die Realität vor: Wirtschaftsskandale gedeihen be-
sonders gut, wenn die Konjunktur schwächelt, Militärskandale, wenn eine
ganze Institution zur Disposition steht. Andere Zeiten, andere Skandale. Kein
Zufall also, dass gerade diese beiden Bereiche besonders prominent vertreten
sind.
Die Journalisten, die an dieser Skandalsammlung beteiligt sind, qualifizieren
sich allesamt durch ihre Nähe zum jeweiligen Thema, durch ihre Detailkennt-
nisse und ihre jahrelange Erfahrung. Sie haben entweder den Skandal aufge-
deckt, ein Buch darüber verfasst, dazu geforscht oder waren Auslöser des Skan-
dals. Ihre Texte — akribisch und faktenreich — beschreiben die Genese des
Skandals, die Bewältigung, die Auswirkungen, das Schicksal der Hauptpersonen
bis zum heutigen Tag, gelungenes oder missratenes Skandalmanagement. Je
nach Gewichtung und Einschätzung kommen unsere Autoren zu ganz eigenen
Schlüssen und überraschenden Neubewertungen. Durchaus möglich, dass erst
durch dieses Buch die Tragweite einiger Skandale der jüngsten Schweizer Ge-
schichte deutlich wird.
Schliesslich erklärt der Zürcher Soziologieprofessor Kurt Imhof die neusten
Befunde zur Skandalforschung in seinem Essay «Vertrauen, Reputation und
Skandal».
Ich danke allen ganz herzlich, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen ha-
ben.
Peter Röthlisberger
Zürich im Frühling 2005
In den Wäldern und Wiesen steht mehr, als das Parlament weiss; Stillleben mit Abhör-
anlage und Kühen (Bild: U.P Engeler).
Abhöranlagen
Grosser Bruder Onyx
Zehn Nummern grösser ab die frühere Fichen-
Fabrik und ein Skandal mit Ansage: Das elektro-
nische Spionagesystem, von dem noch niemand
etwas Näheres weiss und das doch bereits alle
genau kennt, ist ein Frevel seit dessen hoch ge-
heimer Einführung 1997.
O VON URS PAUL ENGELER
Wäre im Januar 1999 ein Gemeinderat der kleinen Berner Kommune Zim-
merwald nicht etwas zu geschwätzig geworden und hätte «Der Bund» die
kleine Information, dass die bestehende Horch- und Auswertungszentrale auf
dem Längenberg südlich der Bundesstadt ausgebaut weide, nicht aufge-
schnappt und verbreitet, dann wüsste die Schweizer Bevölkerung bis heute gar
nichts. Sie wüsste nicht, wozu an drei Orten der Schweiz riesige Parabol-
antennen errichtet wurden. Sie wüsste nicht, dass Hunderte von Millionen
Franken am Parlament vorbeigeschmuggelt wurden. Sie wüsste nicht, dass mi-
litärische Schnüffler sämtliche Telefongespräche und andere Kommunika-
tionsakte via Satellitenlinks registrieren und auswerten können. Und sie wüss-
te nicht, dass alle ins Ausland laufenden Satellitenverbindungen tatsächlich
auch systematisch überwacht und nach bestimmten, aber geheim gebliebenen
Kriterien durchforscht werden.
Was die Geheimdienstler allerdings genau abhören und wer welches Mate-
rial zu welchem Zweck erhält und wie weiter verwendet, ist auch bis heute
nicht ganz klar. Zwar stellen Parlamentarier ab und zu Fragen, doch das zustän-
dige Departement furVerteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) win-
det sich. Der grösste und perfideste Lauschangriff der Geschichte der Schweiz
wurde an allen Kontrollinstanzen vorbei eingerichtet und dem Volk verschwie-
gen. Darum ist denkbar bis sehr wahrscheinlich, dass in einigen Jahren (wieder
einmal) eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) diese Anmas-
sung der Militärs und Politiker aufarbeiten und stoppen muss.
Am Mittwoch, den 13. August 1997, tagte der Bundesrat in der Besetzung
Jean-Pascal Delamuraz (FDP), Kaspar Villiger (FDP), Arnold Koller (CVP), Fla-
vio Cotti (CVP), Ruth Dreifuss (SP), Moritz Leuenberger (SP) und Adolf Ogi
(SVP). Ogi, der damalige Wehrminister, brachte den hoch geheimen Antrag ein,
es sei das «Projekt Satos 3» zu starten, die dritte Stufe eines seit Anfang der
Neunzigerjahre laufenden militärischen Geheimprogramms. «Satos 1» und «Sa-
tos 2» waren Systeme, mit denen die Kommunikation per Kurzwellen, Richt-
funk und Faxsignalen abgefangen werden konnte. «Satos 3» sollte nun die voll-
ständige «elektronische Aufklärung von Satellitenverbindungen» ermöglichen,
genau wie das grosse Vorbild, das «Echelon»-System der USA.
Ausgearbeitet hatte den Plan, von Zimmerwald aus weltweit die Telefon-,
Fax- und Mailverbindungen zu überwachen, der militärische Geheimdienst
unter dem Kommando von Divisionär Peter Regli. Die Kosten für den Aufbau
der Infrastrukturen und für die Software wurden intern auf rund 50 Millionen
Franken geschätzt, ohne die Löhne der über vierzig Sprachspezialisten und In-
formatiker, die rekrutiert werden mussten. Die Landesregierung stimmte ers-
tens dem Vorhaben «Satos 3» zu, segnete zweitens die versteckte, also illegale
Finanzierung und drittens die totale Geheimhaltung ab. Der Entscheid vom
13. August 1997 fehlt sogar im hoch vertraulichen Verzeichnis der Beschlüsse
des Bundesrates. Ein Protokoll existiert offenbar auch nicht; an die Öffentlich-
keit drang gar nichts.
Bis die lokalen Behörden patzten und schwatzten. Der Generalstab reagierte
mit einem summarischen Communiqué des spärlichen Inhalts, dass er «zwecks
elektronischer Aufklärung sicherheitspolitisch bedeutsame Informationen»
sammeln wolle. Ende der Durchsage. «Weiter gehen wir, im Interesse des Pro-
jekts, nicht», erklärte Divisionär Regli, Chef der Untergruppe Nachrichten-
dienst (Una), im bundesbetriebsinternen Blättchen, «wir müssen auch dafür sor-
gen, dass wir es der <Gegenseite> nicht zu leicht machen.» Wobei er und seine
Geheimdienstler mit «Gegenseite» offensichtlich vorab das Parlament und das
Volk meinten.
Erst einige Wochen nachdem das Vorhaben durch die Info-Panne publik
geworden war, also knapp zwei Jahre nach dem Beschluss und nach ersten
Pressemeldungen, bequemte sich Generalstabschef Hans-Ulrich Scherrer, die
Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) knapp einzuweihen. Die sechs GPDel-
Mitglieder, verantwortlich für die parlamentarische Kontrolle der Geheimbe-
reiche, hielten sich alle brav an die von derVBS-Spitze ausgegebene Order («Es
wurde strengstes Stillschweigen befohlen!») und konnten sich wie SVP-Stän-
derat Bernhard Seiler, Präsident des behördentreuen Ausschusses, bald «an gar
nichts mehr erinnern».
Die sicherheitspolitischen Kommissionen wurden gar nie informiert. Nur
deren Präsidenten, Nationalrat Jean-Pierre Bonny (FDP,BE) und Ständerat Eric
Rochat (LPS,VD), erhielten nachträglich eine vertrauliche Abreibung mit dem
Ziel der Vertuschung undVerwedelung. In keinem parlamentarischen Ausschuss
wurde das folgenschwere Projekt je andiskutiert.
In fast fahrlässiger Ahnungslosigkeit hatte darum das Parlament zuerst unter
nicht näher deklarierten Rubriken, dann unter dem verschleiernden Titel
«Neubau eines Mehrzweckgebäudes in Zimmerwald» blind ab 1997 regelmäs-
sig Kredittranchen bewilligt. Unter den «verschiedenen Zwecken» der Anlage,
die nie genau benannt wurden, sind Dutzende von Arbeitsplätzen für die
elektronischen Überwacher, Antennen sowie der Einbau von Grossrechnern zu
verstehen. Die Abhöranlage war bereits konzipiert, viele Einrichtungen erstellt,
als ausgewählte Vertreter des Parlaments erstmals davon erfuhren. Als der Natio-
nalrat das Projekt kurz besprach (die Ständeräte verzichteten auf jede Wortmel-
dung!), waren die ersten Probeläufe schon absolviert. Im April 2000 nahm das
mittlerweile in «Onyx» umgetaufte System zum ersten Mal seinen Betrieb auf;
im April 2001 ging es in einen «operationellen Probebetrieb» über. Ab 2004
läuft der «operationelle Betrieb». Ab 2005 soll Onyx mit voller Leistung arbei-
ten; dazu wird die Zahl der Parabolantennen nochmals verdoppelt.
Bereits die verdeckte, das heisst illegale Finanzierung des gigantischen Sys-
tems ist ein Skandal, wenn auch noch der kleinste. Das zweite Ärgernis ist der
steile Anstieg der Kosten. Gemäss inoffiziellen Angaben bewilligte der Bundes-
rat im August 1997 einen Betrag von 50 Millionen für das Projekt. Diese
Summe hat sich laut GPDel-Berichterstatterin, FDP-Ständerätin Helen Leu-
mann (LU), bis Mitte 2003 bereits verdreifacht. Experten sprechen sogar davon,
dass die derzeit erwarteten (aber nie bestätigten) Gesamtkosten für das ausser
Kontrolle geratene Vorhaben nicht bei 150 Millionen, sondern bei rund 400
Millionen Franken lägen. Die Betriebskosten werden, je nach Quelle, auf 10 bis
30 Millionen Franken jährlich beziffert. Die Zahlen werden dem Steuerzahler
aus Gründen der Geheimhaltung verschwiegen.
Genaue Beträge will auch die spät auf den delikaten Fall aufmerksam ge-
wordene Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) nicht nennen. Sie monierte in-
des in ihrem Jahresbericht 2003 erstmals, «das die geschätzten Kosten, die dem
Entscheid des Bundesrates zugrunde gelegt wurden, zu wenig fundiert waren
beziehungsweise ungenügende Hinweise auf Unsicherheiten und Risiken ge-
13
macht wurden». Mit der Abwicklung des Projektes über drei verschiedene Bud-
getrubriken werde zudem die finanzielle Transparenz eingeschränkt. Mehr hat
die zahlende Öffendichkeit bisher nicht vernommen. Offensichtlich ist das Pro-
jekt Satos-Onyx den internen Revisoren bereits definitiv entglitten.
Denn auch die Finanzdelegation des Parlaments, die sich am 1. April 2004
zum Problem äusserte, erklärte sich für überfordert. Sie «erkannte am Beispiel
von Satos gewisse Schwächen bei der Bewilligung von Krediten bei Projekten,
bei denen ein Geheimhaltungsbedürfnis besteht und bei denen aus diesem
Grund den parlamentarischen Organen und der Öffentlichkeit nicht die sonst
üblichen Informationen gegeben werden können». Resignierend stellte sie
fest, dass sie bei der Kontrolle «dieses schwierigen Projekts» an ihre Grenze
stosse: «Kreditteile sind aber verstreut in verschiedenen Krediten, was von den
Finanzaufsichtsorganen einen speziellen Effort verlangt, um sich einen Uber-
blick zu verschaffen». Die skeptisch gewordenen Oberaufseher versprachen,
später «auch Fragen über das Verhältnis von Aufwand und Ertrag bei Onyx zu
thematisieren».
Zwischenzeidich aber werden über verdeckte Zusatz- und Ergänzungskre-
dite laufend Dutzende von Millionen Franken für Onyx abgezweigt, und zwar
weiterhin so, «dass sie nicht ohne weiteres von jeder Person in Erfahrung ge-
bracht werden können», wie der Bundesrat die wiederholte Irreführung von
Parlament und Öffendichkeit erst kürzlich wieder begründete.
Konsequent hat das Verteidigungsdepartement darum per 2005 im Sammel-
kredit Projektierung, Erprobung undVorbereitung von Rüstungsbeschaffungen
(PEB) wieder zehn Millionen Franken versteckt, die der Weiterentwicklung der
Onyx-Technologie dienen, wie das VBS auf Nachfragen herausrückt. Der neue
Tarnbegriff stammt wie der Halbedelstein Onyx aus der Mineralogie und lau-
tet «Malachit». Ob unter diesem Namen das jetzige System erweitert, schon neu
konzipiert oder einfach anders verschleiert wird, muss offen bleiben.
Betrieben werden die geheimen Spionageanlagen von der Generalstabsab-
teilung «Elektronische Kriegsfuhrung (EFK)». Die Führungsunterstützungsbri-
gade 41 fuhrt Recherchieraufträge aller Art aus. Auftraggeber und Abnehmer ist
offiziell der Strategische Nachrichtendienst (SND), wie der militärische Aus-
landgeheimdienst nun heisst. Obwohl die rechdichen Grundlagen dazu fehlen,
wird die Einrichtung indes auch von zivilen Stellen genutzt, besonders vom
Dienst für Analyse und Prävention PAP), dem früher und klarer «Bundes-Po-
lizei» oder «Fichen-Polizei» genannten Inlandgeheimdienst, aber auch vom De-
partement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Die Bewilligungen erteilt,
ohne öffentliche Orientierung, der Bundesrat, der die grossen Onyx-Ohren
I 14