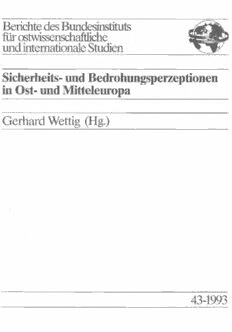Table Of ContentBerichte des Bundesinstituts
für ostwissenschafÜiche
und internationale Studien
Sicherheits- und Bedrohungsperzeptionen
in Ost- und Mitteleuropa
Gerhard Wettig (Hg.)
43-1993
Die Meinungen, die in den vom BUNDESINSTITUT FÜR
OSTWISSENSCHAFTLICHE UND INTERNATIONALE STUDIEN
herausgegebenen Veröffentlichungen geäußert werden, geben
ausschließlich die Auffassung der Autoren wieder.
© 1993 by Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und
internationale Studien, Köln
Abdruck und sonstige publizistische Nutzung - auch auszugsweise -
nur mit vorheriger Zustimmung des Bundesinstituts sowie mit Angabe
des Verfassers und der Quelle gestattet.
Bundesinstitut
für ostwissenschaftliche und internationale Studien
Lindenbornstraße 22, D-50823 Köln , Telefon 02 21/5747-0, Telefax 02 21/5747-110
Inhalt
Seite
Kurzfassung 1
Heinz Timmeimann:
Russische Föderation 5
Frank Umbach:
Belarus (Weißrußland) 12
Olga Alexandrova:
Ukraine 17
Dieter Bingen:
Polen 23
Vladimir Kusin:
Tschechische Republik 29
Vladimir Kusin:
Slowakei 33
Istvan Szönyi:
Ungarn 39
Gerhard Wettig:
Gesamtkonstellation 43
Summary 49
August 1993
Gerhard Wettig (Hg.)
Sicherheits- und Bedrohungsperzeptionen in Ost- und Mitteleuropa
Bericht des BlOst Nr. 43/1993
Kurzfassung
Der vorliegende Bericht befaßt sich mit den Perzeptionen - also den Wahrnehmungen und Vorstellun
gen - über die auswärtige Sicherheit des jeweiligen Landes, welche die an der politischen Meinungs
und/oder Entscheidungsbildung beteiligten Gruppen in der Russischen Föderation, in Belarus, in der
Ukraine, in Polen, in der Tschechischen Republik, in der Slowakei und in Ungarn hegen. Dabei wird
Sicherheit nicht ausschließlich in militärischem Sinne verstanden; auch andere, oft schwer faßbare
Momente der Existenzbedrohung werden berücksichtigt, soweit sie in dem Bewußtsein der Beteiligten
eine wesentliche Rolle spielen.
Die Ergebnisse der im vorliegenden Bericht zusammengefaßten Einzelstudien (die aus Gründen der
Umfangbegrenzung nur die allerwichtigsten Gesichtspunkte zur Darstellung bringen können) lauten
wie folgt:
1. Ungeachtet des Umstandes, daß nach dem Ende des Kalten Krieges viele bisher vernachlässigte
nicht-militärische Probleme zutage getreten sind, haben in Ost- und Mitteleuropa auch gegenwärtig
die Sorgen um Wahrung der auswärtigen Sicherheit im traditionellen Sinne einen sehr hohen Stellen
wert. Zusammen mit den Sorgen um wirtschaftliche Entwicklung und soziale Stabilisierung bestim
men sie primär das Sicherheitsdenken; andere Gesichtspunkte treten in der Regel dahinter zurück.
2. In der Russischen Föderation wird die Sicht der auswärtigen Beziehungen durch das Bewußtsein
bestimmt, daß mit der UdSSR zugleich das Imperium zerbrochen ist. Die Zahl derer, die in dem ein
getretenen Wandel vor allem eine Demokratisierungs-, Entwicklungs- und Modernisierungschance se
hen, hat sich stark verringert. Unter Altkadern wie Reformern nimmt die Tendenz zu, in der Be
schränkung des Staates auf die frühere russische (Teil-)Republik eine unerträgliche Niederlage zu se
hen und eine Restitution des früheren Imperiums auf die eine oder andere Weise zu fordern. Von die
ser Seite wird Jelzin mit seiner Führungsmannschaft heftiger Kritik und starkem Druck ausgesetzt,
was seine Wirkung auf die amtliche Außenpolitik nicht verfehlt. Zugleich hat sich eine imperial-revi-
sionistische Fundamentalopposition herausgebildet, deren Ziel der Sturz der "Verräter" an der Spitze
des Landes ist. Alle imperial-revisionistisch gesinnten Personen und Gruppen richten ihre Aufinerk-
samkeit vornehmlich auf das "nahe Ausland", d.h. auf die auf einst sowjetischem Boden entstandenen
Staaten, die sie als Zone exklusiv russischen Interesses betrachten und deren unabhängige Existenz
gleichbedeutend mit einer Bedrohung der russischen Seite erscheint.
3. Auch in Belarus stehen sich zwei Richtungen mit gegensätzlichen Orientierungs- und Wahrneh-
mungsmustem gegenüber. Die demokratisch-nationalen Kräfte und der sich als Zentrist verstehende
Präsident Schuschkjewitsch wollen die Unabhängigkeit des Landes gewährleistet sehen und daher ei
nen engen Zusammenschluß mit der Russischen Föderation, vor allem in militärischer Hinsicht, ver
meiden. Die Aussicht, daß in Moskau an die Stelle der Jelzin-Führung imperial-revisionistische
Machthaber treten könnten, ist bei diesen Gruppen Anlaß zu schwerer Sorge. Demgegenüber er
scheint den Wiedererstarkenden Kadern des früheren kommunistischen Regimes eine möglichst enge
Verbindung mit Rußland bis hin zur schließlichen Vereinigung als dringend erwünschte Garantie für
die innenpolitisch beanspruchte Position im Lande. Das auf dieser Basis hergestellte Einvernehmen
2
mit der Fundamentalopposition in Moskau ist sowohl für die innenpolitischen Gegner in Minsk als
auch für den russischen Präsidenten Jelzin Grund zur Sorge.
4. Innerhalb der GUS ist die Ukraine als der hauptsächliche Widerpart aller russischen Bestrebungen
hervorgetreten, diese Institution zu einer dauerhaften Klammer zu machen, welche die Mitgliedsstaa
ten aneinander und an Moskau binden würde. Aber nicht allein diese Ambitionen erscheinen aus der
Perspektive Kiews als Bedrohung der nationalen Existenz. Auf ukrainischer Seite wird mit noch grö
ßerer Sorge notiert, daß die Russische Föderation bisher eine unzweideutige Anerkennung der Gren
zen zur Ukraine hat vermissen lassen, daß der (von den Gegnern Jelzins beherrschte) russische Ober
ste Sowjet sogar offene Ansprüche auf die Krim erhebt, daß die von Moskau erzwungene Übertra
gung der gesamten Schwarzmeerflotte die ukrainische Unabhängigkeit negativ berührt, daß die amtli
cher Kontrolle weithin entglittene 14. russische Armee im Rücken der Ukraine ein russisches Staats
wesen auf moldovischem Boden protegiert usw. Die Kiewer Befürchtungen kulminieren darin, daß in
Moskau die Anti-Jelzin-Fundamentalopposition die Macht übernehmen könnte und daß man dann von
dieser Seite nicht allein mit den derzeit ausgeübten wirtschaftlichen und sonstigen Pressionen, sondern
auch mit massivem und direktem Gebrauch bewaffneter Gewalt zu rechnen hätte, so daß die bisher
noch grundsätzlich bestehende Basis für die Hoffnung auf ein Einvernehmen endgültig zerstört wäre.
Zugleich regen sich in Kiew - vor allem innerhalb des alten Establishments - immer deutlicher Kräfte,
die in einer Verbindung mit Rußland die bestmögliche Gewähr für die ukrainische Zukunft sehen.
Würde sich ein derartiger Kurs durchsetzen, wären ernst innerukrainische Konflikte, vor allem mit
der Westukraine, zu erwarten.
5. Für die Bedrohungswahrnehmungen im Binnenverhältnis zwischen den drei Nachfolgestaaten der
früheren UdSSR sind zwei Faktoren von herausragender Bedeutung: die wirtschaftliche Abhängig
keit, vor allem bezüglich der Ölversorgung, der beiden kleineren Länder von der russischen Födera
tion und das Vorhandensein von ehemals sowjetischen Kernwaffen und deren Trägersystemen auf
dem Territorium aller drei ostslawischen Staaten. In Belarus sehen auch die auf Unabhängigkeit be
dachten demokratisch-nationalen Kräfte keine Alternative zu einer auf Anpassung gerichteten Politik,
die der russischen Vorstellung eines Abzugs der Kernwaffen sowie einer wirtschaftlichen Union
Rechnung trägt. In der Ukraine ist eine gegenläufige Tendenzentwicklung zu beobachten: Während
sich die Vorbehalte gegenüber der anfänglich proklamierten Politik des nuklearmilitärischen Ver
zichts verbreiten, weil man in der Verfügung über Kernwaffen zunehmend ein politisches Gegenge
wicht gegen die befürchteten russischen Wiedereingliederungsversuche zu sehen beginnt, ist man in
Kiew angesichts der sich katastrophal auswirkenden Pressionen zunehmend zu wirtschaftlichen Zuge
ständnissen bereit. Zugleich fragt sich die ukrainische Führung, welche internationalen Möglichkeiten
sie besitzt, um die russische Bedrohung abzuwehren. Sie würde gern eine Ostsee-Schwarzmeer-Grup
pierung und einen möglichst engen Zusammenschluß mit EG und NATO erreichen und hegt zugleich
die Sorge, daß die westlichen Staaten den osteuropäischen Raum Rußland als Ordnungs- bzw. Herr
schaftsmacht überlassen könnten. Diese Ängste sind durch das westliche Verhalten angesichts des
serbischen Vorgehens im früheren Jugoslawien außerordentlich verstärkt worden.
6. In Polen besteht weiterhin Konsens darüber, daß das Land durch die Auflösung des Warschauer
Pakts erstmals die Basis für eine wirkliche Unabhängigkeit und damit auch für eine Sicherheit nach
außen gewonnen hat. Die anschließende Auflösung der UdSSR hat Polen zudem aus der einengenden
und zudem potentiell bedrohlichen Zwischenlage zwischen den beiden Großmächten Rußland und
Deutschland befreit. An der Aufrechterhaltung dieses Status quo hat die polnische Politik ein vitales
Interesse. Das hat zur Folge, daß man in Warschau, aller verschiedentlich bestehenden Differenzen
und Schwierigkeiten ungeachtet, ein möglichst gutes Verhältnis zu den Staaten auf dem Boden der
früheren Sowjetunion herzustellen sucht und in allen Bestrebungen Moskauer Kräfte zur Restitution
des einstigen Imperiums eine zumindest indirekte Bedrohung der polnischen Sicherheit sieht. Damit
3
verbindet sich die Sorge, daß für die imperial-revisionistischen Kräfte in Rußland auch die Wieder
herstellung einer mitteleuropäischen Einflußzone zu den längerfristig verfolgten Zielen gehören könn
te. Polen strebt unzweideutig zum Westen und sieht in einer möglichst engen Verbindung zur NATO,
die rasch in eine polnische Mitgliedschaft ausmünden sollte, eine unerläßliche Gewähr für ihre Si
cherheit. Zugleich wird eine Einbeziehung des Landes in die EG für notwendig gehalten.
7. Auch die Tschechische Republik und - angesichts des bisher noch nicht voll entwickelten außenpo
litischen Klärungsprozesse läßt sich das vorerst nur tentativ feststellen - weithin auch die Slowakei
sehen sich in einer "Zone verminderter Sicherheit", solange sie weder der NATO angehören dürfen
noch von dieser Sicherheitsgarantien erhalten. Deutlich ist auch, daß beide Länder, insbesondere aber
die Tschechische Republik, die Mitgliedschaft in der EG als Gewähr für die Partizipation am westeu
ropäischen Handel und an der westeuropäischen Entwicklung und als Möglichkeit der innen- wie
außenpolitischen Konsolidierung anstreben.
8. Auch in Ungarn ist das Gefühl stark, in eine "Zone verminderter Sicherheit" gestoßen worden zu
sein, solange die hier - ähnlich wie in Polen - besonders nachdrücklich angestrebte Bindung an die
NATO verwehrt wird. In Budapest herrscht darüber hinaus weithin das Bewußtsein, sich innerhalb
des mitteleuropäischen Raumes in einer ganz besonders exponierten Lage zu befinden: Die gefährdete
Lage der großen ungarischen Minderheiten in den Nachbarländern, vor allem in der Slowakei und
Rumänien, die das ganze Umfeld zumindest indirekt bedrohenden serbischen Aggressionskriege im
früheren Jugoslawien, die zunehmend sich andeutende Destabilisierung der Lage auf dem Balkan ins
gesamt, die Uneinigkeit und Untätigkeit der westlichen Staaten angesichts der Herausforderungen
südlich der ungarischen Grenzen und die Gefahren, denen Kroatien, die Ukraine und das Einverneh
men zwischen dem Westen und der Türkei ausgesetzt sind, bereiten der ungarischen Regierung unge
wöhnlich große Sorgen.
9. Wenn man den Blick auf Ost- und Mitteleuropa insgesamt richtet dann wird deutlich, daß die zwi
schenstaatlichen Beziehungen - außer druch zahlreiche Konflikte und damit zugleich Unsicherheiten
von lokalen und regionalem Charakter - vor allem durch die Probleme belastet sind, die sich aus dem
Zusammenbruch der beiden Vielvölkerreiche Sowjetunion und Jugoslawien ergeben. Die schwersten
Bedrohungen, die in den ost- und mitteleuropäischen Hauptstädten gesehen werden, hängen mit den
mehr oder weniger stark vorangetriebenen Bestrebungen von Führungsgruppen in den ehemaligen
Reichsvölkem zusammen, entweder die verlorengegangene Reichseinheit samt der eigenen Reichs
dominanz wiederherzustellen (wie es die Milosevic-Führung zunächst versuchte und wie es sich die
Moskauer Fundamentalopposition vorstellt) oder ersatzweise die eigene Ethnie und das eigene Terri
torium gewaltsam und auf Kosten der ehemaligen Reichsvölker auszudehnen, um auf diese eine
reichsähnliche zentrale Machtstellung zu gewinnen (wie es inzwischen Belgrader Politik ist). Vor
allem in Kiew, Warschau und Budapest wird befürchtet, daß das serbische Vorgehen nur der Auftakt
zu weiteren Aktionen und Entwicklungen dieser Art auf dem Balkan und zu Explosionen von noch
weit größerem Ausmaß in der früheren UdSSR ist, welche die Sicherheit in ganz Ost- und Mitteleuro
pa und vermutlich noch darüber hinaus illusorisch machen würden.
5
Russische Föderation
Aus einer Vielzahl von Gründen ist es gegenwärtig außerordentlich schwierig, die Perzeptionen der
auswärtigen Sicherheit zu umreißen, die sich bei den politischen Eliten Rußlands herausbilden. Auch
sind die Träger der jeweiligen Perzeptionen nicht eindeutig zu bestimmen - weder im Hinblick auf
ihre konkreten Positionen noch auf ihren Rückhalt in Bevölkerung, Institutionen und Apparaten. Die
zentrale Ursache für diese Unübersichtlichkeit liegt in folgendem Umstand: Anders als in den meisten
Staaten des Westens, in denen bei allen spezifischen Akzentsetzungen unter den verschiedenen poli
tischen Strömungen weitgehende Übereinstimmung in den Perzeptionen der auswärtigen Sicherheit
und über die daraus abzuleitende außen- und sicherheitspolitische Ausrichtung des Landes besteht,
gibt es einen solchen Grundkonsens in Rußland heute nicht.
Als wichtigste Denkschulen, Akteure und Einflußgruppen sind hier - bei mancherlei inhaltlichen und
personellen Überschneidungen - insbesondere drei Richtungen zu nennen: die gegenwärtig dominie
rende "europäisch-atlantische" Richtung, die "eurasische" Richtung und die "großrussisch-imperiale"
Richtung (mit ihren "national-patriotischen" und "national-bolschewistischen" Komponenten). Ihre je
weiligen Sicherheitsperzeptionen ergeben sich aus teilweise radikal unterschiedlichen Vorstellungen
zur zukünftigen Rolle Rußlands in der Welt und deren innerer Abstützung. Die dem Konflikt zugrun
de liegenden Kernfragen lassen sich auf drei Faktoren zurückführen (wobei die Vertreter der europä
isch-atlantischen Richtung der zuerst genannten, die Repräsentanten der großrussisch-imperialen und
der harten eurasischen Richtung der zweiten Lösung zuneigen): Soll Rußland seine Energie auf die
innere Entwicklung konzentrieren und seine Größe darin suchen, mit Unterstützung des Westens das
Land in Ökonomie, Ökologie, Infrastrukturen und sozialen Diensten auf ein höheres Niveau zu he
ben? Oder soll der Akzent wie zu Zaren- und Sowjetzeiten eher auf äußere Machtentfaltung gelegt
werden, wobei der Großmachtstatus gleichsam identitätsstiftend wirkt und die täglichen Sorgen der
Menschen in den Hintergrund drängt? Ferner: Soll Rußland die Unabhängigkeit der GUS-Staaten auf
Dauer akzeptieren und eine zivilisierte Regelung seines Verhältnisses zu ihnen anstreben? Oder soll
es versuchen, diese Länder über die Etappen von Wirtschaftsunion, kollektivem Sicherheitssystem
und konföderativen Strukturen schrittweise und mehr oder weniger gewaltsam wieder mit Rußland zu
vereinen? Und schließlich: Soll sich Rußland, ähnlich wie die Türkei nach dem Zerfall des Osmani-
schen Reiches, mit seiner neuen Rolle zufrieden geben, soll es sich als normale Nation verstehen?
Oder hat es eine spezifische "Mission" der Wiederherstellung von Imperium und Supermachtstatus zu
erfüllen? Es liegt auf der Hand: Die Divergenzen über die innere Ausgestaltung Rußlands und über
seine zukünftige Rolle in der Welt determiniert auch die Perzeption der äußeren Sicherheit der ver-
6
/
schiedenen Denkschulen und Einflußgruppen. Strömungen, die sich Rußland nur als Imperium mit
Supermachtstatus vorstellen können, unterscheiden sich in ihren Wahrnehmungen radikal von solchen
Gruppierungen, die das Land als normale Großmacht in die "zivilisierte Staatengemeinschaft" ein
bringen wollen.
Im Vergleich zu den Perzeptionen der auswärtigen Sicherheit, wie sie vor Wirksamwerden des "neuen
Denkens" in Moskau herrschten, hat die von Jelzin bestimmte Richtung einen einschneidenden Wan
del vollzogen. Es sind nicht länger die USA und das von ihnen angeführte westliche Bündnis, die als
Bedrohung für die äußere Sicherheit des Landes und für die Aufrechterhaltung seines Großmachtsta
tus wahrgenommen werden. Im Gegenteil: Bei allen Relativierungen, die seit der Anfang 1992 einge
leiteten Phase enger Anbindung an den Westen vorgenommen wurden, sieht die Jelzin-Führung den
Westen als Partner und sogar als strategischen "Verbündeten" bei der inneren Modernisierung sowie
bei der Gewährleistung der internationalen Stabilität. Aus dieser Einschätzung heraus hat sie im Au
gust 1993 schließlich sogar ihre Bedenken gegen eine von den Ostmitteleuropäern anvisierte Mitglied
schaft in der NATO aufgegeben.
Aus der Sicht Jelzins und seiner Anhänger sind es heute völlig neue Quellen, von denen die Bedrohun
gen für Sicherheit und Stabilität Rußlands ausgehen. Im Vordergrund stehen dabei für sie vier Pro
blemkomplexe: die multidimensionale innere Krise, dramatisch wachsende Instabilitäten im GUS-Be
reich, gravierende Mängel in den Außenwirtschaftsbeziehungen sowie Befürchtungen, durch die Bil
dung eines "Cordon sanitaire" an den Westgrenzen des Landes ähnlich wie nach dem Ersten Welt
krieg von Europa abgeschnitten zu werden. Bei dem Herangehen an diese Probleme ist einerseits
zwar die Tendenz zu beobachten, daß der weite Sicherheitsbegriff aufgrund aktueller Bedrohungs
wahrnehmungen von einem engeren, auf das Militärische reduzierten Sicherheitsverständnis in den
Hintergrund rückt. Dies geschieht insbesondere unter dem Eindruck der vielfach auf Rußland zurück
wirkenden, bis hin zu bewaffneten Konflikten eskalierenden Turbulenzen in einer Reihe von Staaten
der GUS. Andererseits jedoch geht die Jelzin-Führung grundsätzlich durchaus von einem erweiterten
Sicherheitsverständnis aus, wie die Hinweise auf die als bedrohlich wahrgenommene Krise im Innern
und in den Außenwirtschaftsbeziehungen unterstreichen. Dabei finden freilich die gravierenden ökolo
gischen Probleme - rund 18% des früheren sowjetischen Territoriums sind radioaktiv verseucht - we
nig Aufmerksamkeit.
Das Programm Jelzins zur Überwindung der als Bedrohung für die Sicherheit des Landes wahrge
nommenen Gefahren findet seinen prägnantesten Ausdruck in dem Streben nach "samostojatel'nost"'
(Unabhängigkeit, Selbständigkeit). Dieses Stichwort findet seit Herbst 1992 immer häufiger Einigung