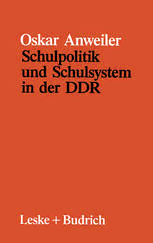Table Of ContentAnweiler, Schulpolitik und Schulsystem in der DDR
Oskar Anweiler
Schulpolitik und Schulsystem
in der DDR
+
Leske Budrich, Opladen 1988
Gedruckt mit Unterstützung der Stiftung Volkswagenwerk.
CIP-litelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Anweiler, Oskar:
Schulpolitik und Schulsystem in der DDR/Oskar Anweiler. -
Opladen: Leske u. Budrich, 1988
ISBN 978-3-8100-0734-6 ISBN 978-3-322-95525-8 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-95525-8
© 1988 by Leske + Budrich, Opladen
Satz: Leske + Budrich, Opladen
Vorwort
Der deutschen Pädagogik wird nicht gedient mit oberflächlicher Polemik, aber eine
gründliche, auf umfassender Sachkenntnis beruhende wissenschaftliche Diskussion,
die keineswegs vor politischen Tatsachen und prinzipiellen ideologischen Gegensätzen
zurückschrecken darf, halten wir für unbedingt notwendig.
(Päd, 12.Jg., 1957, H. 1, S. 4)
Diese vor über dreißig Jahren in der DDR-Zeitschrift "Pädagogik" getroffene Fest
stellung hat nichts an Aktualität eingebüßt. Sie kennzeichnet auch die Position des Ver
fassers. Leider finden die erwünschten wissenschaftlichen Diskussionen immer noch
zu selten im direkten Gespräch oder im öffentlichen Meinungsaustausch statt. Dort, wo
sie wieder beginnen, müssen sie tatsächlich auf umfassender Sachkenntnis beruhen und
dürfen nichts beschönigen oder verschweigen. Dialogbereitschaft setzt die Maßstäbe
wissenschaftlicher Erkenntnis voraus und nicht außer Kraft.
Die hier vorgelegte Darstellung der Schulpolitik und des Schulsystems in der Deut
schen Demokratischen Republik wendet sich nicht in erster Linie an die Spezialisten der
Bildungsgeschichte, der Vergleichenden Erziehungswissenschaft oder der DDR
Forschung, sondern an Leser, besonders auch an Studenten, denen der Gegenstand erst
erschlossen werden soll. Die Ergebnisse der Forschung wurden verarbeitet mit dem
Ziel, grundlegende Informationen über die wichtigsten Sachverhalte mit einer
Problemanalyse zu verbinden. Die seit über zwanzig Jahren zu diesem Thema in Vorle
sungen und Seminaren gewonnenen Erfahrungen und Anregungen sowie Resultate eige
ner früherer Untersuchungen sind ebenfalls darin eingegangen.
Ich danke der Stiftung Volkswagenwerk, daß sie es durch die Gewährung eines Aka
demiestipendiums ermöglicht hat, die Arbeiten an dem Buchmanuskript abzuschließen
und die Drucklegung unterstützt hat.
Bochum, Januar 1988 Oskar Anweiler
5
Inhalt
Vorwort ..............................................•........................................ 5
1. Einleitung ..................................... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1 Gesichtspunkte für ein Studium des Schulwesens in der DDR ........... ..... 9
1.2 Methodische Probleme und Forschungsstand ..................................... 12
2. Grundzüge der Schulpolitik und Schulentwicklung seit 1945 .............. 19
2.1 Fragen der Periodisierung ........................................................... 19
2.2 Ausgangssituation und Schulreform von 1946 "'''''''''''''''''''''''''''''''''' 21
2.3 Die ideologische Okkupation der Schule ....... ........... ........................ 40
2.4 Polytechnische Bildung und sozialistische Schulreform. .... ........... ...... ... 58
2.5 Das "einheitliche sozialistische Bildungssystem" - Konzept, Realisierung
und Folgen ............................................................................. 79
2.6 Konsolidierung und Modernisierung - die Entwicklung bis zu den achtziger
Jahren ................................................................................... 107
3. Das Profil der sozialistischen Schule in der DDR am Ausgang der achtzi-
ger Jahre ............................................................................... 127
3.1 Statistischer Grundriß des Schulsystems .......................................... 127
3.2 Die innere Schulverfassung .......................................................... 134
3.3 Unterricht und Erziehung ............................................................ 148
3.4 Begabungsförderung .................................................................. 162
3.5 Schule und Berufswahl ............................................................... 177
Daten zur schulpolitischen Entwicklung in der DDR ................................. 191
Abkürzungsverzeichnis ..................................................................... 193
Auswahlbibliographie ....................................................................... 195
7
1. Einleitung
1.1 Gesichtspunkte jUr ein Studium des Schulwesens in der DDR
Die als Folge des Zweiten Weltkrieges vollzogene staatliche Teilung Deutschlands ist
auch für die Betrachtung der Schulentwicklung in der Deutschen Demokratischen Re
publik von grundlegender Bedeutung. Im Unterschied zu wissenschaftlichen Analysen
anderer Bildungssysteme haben wir es bei der Behandlung der DDR insofern mit einem
Sonderfall zu tun, als
- die gemeinsame geschichtliche Vergangenheit und die fortbestehende sprachlich
kulturelle Gemeinsamkeit eine größere geistige Nähe bedingen,
- im Gegensatz dazu jedoch die politisch-ideologischen Systemunterschiede mitten in
Deutschland häufig eine gegenseitige Entfremdung bewirken.
Beide Momente beeinflussen in starkem Maße den "deutsch-deutschen" Vergleich.
Es ist zwar nicht unsere Aufgabe und Absicht, einen Vergleich des Schulwesens in
beiden deutschen St&aten vorzunehmen, aber es liegt auf der Hand, daß ein "impliziter
Vergleich" nicht ausgeschlossen werden kann. Es gehört zu den Besonderheiten der Be
schäftigung mit einem anderen als dem eigenen Bildungssystem, daß bestimmte Proble
me aus dem eigenen Erfahrungszilsammenhang den Anstoß zum "Blick über die Gren
zen" geben können, wie umgekehrt die woanders ermittelten Sachverhalte auf die
eigene Situation bezogen werden. Im Falle der DDR liegt das aus den genannten Grün
den besonders nahe.
Wenn wir dieses praktisch-politische Erkenntnisinteresse für ein Studium der Schule
in der DDR betonen, so heißt das nicht, daß eine Beschäftigung mit den dortigen päd
agogischen Entwicklungen allein aus einer deutschen Perspektive, sei sie historisch
oder aktuell, erfolgen kann. Die Bildungspolitik in der DDR ist ähnlich wie diejenige
anderer moderner Staaten mit Problemen konfrontiert, die sich aus der Dynamik der
wirtschaftlichen und technischen Entwicklung, aus den Bildungsbedürfnissen der Be
völkerung oder aus veränderten ideellen Werten ergeben, z.B. mit
- der Spannung zwischen Breiten-und Spitzenf6rderung,
- dem optimalen Verhältnis von allgemeiner schulischer Grundbildung und beruflich-
fachlicher Ausbildung,
- dem Problem einer nicht zu übersehenden Entfremdung vieler Jugendlicher von der
geltenden gesellschaftlichen und politischen Ordnung,
um drei ganz verschiedene Beispiele zu nennen.
Ein Studium des Schulwesens in der DDR muß daher neben dem zuerst genannten be
sonderen deutschen Blickwinkel den übergreifenden Zusammenhang moderner Bil-
9
dungsprobleme berücksichtigen, die in der DDR auf eigene Weise zu lösen versucht
werden: der deutsche Aspekt muß durch einen internationalen ergänzt werden.
Es muß aber noch ein dritter Gesichtspunkt genannt werden, den man als einen
theoretisch-systematischen bezeichnen kann. Die Beschäftigung mit dem Schulwesen in
der DDR kann sich auch von der Frage leiten lassen, welchen Beitrag die dort gemach
ten Erfahrungen zu einer allgemeinen Klärung pädagogischer Sachverhalte leisten kön
nen, etwa zu folgenden:
- zur inhaltlichen Bestimmung und formalen Struktur des Begriffs der "Allgemeinbil
dung",
- zum Konzept eines "erziehenden Unterrichts",
- zu einer Schultheorie, welche die Schule als einen "eigenständigen Lebensraum" für
Kinder und Jugendliche definiert,
um wiederum nur drei Beispiele zu nennen.
Bei einer solchen systematischen Absicht dient das Studium der DDR-Schule in erster
Linie dazu, anhand der dabei gewonnenen Erkenntnisse zu theoretischen Generalisie
rungen zu gelangen; die konkreten historischen Zusammenhänge und die besonderen
Ausprägungen treten demgegenüber zurück.
Die drei hier unterschiedenen Gesichtspunkte - der spezifisch deutsche, der interna
tionale und der theoretisch/systematische - lassen sich nicht scharf voneinander tren
nen. Bei der folgenden Darstellung und bei der Auswahl bestimmter Probleme spielte
die Tatsache eine wichtige Rolle, daß es sich bei der Schule in der DDR um eine in der
deutschen Schulgeschichte verankerte Institution handelt, die auch Jahrzehnte nach der
deutschen Teilung diese historische Verwurzelung nicht verleugnen kann und will. Zum
andern bildet die Zugehörigkeit der DDR zum "sozialistischen Staatensystem" auch für
die Bildungspolitik und die Gestaltung des Schulwesens einen stets vorhandenen, wenn
auch im einzelnen unterschiedlich starken Einflußfaktor, und zwar nicht nur in der ideo
logischen Legitimationssphäre, sondern auch in praktischer Hinsicht. Im offiziellen
Selbstverständnis gilt das heutige Schulwesen in der DDR als Erbe aller "fortschrittli
chen pädagogischen Ideen" der Vergangenheit und als Glied eines noch in der Entwick
lung befindlichen "sozialistischen Weltsystems der Pädagogik", dem alle Staaten zuge
rechnet werden, in denen kommunistische Parteien an der Macht sind. Die Frage nach
den jeweiligen "nationalen Besonderheiten" im Rahmen "allgemeiner sozialistischer
Gesetzmäßigkeiten" dient dabei einer historischen Ortsbestimmung der Schule und
Pädagogik in der DDR und zugleich ihrer Abgrenzung gegenüber der "imperialisti
schen Pädagogik", die an der Westgrenze der DDR beginnt. In unserer Darstellung
I
werden beide Gesichtspunkte zu berücksichtigen sein: die Schule in der DDR als ein
Teil der deutschen Schulentwicklung und gleichzeitig als Glied sozialistischer Bildungs
systeme.
Der schon erwähnte systematische Gesichtspunkt beim Studium des Schulwesens in
der DDR gehört in den Zusammenhang einer Theorie des Bildungswesens und einer
Theorie der Schule. Beides muß voneinander abgehoben werden, auch wenn die Gren
zen fließend sind und in der Fachliteratur nicht immer deutlich gezogen werden. Verein
facht ausgedrückt, behandeln wissenschaftliche Arbeiten zur Theorie des Bildungswe
sens die gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Bedingungen, die rechtli-
10
chen und organisatorischen Formen sowie die verschiedenen Funktionen des Bil
dungswesens als einer in sich differenzierten Institution, während eine Theorie der Schule
vor allem auf den "pädagogischen Kern" abzielt, also auf Lern-und Erziehungsprozesse,
Lehrinhalte und Curricula, Lehrer-Schüler-Interaktionen innerhalb des institutionellen
Rahmens der Schule. Die Vielzahl konkurrierender schultheoretischer Ansätze in der
Bundesrepublik Deutschland2 kontrastiert auffullend mit dem Fehlen einer expliziten
Theorie der Schule in der DDR. Das dürfte wissenschaftsimmanente, aber auch gesell
schaftspolitische Gründe haben, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden
soll; jedenfalls fehlt bisher die Möglichkeit, eine spezifische "sozialistische Schultheo
rie" bei der Analyse des Schulwesens in der DDR heranzuziehen. Für eine sozialistische
Theorie des Bildungswesens liegen zumindest bildungssoziologische Ansätze vor. 3
Die folgende Darstellung sucht die Mitte zu halten zwischen der Behandlung des
Schulwesens als einer gesamtstaatlichen Institution und der Untersuchung bestimmter
schulpädagogischer Probleme, wie sie in der einzelnen Schule auftreten. Sie legt den
Nachdruck auf die Schulpolitik, d.h. auf die politische Gestaltung des Schulwesens im
ganzen, und stellt das Schulsystem dar, aber nicht nur in seinem formalen Aufbau, son
dern auch in den dort ablaufenden Prozessen; diese wiederum spielen sich auf ver
schiedenen Ebenen, bis zur konkreten Einzelschule, und eingebettet in verschiedene au
ßerschulische Zusammenhänge ab. "Systeme" der Bildung und Erziehung bilden nur
den Rahmen für Prozesse, sie sind keine statischen Größen, und es wäre falsch anzuneh
men, daß das Schulsystem der DDR davon eine Ausnahme machte.4
Der Ausdruck "Schulsystem" wird hier synonym mit "Schulwesen" gebraucht, weil
mögliche terminologische Unterschiede, die sich aus Anleihen bei der Systemtheorie
ergeben könnten, für unseren Zweck ohne Bedeutung sind. Ähnlich verfahren wir bei
der Verwendung der Ausdrücke "Bildungssystem" und "Bildungswesen': Der Sprach
gebrauch ist sowohl international als auch national - in bei den deutschen Staaten -
nicht einheitlich, und alle Versuche, zu Standardisierungen zu kommen, sind bisher we
nig erfolgreich geblieben. In der DDR spricht man seit 1965 vom "einheitlichen soziali
stischen Bildungssystem" als der Gesamtheit (nahezu) aller staatlichen Bildungsein
richtungen, sogar unter Einschluß kultureller Einrichtungen; dadurch soll auch der
Eindruck der planmäßigen Organisation, der Geschlossenheit und funktionalen Ab
stimmung erweckt werden. Gleichzeitig wird aber der Ausdruck "Volksbildungswesen"
oder synonym "System der Volksbildung" in einem eingeschränkten Sinne, nämlich für
das allgemeinbildende Schulwesen, die Kindergärten, die Volkshochschulen und die
Lehrerbildung, verwendet; davon unterschieden wird das "System der Berufsbildung"
sowie das Hoch- und Fachschulwesen. Diese Dreiteilung ergibt sich aus der entspre
chenden Aufteilung in drei Verwaltungsressorts und hat, wie der Ausdruck "Volksbil
dung" zeigt, darüber hinaus auch historische Wurzeln allgemeiner Art.
Die vorliegende Darstellung behandelt im wesentlichen das allgemeinbildende Schul
wesen, welches den Kern des Bildungssystems ausmacht, aber sie berücksichtigt auch
die Beziehungen der allgemeinbildenden Schule zur vorgelagerten Vorschulerziehung
und den anschließenden Bildungsbereichen, besonders zur beruflichen Ausbildung.
Dieser Konzentration auf einen, und zwar den grundlegenden Bereich des Bildungswe
sens liegt auch die Absicht zu Grunde, auf begrenztem Raum lieber mehr in die Tiefe
als in die Breite zu gehen, zumal das Bildungswesen in seiner Gesamtheit in dem Hand
buch von Dietmar Waterkamp im Überblick dargestellt worden ist. 5
11
Anmerkungen zu Kap. 1.1
Vgl. Wolfgang Zähle: Hauptetappen der internationalen Entwicklung der sozialistischen Schule.
In: Vergleichende Pädagogik 21(1985), S. 199-202. - Günther Gräfe: Analyse und Wertung in der
auslandspädagogischen Sozialismusforschung. In: Päd For 26(1985), H. 5, S. 28-38.
2 Vgl. Klaus-Jürgen Tillmann (Hrsg.): Schultheorien. Hamburg 1987. -Karl Sauer: Einführung in
die Theorie der Schule. Darmstadt 1981.
3 Artur Meier: Soziologie des Bildungswesens. Eine Einführung. Berlin 1974.
4 Vgl. Jan Szczepanski: Oswiata - system czy dramat? (Das Bildungswesen - System oder Drama?).
In: Procesy samoregulacji w oswiacie (Prozesse der Selbstregulierung im Bildungswesen). Hrsg.
von Mieczysiaw Pc;cherski und Jerzy Thdrej. Warszawa 1983, S. 99-106.
5 Dietmar Waterkamp: Handbuch zum Bildungswesen der DDR. Berlin 1987.
1. 2 Methodische Probleme und Forschungsstand
Aus politischen Gründen wird Besuchern aus der Bundesrepublik Deutschland und dem
Ausland der unmittelbare Zugang und ein Einblick in das Schulwesen der DDR er
schwert oder ganz verwehrt; systematisch angelegte "Feldstudien" unabhängiger
Wissenschaftler, die sich mit dem Bildungssystem der DDR beschäftigen, können nicht
unternommen werden. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Schulwesen der
DDR ist daher so gut wie ausschließlich auf schriftliche Quellen verschiedener Art an
gewiesen: bildungspolitische Verlautbarungen, Schulgesetze und -verordnungen, Lehr
pläne, methodische Handbücher und Schulbücher, wissenschaftliche Abhandlungen,
Praxisberichte, statistische Daten. Nicht alle Quellen sind gleichermaßen zugänglich.
So unterliegen z.B. die Ergebnisse empirischer Forschungen erheblichen Veröffentli
chungsbeschränkungen, oder es sind bestimmte Berichtsreihen nur für einen begrenz
ten Personenkreis bestimmt. Bei der Veröffentlichung statistischer Daten aus dem Bil
dungswesen gibt es ebenfalls erhebliche Lücken; so werden z.B. schon seit 1967 keine
Zahlen mehr über die soziale Herkunft der Hoch-und Fachschulstudenten in den Stati
stischen Jahrbüchern mitgeteilt, oder es werden in den einschlägigen Publikationen nur
vage Angaben über die Schülerzahl an den verschiedenen Spezialschulen und -klassen,
die der Begabtenförderung dienen, gemacht. Solche Beispiele ließen sich vermehren.
Die skizzierte Quellenproblematik hat dazu geführt, daß seit einigen Jahren in zuneh
mendem Maße auch die Belletristik, der Spielfilm und das Fernsehen, die relativ häufig
Erziehungs- und Schulprobleme behandeln, als "Quelle" herangezogen werden. Hier
entstehen natürlich methodische Probleme anderer Art, die aus der Tatsache resultie
ren, daß erzählende Literatur oder Film ihren eigenen "Gesetzen" folgen und deshalb
nicht als "Abbildungen von Realitäten", sondern nur als "Indikatoren für Realitäten"
gewertet werden dürfen. Trotzdem ermöglichen solche Medien einen anschaulichen
I
Zugang zu Schulproblemen in der DDR, sie tragen vor allem zu einer differenzierten
Betrachtungsweise bei. Mündliche Informationen bei wechselseitigen Besuchen erfül
len ähnliche Funktionen, können aber nur sehr bedingt als wissenschaftlich verwertbare
Quelle betrachtet werden.
Auf einen anderen, oft übersehenen Umstand beim Umgang mit schriftlichen Quellen
aus der DDR muß ebenfalls hingewiesen werden: Wir haben es in den amtlichen Ver-
12
lautbarungen, aber auch in Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Gesellschaftswissen
schaften und bei anderen Textarten mit einer kontrollierten und gesteuerten Sprache zu
tun. Das hängt mit der staatlichen Zensur und mit der Selbstzensur der Autoren zusam
men. Die abstrahierende und verschleiernde Sprache der meisten offiziellen Dokumen
te beruht auch auf der Scheu, Meinungsgegensätze oder Konflikte nach außen dringen
zu lassen; dadurch kann der falsche Eindruck harmonischer Übereinstimmung oder ge
radliniger Folgerichtigkeit entstehen, der nicht der Wirklichkeit zu entsprechen
braucht. Es muß also eine "Dechiffrierung" bestimmter stereotyper Sprachmuster und
-wendungen vorgenommen werden, um zu dem Kern eines Problems vorzudringen; in
Jahrzehnten eingeübte ideologische Formeln haben für die Eingeweihten auch bestimm
te politische Signalwirkungen. Der Umgang mit Texten dieser Art verlangt deswegen
eine gewisse Vertrautheit mit den Problemen politischer Semantik. 2
Hinzu kommt der Bedeutungswandel wichtiger pädagogischer Begriffe, die zwar aus
der deutschen bildungsgeschichtlichen Überlieferung stammen, die aber - ähnlich wie
dies in der Bundesrepublik der Fall ist - durch neue Entwicklungen oder den Einfluß
ausländischer Vorbilder ihren Inhalt verändert haben. In der DDR kennt z. B. die Didak
tik nur den herkömmlichen Begriff des Lehrplans und nicht den des Curriculums, der
sich in der Bundesrepublik daneben eingebürgert hat; aus der sowjetischen Pädagogik
wurde der Begriff des Kollektivs und der Kollektiverziehung übernommen, der an die
Stelle der früheren "Gemeinschaftserziehung" trat. Eine völlige Verschiebung ergab
sich 1959, als die Bezeichnung "Oberschule" für die gesamte allgemeinbildende Schule
ab Klasse 1 eingeführt wurde; unterhalb der Oberschule existiert in der DDR kein ande
rer Schultyp. Hier lag die Absicht zugrunde, den alten Unterschied von "Volksschule"
und "Höherer Schule", der schon 1946 durch die Einführung des Einheitsschulmodells
beseitigt werden sollte, auch terminologisch endgültig aufzuheben.
Es war bisher von einigen methodischen Problemen die Rede, die sich aus dem Um
gang mit dem Quellenmaterial, der Verbindung pädagogischer Sachverhalte mit der po
litischen Ideologie und aus dem Begriffswandel ergeben. Die Beschäftigung mit dem
Schulwesen in der DDR wirft aber außerdem konzeptionelle Probleme auf, die wieder
um wissenschaftliche und politische Gründe haben. In der notwendigen Kürze soll hier
ebenfalls darauf eingegangen werden, um damit den wissenschaftlichen Diskussions
stand und die bisherigen Forschungsresultate zu charakterisieren. 3
Am Anfang der Beschäftigung mit Erziehungs-und Bildungsproblemen in der "So
wjetzone", wie die DDR noch bis in die sechziger Jahre meistens genannt wurde, durch
westdeutsche Autoren standen praktische Informationsbedürfnisse und politische Inter
essen. Das galt ähnlich auch für die Beobachtung der Entwicklung in anderen Lebens
bereichen, z.B. im Rechtswesen oder in der Wirtschaftsstruktur. Später hat man von ei
nem "vorwissenschaftlichen" Stadium der DDR-Forschung gesprochen und das starke
politische Engagement mancher ihrer Vertreter kritisiert. Letzteres beruhte z.T. auch
auf eigenen leidvollen Erfahrungen mit dem kommunistischen Regime in der
SBZ/DDR, und diese flossen in die Beurteilung mit ein. Aus dieser ersten Phase, den
fünfziger Jahren, stammen auch zwei konzeptionelle Modelle, mit deren Hilfe die Ent
wicklung in der SBZ/DDR, darunter auch im Bildungs- und Erziehungswesen, analy
siert wurde: dasjenige der "totalitären Erziehung" im Rahmen eines allgemeinen
Totalitarismus-Konzepts und die These einer "Sowjetisierung" des deutschen Bildungs-
13