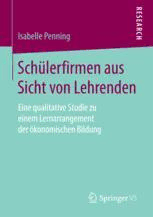Table Of ContentIsabelle Penning
Schülerfirmen aus
Sicht von Lehrenden
Eine qualitative Studie zu
einem Lernarrangement
der ökonomischen Bildung
Schülerfirmen aus Sicht von Lehrenden
Isabelle Penning
Schülerfirmen aus
Sicht von Lehrenden
Eine qualitative Studie zu
einem Lernarrangement
der ökonomischen Bildung
Isabelle Penning
Berlin, Deutschland
Dissertation, Technische Universität, Berlin, 2017 u. d. T. Schülerfirmen aus Sicht von
Lehrenden
ISBN 978-3-658-19665-3 ISBN 978-3-658-19666-0 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-19666-0
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Vorwort
Als ich im Rahmen meines Lehramtsstudiums das erste Mal von Schü-
lerfirmen erfuhr und ihre Arbeitsweise im Rahmen von Hospitationen ken-
nenlernen durfte, war ich fasziniert: Schulischer Unterricht kann anders
aussehen, als ich es in meiner eigenen Schullaufbahn erlebt habe, kann
von den Schülerinnen und Schülern maßgeblich mitbestimmt sein sowie
einen hohen Lebensweltbezug haben und zu einem veränderten Lehrer-
Schüler-Verhältnis führen. Diese Faszination hat viele Jahre angehalten
und so habe ich mein Forschungsfeld mit viel Enthusiasmus nach und
nach genauer erkundet. Meine Faszination für Schülerfirmen teilen offen-
bar viele Pädagoginnen und Pädagogen, was den deutlichen Auf-
schwung begründet, den Schülerfirmen in den letzten Jahrzehnten
erfahren haben. So stellte sich die Herausforderung, sowohl die rasanten
Entwicklungen als auch die Veröffentlichungen parallel zum Schreibpro-
zess in diese Arbeit aufzunehmen und dabei nicht den Fokus zu verlieren.
Leitgebend war für mich eine Irritation, die mich seit Jahren umgetrieben
hat, eine wahrgenommene Dissonanz zwischen den Versprechungen der
Schülerfirmen und deren Realität. Der offene Forschungszugang, der in
der Durchführung durchaus mit zahlreichen Herausforderungen verbun-
den war, erwies sich letztlich als ergiebige Fundgrube und meine Inter-
viewpartnerinnen und -partner führten mich durch ihre Offenheit und
Kooperationsbereitschaft zum eigentlichen Kernproblem: den zahlrei-
chen Widersprüchen, die mit der Methode Schülerfirma verbunden sind
und die es gilt individuell zu lösen. Den Lehrkräften, die sich dieser
schwierigen Herausforderung teilweise bereits seit Jahren und mit
verschiedenen Schülerfirmen immer wieder stellen, gilt mein größter
Respekt! Schülerfirmen gehören ganz klar zur „Kür“ der schulischen
Unterrichtsentwicklung (vgl. Meyer 2015, S. 97), bei denen Lehrkräfte mit
einem hohen Idealismus neue Erfahrungsräume ermöglichen, die sie
individuell ausgestalten.
VI Vorwort
„Wissenschaft muss kritisch sein können – auch wenn das nicht allen
gefällt“ (von Unger 2014, S. 29). Diese Prämisse ist für mich bei dieser
Arbeit leitgebend. Dennoch hoffe ich, dass insbesondere die Lehrkräfte
das Potenzial dieser Arbeit für ihre persönliche Praxis erkennen und ich
mich ihrer bereitwilligen Teilnahme am Forschungsvorhaben gegenüber
gerecht erweise, indem ich nicht nur die Hindernisse, sondern auch den
Wert der Unterrichtsmethode Schülerfirma darstelle. Jede Leserin und
jeder Leserin soll individuell, auf reflektierter Basis, entscheiden können,
inwieweit Schülerfirmen geeignet sind, die damit verbundene Zielstellung
zu verfolgen. Diese Arbeit kann dazu motivieren, das Konzept Schüler-
firma zu überdenken, anzupassen und zu relativieren, um die vielfach
überzogenen Ansprüche „eines Allheilmittels“ zu relativieren: Schülerfir-
men sind eine Unterrichtsmethode, die Potenzial aufweist, aber je nach
Schülerschaft und fachlicher Schwerpunktsetzung gezielt aufbereitet
werden muss, um einer Überfrachtung entgegenzuwirken. Nur so kann
verhindert werden, dass die Schülerfirmenarbeit ihren Herausforderun-
gen unterliegt und die durchaus produktive, jedoch fokussierte Arbeit in
Schülerfirmen zu „einstürzenden Neubauten“ (vgl. Meyer 2015, S. 150)
führt. Als Schlüsselpunkt sind die fachlichen Zielsetzungen in den Blick
zu nehmen, anhand derer Schülerfirmen als Unterrichtsmethode im
Fachunterricht ausgerichtet werden müssen.
Die vorliegende Dissertation ist an der Technischen Universität Berlin im
Institut für Berufliche Bildung und Arbeitslehre entstanden. Ein besonde-
rer Dank gilt meinen „Doktoreltern“ Frau Prof. Dr. Kirsten Lehmkuhl
(Technische Universität Berlin) und Herrn Prof. Dr. Ralf-Kiran Schulz
(Universität Kassel). Herr Schulz hat es geschafft, die pädagogischen
Prämissen der Schülerfirmenarbeit in die Betreuung der Doktorarbeit zu
überführen. Er begegnete meinem selbstbestimmten Lernprozess stets
mit Wertschätzung, war immer ein fachlich versierter Gesprächspartner
und gleichzeitig mein Modell eines professionell agierenden Wissen-
schaftlers.
Im Arbeitsprozess habe ich zahlreiche Weggefährten kennen und schät-
zen gelernt, die meine Arbeit durch fachliche Gespräche bereichert und
vorangebracht haben. Während viele hier ungenannt bleiben müssen,
Vorwort VII
möchte ich jedoch besonders Katja Svensson für den regelmäßigen Aus-
tausch und den Vertreterinnen des Berliner Fachnetzwerkes Schülerfir-
men für die interessanten Diskussionen sowie die offenen Einblicke in
ihre Arbeit danken.
Obwohl ich bemüht bin, Berufliches und Privates voneinander zu trennen,
muss ich einräumen, dass natürlich auch meine Familie, meine Freunde
und Bekannten immens zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.
Da ihr ja selbst wisst, welchen Beitrag ihr habt, verzichte ich darauf, euch
hier namentlich zu nennen, möchte euch jedoch herzlich danken: Ihr wart
mir nicht nur eine wichtige emotionale Stütze, sondern habt durch die ge-
meinsame Freizeitgestaltung dazu beigetragen, dass ich den Entste-
hungsprozess dieser Arbeit selten als belastend, sondern bis zum Ende
als bereichernd und faszinierend wahrgenommen habe.
Isabelle Penning, Berlin, 21.08.2017
Inhalt
Abbildungsverzeichnis ...................................................................... XIII
Tabellenverzeichnis ............................................................................XV
1 Einleitung ........................................................................................ 1
2 Das Lernarrangement Schülerfirma ............................................. 7
2.1 Begriffsexplikation ................................................................. 8
2.1.1 Begriffsklärung Schülerfirmen ........................................... 8
2.1.2 Verwandte und alternative Lernarrangements ................ 10
2.2 Gestaltungsmerkmale einer Schülerfirma ......................... 13
2.2.1 Rahmenbedingungen ...................................................... 13
2.2.2 Phasen der Schülerfirmenarbeit ...................................... 16
2.2.3 Rollenumschreibung der Beteiligten ................................ 28
2.3 Mit Schülerfirmen verbundene Zielsetzungen ................... 32
2.3.1 Schülerfirmen als Reaktion auf institutionelle Reformen . 34
2.3.2 Kompetenzerwerb in Schülerfirmen ................................ 36
2.3.3 Didaktische Konzepte ...................................................... 56
2.3.4 Qualitätsmaßstäbe für Schülerfirmen .............................. 84
3 Schülerfirmen als Simulationsmodell ...................................... 101
3.1 Modelltheorie....................................................................... 102
3.2 Lernen mithilfe eines Simulationsmodells ....................... 106
3.3 Wirtschaftsunternehmen als Bezugssystem ................... 111
3.3.1 Betriebswirtschaftliche Entwicklungen und
Perspektiven .................................................................. 112
3.3.2 Entwicklungsperspektiven für Schülerfirmen ................. 114
X Inhalt
4 Forschungsstand ....................................................................... 119
4.1 Qualitätssicherung durch empirische Studien ................ 120
4.1.1 Erhebung arbeitsrelevanter Basiskompetenzen
in Schülerfirmen ............................................................. 125
4.1.2 Bestandsaufnahme der Berliner Schülerfirmen ............ 127
4.1.3 Evaluationsstudie „Nachhaltige Schülerfirmen“............. 128
4.1.4 Forschungen zu Lern- und Übungsfirmen ..................... 131
4.1.5 Sozialwissenschaftliche Studien zu Schülerfirmen ....... 134
4.2 Zusammenfassung ............................................................. 137
5 Empirisches Design ................................................................... 139
5.1 Forschungsinteresse und -design .................................... 140
5.2 Erhebung ............................................................................. 147
5.2.1 Analyse des Samples und Hinweise zur Durchführung 148
5.2.2 Das narrative Interview als Erhebungsmethode............ 158
5.2.3 Design und Erläuterung des Erhebungsinstruments ..... 168
5.3 Auswertung: Dokumentarische Methode ......................... 172
5.3.1 Datenaufbereitung ......................................................... 173
5.3.2 Auswertungsverfahren ................................................... 176
5.3.3 Interpretationsschritte .................................................... 185
5.4 Qualitative Gütekriterien .................................................... 192
5.4.1 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit ............................... 194
5.4.2 Indikation des Forschungsprozesses ............................ 196
5.4.3 Empirische Verankerung ............................................... 197
5.4.4 Forschungsethik ............................................................ 198
6 Ergebnisse: Schülerfirmen aus Sicht von Lehrpersonen ..... 203
6.1 Wirtschaftlichkeit vs. Selbstständigkeit ........................... 207
6.1.1 „Safety first“ /„Profit first“ ................................................ 209
6.1.2 „Gratwanderer“ .............................................................. 218
6.1.3 „Selbstständigkeitsförderer/Supporter“ .......................... 224
6.1.4 Resümee Selbstständigkeitsförderung in
Schülerfirmen ................................................................ 227
6.2 Lehrer-Schüler-Interaktion ................................................. 230
Inhalt XI
6.2.1 Lehrkraft als zentraler Akteur ........................................ 232
6.2.2 Erweiterte Verantwortung der Lehrkraft ........................ 234
6.2.3 Gleichbleibende Rollenaspekte ..................................... 240
6.2.4 Partnerschaftliche Beziehung ........................................ 241
6.2.5 Lehrkraft als Begleiterin oder Begleiter ......................... 245
6.2.6 Resümee Lehrer-Schüler-Interaktion ............................ 248
6.3 Potenziale von Schülerfirmen ........................................... 250
6.3.1 Bedeutsamkeit von Schülerfirmen ................................. 251
6.3.2 Didaktische Prinzipien ................................................... 254
6.3.3 Kompetenzen und Lernziele .......................................... 268
6.3.4 Resümee Potenziale von Schülerfirmen ....................... 299
6.4 Entgrenzung von Schülerfirmen ....................................... 308
6.4.1 Unterrichtliche Entgrenzungen ...................................... 309
6.4.2 Alternative Schülerfirmenkonstruktionen ....................... 342
6.4.3 Resümee Entgrenzung .................................................. 359
7 Resümee ..................................................................................... 365
7.1 Zusammenfassung: subjektive Schülerfirmenkonzepte. 367
7.2 Vergleich zur fachdidaktischen Methodenkonstruktion . 374
7.3 Fachdidaktische Implikationen ......................................... 384
7.4 Qualität der qualitativen Forschung ................................. 391
8 Ausblick ...................................................................................... 397
9 Literaturverzeichnis ................................................................... 401
Anhang ............................................................................................... 427
Anschreiben Lehrpersonen .......................................................... 427
Interviewleitfäden .......................................................................... 430
Lehrkräfte mit Schülerfirmenerfahrung ........................................ 430
Interviewpartner ohne Schülerfirmenerfahrung ........................... 434
Interviewprotokollbogen ............................................................... 438