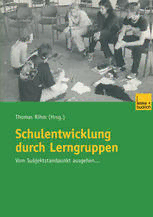Table Of ContentSchulentwicklung durch Lerngruppen
Thomas Rihm (Hrsg.)
Schulentwicklung
durch Lemgruppen
Vom Subjektstandpunkt
ausgehen ...
Leske + Budrich, Opladen 2003
Gedruckt auf säurefreiem und alterungs beständigem Papier.
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz ftir die Publikation ist bei Der Deutschen Bibliothek erhältlich
ISBN 978-3-8100-3631-5 ISBN 978-3-322-97577-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-97577-5
© 2003 Leske + Budrich, Opladen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung au
ßerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages un
zulässig und strafbar. Das gilt insbesondere rur VervielfaItigungen, Übersetzungen, Mikro
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung ..................................................................................... 7
Standort
Ute Osterkamp & Lorenz Huck
Überlegungen zum Problem sozialer Selbstverständigung und
bewusster Lebensführung ..................................................................... 23
RolfPrim
Schülersubjekt und Schulorganisation ................................................ 39
Ulrich Oevermann
Zur Behinderung pädagogischer Arbeitsbündnisse
durch die gesetzliche Schulpflicht ....................................................... 69
Bausteine
Erich Wuljf & Thomas Rihm
Sinnkonstitution in Bedeutungen: Wie kommt das Subjekt zur Welt? 97
Alfred Holzbrecher
Schüleraktivitäten und Lehrerprofessionalität als Arbeit am Habitus 111
Amd Hofmeister
Perspektiven und Probleme eines subjektwissenschaftlichen
Bildungsbegriffs ................................................................................. 121
5
Reimer Kornmann
Aufgaben und Ansatzpunkte subjektbezogener Diagnostik
im pädagogischen Prozess .............................................................. 135
Kar/-Heinz Braun
Ziele institutioneller Entwicklung der Schule
in der ,zweiten Modeme' ................................................................. 153
Erste Schritte
Am Ende anfangen ...
Wolfgang Rauch
End- und Ausgangspunkte
in einem Meer gewaltiger Anstrengungen
- Gewalterfahrungen in einer Schule (fur Erziehungshilfe) .............. 185
K/aus Winke/mann
Erkan - Lernen aus Betroffenheit ..................................................... 203
Das Lern-Lehr-Verhältnis neu bestimmen. ..
Sabine Knauer
Zur (Wieder-)Entdeckung der Lehrer als Subjekte
- Subjektiv-wissenschaftliches Plädoyer fur einen Tabubruch .......... 217
lngrid Dietrich
Interkulturelle Begegnungen als Anlässe fur pädagogische
Professionalisierungsprozesse .......................................................... 233
ThomasRihm
Vom Vorrang der Schülerinteressen ...
- Anmerkungen zur subjekttheoretischen Grundlegung
von Lemgruppenprozessen. . ......................................................... 251
Thomas H. Häcker
Selbstbestimmte Lernverträge
als konstitutiver Teil von Portfolioarbeit:
Lern-Lehr-Vorhaben jenseits von Belehrung und Angebot ............... 283
6
Fachwissenschaftliche Aspekte berücksichtigen ...
Norbert Kruse
Schreiben und Schreibnorm
- Überlegungen zu einer subjektwissenschaftlichen Perspektive
beim Textschreiben und Rechtschreiben in der Schule ..................... 297
Christoph Seifer
Andersartigkeit erfahren - Produktivität ermöglichen!
- Für einen Perspektivwechsel im Mathematikunterricht .................. 315
Die Aktivitäten der Lerngruppen vernetzen ...
Katrin Reinhardt
Jugendkonferenz: Ein pädagogischer Ort
klassenübergreifender Entwicklung von Schulprozessen .................. 335
Zuspitzung
ThomasRihm
Schule als Ort kooperativer Selbstverständigung entwickeln
- Ein Beitrag zur Schulentwicklung aus subjekttheoretischer Sicht 351
AutorInnenverzeichnis ............................................................... 387
Stichwortregister. ............................................................................. 391
7
Denn das Reale enthält in seinem Sein
die Möglichkeit eines Seins wie Utopie,
das es gewiss noch nicht gibt,
doch es gibt den fundierten, fundierbaren
Vor-Schein davon.
Ernst Bloch
Einleitung
1. Im Schatten des PISA-Turms• ..
Schulen nach "Pisa" - Schock
Kultusminister für radikalen Umbau
Eisenach (dpa). Die Kultusminister der Länder wollen nach dem
,,Pisa" - Schock die deutschen Schulen nun doch radikaler verän
dern als ursprünglich geplant. Nach der SPD legten auch die Schul
minister von CDU und CSU der Kultusministerlconferenz (KMK) in
Eisenach überraschend ein umfassendes Maßnalunenpaket zur Ver
besserung der Schulqualität vor. Es sieht Abschlussprüfungen in
allen Schularten und zuvor regelmäßige Orientierungsarbeiten in al
len Schularten und bundesweite Tests vor.
Die Grundlage dafm bilden einheitliche ,,Bildungsstandards" in
den wichtigen Kernfächern Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen
und Naturwissenschaften, auf deren Inhalte sich die unionsgeführ
ten Länder intern in einjähriger Arbeit bereits verständigt hatten,
hieß es. Bayerns Schulministerin Monika Hohlmeier (CSU) sagte,
mit diesen Standards seien "unverzichtbare Kompetenzen" und ein
klar "festgelegtes Grundwissen" beschrieben. Dieses müssten die
Schüler am Ende eines Bildungsabschnitts beherrschen.
Badische Neueste Nachrichten, 24.5.2002
Schockzustände haben ja auch ihr Gutes. In der Regel führen sie bei den Betrof
fenen nach einer Zeit der Genesung dazu, die Schockerfahrungen zu nutzen, um
ihr bisheriges Handeln grundlegend zu überdenken und einschneidende Konse
quenzen für die Zukunft zu ziehen. Inwieweit die dann schrittweise einsetzen
den Handlungsvornahmen tatsächlich eine heilsame Wirkung zeigen, hängt un
ter anderem auch davon ab, auf welcher analytischen Grundlage diese basieren.
So sehen die hier zitierten Kultusminister (erneut) den Grund für das mittelmä
ßige Abschneiden der deutschen SchülerInnen wohl im Mangel an bundesweit
vergleichbaren Leistungskontrollen. Folglich werden verbindliche überregionale
Bildungsstandards und Kompetenzinventare beschlossen, durch die die Schul
artprofile geschärft werden sollen. Im anderen politischen Lager wird (erneut)
der Bedarf an einer flächendeckenden Einrichtung von Ganztagesschulen aus
den Ergebnissen abgeleitet, um die Hausaufgabensituation zu verbessern, die
11
Betreuung der Kinder und Jugendlichen sicherzustellen, und darüber, soziale
Ungleichheiten effektiver abbauen zu können. Alter Wein in neuen Schläuchen?
Jedenfalls sind dies erste, womöglich vorschnelle Antworten auf das mittlerwei
le zum Monolith erhobene PISA-Testgebäude.
Jede Analysetätigkeit, und das ist nun auch ein Faktmn, deckt immer nur ei
nen spezifischen Blickwinkel bzw. Fokus ab, aus dem sich wiederum nur ganz
bestimmte erkenntnisleitende Interessen ableiten. Übersetzt für unseren Zusam
menhang bedeutet dies: Im ,mainstream' der derzeitigen PISA-Debatte wird je
nach Standpunkt der Interessensgruppen der Lichtkegel auf je ,genehme' Aus
schnitte der Realität geworfen und werden gleichzeitig je ,unangenehme' As
pekte ausgeblendet. Am Wenigsten aber kommen die zu Wort, um die es eigent
lich geht. Es wird zwar stellvertretend über die SchülerInnen verhandelt, die
SchülerInnen selbst haben aber keinen Einfluss auf die Entscheidungen. Bleibt
man diesem Widerspruch auf der Spur, so rücken wiederum Strukturfragen aus
dem Diskussionsschatten heraus, die die Schule als Institution seit ihrer ,Erfin
dung' begleiten und doch unausgesprochen tradiert werden: Schule soll einer
seits Unterschiede herstellen, andererseits aber auch Unterschiede beseitigen;
um dies wiederum sicherstellen zu können, bedarf es einer entsprechenden insti
tutionellen Anordnung. Zwangsverpflichtet zum Schulbesuch) und gleichzeitig
ausgeschlossen von zentralen Entscheidungen bleibt den Lernenden nur der Zu
schauerstatus.
Über diesen Befund gerät nun die PISA-Studie selbst ins Blickfeld. Wird
womöglich die Studie zur Lichtgestalt erhoben, weil sie den vorgegebenen radi
kalen Umbau gar nicht erfordert? Legt sie etwa den Gedanken nahe, dass eine
Überarbeitung bestehender institutioneller Verhältnisse ausreicht, um internatio
nal wieder mithalten zu können? Hilft das Test-Gebäude möglicherweise mit,
querliegende Aspekte, die mit dem Grundverhältnis der Lernenden zu ihrer Welt
zusammenhängen, im Schatten der Schulentwicklungsdiskussion zu belassen?
Und was, wenn sich Schiefes in der Bildungslandschaft über die aus den Ergeb
nissen naheliegenden Folgerungen (Bildungsstandards, Kompetenzinventare,
Ganztagesbetreuung etc.) nicht einfach gerade rücken lässt2? Sollte dann tat
sächlich "nach Pisa, vor Pisa" sein, wie die Zeit (27/ 2(02) titelte?
Diesen Verweisungszusammenhängen auf die Spur zu kommen, nimmt sich
der vorliegende Band vor. Er versucht alternativ, einen Standpunkt stark im Dis
kurs zu machen, der allzu gerne vernachlässigt wird: Den Standpunkt der Lernen
den - nicht bezogen auf die Verwertbarkeit ihrer Lernleistungen für Fremdinteres
sen, sondern bezogen auf den Sinn, den der Lernprozess für die je subjektive Le
bensführung hat. Für den Leser könnte dies bedeuten, sich auf Unvertrautes ein-
In der gleichen Ausgabe der BNN (s.o.) wird davon gesprochen, dass in Baden-WülÜemberg
notorische Schulschwänzer von der Polizei in die Schule gebracht werden. Die härtere Gangart
zeige erste Erfolge.
2 So der programmatische Titel der GEW Baden-WülÜemberg in der Ausgabe 2/2002 ihrer Zeit
schrift ,bildung und wissenschaft'.
12
lassen zu müssen, weil die ,Routinen des Wiedererkennens' möglicherweise nicht
greifen3. Denn sich auf diesen hier vertretenen Blickwinkel einzulassen heißt zu
allererst, die sperrige Gewissheit zuzulassen, dass das Verhältnis der (lernenden)
Menschen zu ihrer Welt ein mögliches ist und daher ihrer Berechen- bzw. Ver
planbarkeit Grenzen gesetzt sind. Dieser Gewissheit nicht die Kanten nehmen zu
wollen, vielmehr sie als produktive Qualität zum Bezugspunkt des eigenen Den
kens und Handelns zu machen und, davon ausgehend, organisatorisches und insti
tutionelles Handeln zu begründen, ist der nächste Schritt. Dadurch kommt es zu
einer Erweiterung des Fokus' der Schulentwicklungsdiskussion, die zwar zunächst
irritiert, im Folgenden jedoch zu einer SchäIfung der Kontur führen und die Set
zung anderer Schwetpunkte nach sich ziehen kann. Die ,subversive Kraft des
Schattens,4 einzubringen, die Schattenakzeptanz also zu fördern und damit die
Diskussion aus kritisch-pädagogischer Sicht heraus zu bereichern, ist Anliegen
dieses Bandes - Wahrheitsvorränge behaupten zu wollen, jedoch nicht. Dass diese
gesellschaftliche Diskussion über den Stellenwert von Bildung wieder so vehe
ment in Gang kam, ist das Verdienst von PISA. Den mit dem aktuellen Lichtkegel
zwangsläufig verbundenen Schattenwurf nicht beachten, ihn nicht thematisieren
zu wollen, hieße aber, die Provokation zu vermeiden, die dem "Selbstgespräch der
Gesellschaft, was sie ist und was sie will"s neue Nahrung gibt und die darüber den
eingangs geforderten radikalen, an die Wurzeln gehenden Umbau des Schulsys
tems tatsächlich einleiten könnte.
2. Zur Konzeption des Bandes
2.1 Ausgangspunkte
Mit der Intention, den Schatten der Bildungsdiskussion auszuleuchten, bildet der
vorliegende Band einen zweiten Schritt auf dem Weg, subjekttheoretische Gedan
ken stärker in der pädagogischen Diskussion zu verankern. Auf einer Tagung 1999
befassten wir uns noch mit der Frage, ob es überhaupt möglich ist, im schulischen
Kontext Subjekt sein zu können6. Nun geht es immerhin darum, einen Rahmen zu
konturieren, der eine Entwicklung hin zu diesem Ansinnen in Aussicht stellt. Die
Ergebnisse der damaligen Auseinandersetzung und die Rückmeldungen auf die Ta
gung bilden die Grundlagen fiir die nun versuchte Fortführung der Diskussion. Aus
diesen Aspekten leiten sich wiederum Fragestellungen des vorliegenden Bandes ab:
3 Vgl. H. Rumpf(2002). Sich einlassen aufUnvertrautes. Neue Sammlung 1/2002, S. 13-29.
4 Vgl. V. Kast (1999). Der Schatten in uns - die subversive Lebenskraft. ZürichlD'dorf: Walter.
.5 Das Zitat entstammt der EinfUhrung zu einer Veranstaltung mit Peter Sloterdijk, die Reinhard
Kahl moderierte; die Veranstaltung hatte den bezeichnenden Titel: "Lernen ist Vorfreude auf
sich selbst" (Literaturhaus Stuttgart, 0612002).
6 Zur Tagung: Funke, E. H .& Rihm, Th. (Hg.) (2000). Subjektsein in der Schule? Eine pädagogi
sche Auseinandersetzung mit dem Lernbegriff Klaus Holzkamps. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
13