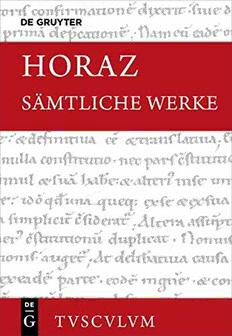Table Of ContentSAMMLUNG TUSCULUM
Herausgeber:
Niklas Holzberg
Bernhard Zimmermann
Wissenschaftlicher Beirat:
Günter Figal
Peter Kuhlmann
Irmgard Männlein-Robert
Rainer Nickel
Christiane Reitz
Antonios Rengakos
Markus Schauer
Christian Zgoll
QUINTUS HORATIUS FLACCUS
SÄMTLICHE WERKE
Lateinisch-deutsch
Herausgegeben und übersetzt
von Niklas Holzberg
DE GRUYTER
ISBN 978-3-11-056233-0
e-ISBN (PDF) 978-3-11-057383-1
Library of Congress Control Number: 2018935453
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2018 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Für Einbandgestaltung verwendete Abbildungen:
Cologny (Genève), Fondation Martin Bodmer, Cod. Bodmer 52: 6v/7r
(www.e-codices.unifr.ch)
Satz im Verlag
Druck und Bindung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen
♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier
Printed in Germany
www.degruyter.com
Siegmar Döpp σὺν χάριτι
Inhalt
Einführung 9
Vom Republikaner zum Augusteer 10
Sittenkritische Plaudereien und amüsante Geschichten 12
Zwischen Aktium und Alexandria 15
»Ich habe ein Monument vollendet, das dauerhafter ist
als Erz …« 17
Sendschreiben eines Hausphilosophen 22
Dirigent mit dem Daumen 25
Lyrische Zugabe 26
Poetologisches Vermächtnis 28
Non omnis moriar! 31
Zu dieser Übersetzung 36
Text und Übersetzung
Buch 1 der Satiren 40/41
Buch 2 der Satiren 112/113
Das Buch der Epoden 190/191
Buch 1 der Oden 236/237
Buch 2 der Oden 312/313
Buch 3 der Oden 360/361
Buch 1 der Briefe 446/447
Das Jahrhundertlied 522/523
Buch 4 der Oden 530/531
Buch 2 der Briefe 580/581
1 580/581
2 598/599
3 (»Über die Dichtkunst«) 612/613
8 Inhalt
Anhang
Zum lateinischen Text dieser Ausgabe 649
Anmerkungen 655
Versmaße 751
Bibliographie 755
Namen und Begriffe 767
Die lateinische Gedichtanfänge 801
Einführung
Über seinen Vorgänger in der Gattung, die er für sein erstes Ge-
dichtbuch wählte, den Satiriker Lucilius, schreibt Horaz: »Er ver-
traut seine Geheimnisse wie treuen Gefährten seinen Büchern an
und weder, wenn es ihm schlecht ergangen war, wandte er sich
irgendwo anders hin, noch, wenn es ihm gut ergangen war. So
kommt es, dass das ganze Leben des Alten, wie auf einer Votivta-
fel dargestellt, offen liegt« (Satire 2,1,30–34). Nimmt man Horaz
hier beim Wort und liest sein poetisches Œuvre, das uns komplett
überliefert ist, chronologisch vom ersten bis zum letzten Vers, kann
man den Eindruck gewinnen, auch dort habe man »das ganze Le-
ben« des Dichters »offen« vor sich, vernehme also immer dann au-
tobiographische Äußerungen des Menschen Horaz, wenn der Ich-
Sprecher der insgesamt 162 Gedichte etwas über sich selbst sagt. In
diesem Sinne pflegte die Latinistik die Texte denn auch bis in jün-
gere Zeit zu lesen, und so entstanden u.a. mehrere Horaz-Mono-
graphien, deren Verfasser ganz selbstverständlich voraussetzten, sie
könnten anhand der Gedichte das Leben dessen nachzeichnen, der
sie schrieb. Gegen diese Art von Interpretation hat jedoch die mo-
derne Literaturwissenschaft zu Recht eingewandt, dass der in Ho-
razens Gedichten »ich« Sagende zwar zuweilen Versatzstücke der
Realität einbeziehe (z. B. die Schlacht bei Aktium), aber ansonsten
vom realen Autor zu trennen sei, also nicht jede Aussage sich der
Vita des realen Autors zuschreiben lasse, etwa was sein Liebesleben
betrifft. Bei Horaz nimmt das sprechende Ich vielmehr verschie-
dene Rollen an, die das jeweils gewählte poetische Genre ihm vor-
gibt: diejenige des Lyrikers, des Satirikers, des Jambikers und des
Epistolographen. Um dieses Rollenspiel soll es gehen, wenn ich die
einzelnen Werke in der Reihenfolge ihrer Entstehung vorstelle, wo-
bei ich das jeweilige Alter Ego der Einfachheit halber Horaz nenne,
10 Einführung
ohne die historische Persönlichkeit zu meinen. Zuvor soll aber das
Wenige, was wir über diese wissen, zusammengetragen werden.
Vom Republikaner zum Augusteer
Während das Datum der Geburt, 8. Dezember 65 v. Chr., als sicher
gelten darf, ist das für den Todestag überlieferte, der 27. November
8 v. Chr., nicht ohne Weiteres als authentisch zu betrachten, da es
auf der Basis von Ode 2,17 konstruiert sein kann. Dort sagt Horaz
zu Maecenas, er werde, wenn der Freund sterbe, ihm noch am sel-
ben Tag in den Tod folgen. Für das Ableben des Maecenas ist nun
8 v. Chr. zuverlässig bezeugt, die Buchstaben seines Namens erge-
ben, griechisch geschrieben und als Ziffern gelesen, die Zahl 330
und, zum 1. Januar addiert, den 27. November. Da man aber die
jüngsten Werke des Horaz auf 11/10 v. Chr. datieren kann, erscheint
8 v. Chr. als Todesjahr sehr gut denkbar, und gänzlich unbestrit-
ten ist der Geburtsort Venusia in Apulien. Als Rom diese Stadt im
Bundesgenossenkrieg (91–89 v. Chr.) erobert hatte, war der Vater
des Dichters vermutlich als Bürger Venusias versklavt, aber bald
wieder als freier Bürger rehabilitiert und mithin nicht auf die nied-
rige soziale Stufe eines Freigelassenen gestellt worden. Denn wenn
Horaz sich in Satire 1,6,45f. als »Sohn eines freigelassenen Vaters«
bezeichnet, legt der Kontext nahe, dass er üble Nachrede zitiert,
und überdies gehörte er spätestens 30 v. Chr., aber wahrscheinlich
bereits 12 Jahre früher dem Ritterstand an: 42 v. Chr. komman-
dierte er bei Philippi als Militärtribun, also in einem Rang, den
der Sohn eines Freigelassenen schwerlich hätte einnehmen können,
eine Legion, und vorher hatte ihm sein Vater, ein Makler, der die
nach Auktionen zu zahlenden Gelder kassierte, eine solide Schul-
ausbildung in Rom und anschließend ein Studium der Philosophie
in Athen finanziert.
Horaz kämpfte bei Philippi auf der Seite der Caesarmörder ge-