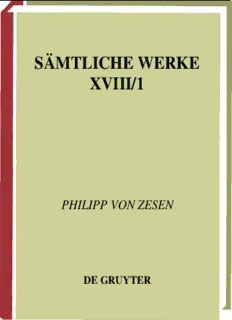Table Of ContentPHILIPP VON ZESEN
SÄMTLICHE WERKE
XVIII/1
AUSGABEN DEUTSCHER LITERATUR
DES XV. BIS XVIII. JAHRHUNDERTS
herausgegeben von Hans-Gert Roloff
PHILIPP VON ZESEN
SÄMTLICHE WERKE
DE GRUYTER
PHILIPP VON ZESEN
SÄMTLICHE WERKE
unter Mitwirkung von
ULRICH MACHÉ UND VOLKER MEID
herausgegeben von
FERDINAND VAN INGEN
ACHTZEHNTER BAND, ERSTER TEIL
COELUM ASTRONOMICO-POETICUM sive
MYTHOLOGICUM STELLARUM FIXARUM
ASTRONOMISCH-DICHTERISCHER oder MYTHOLOGISCHER
FIXSTERNHIMMEL
Lateinischer Text und Übersetzung
Herausgegeben und übersetzt von
REINHARD KLOCKOW
DE GRUYTER
ISSN 0179-0900
ISBN 978-3-11-015019-3
e-ISBN 978-3-11-021749-0
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© Copyright 2011 by Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/Boston
Satz: Dörlemann Satz GmbH & Co. KG, Lemförde
Druck und Bindung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen
ÜGedruckt auf säurefreiem Papier
Printed in Germany
www.degruyter.com
Vorwort V
Vorwort
Philipp von Zesens Coelum astronomico-poeticum sive mythologicum stellarum fixarum er-
schien 1662 in Amsterdam bei Johan Blaeu, der sich ebenso wie sein Autor Zesen in latinisierter Form Cae-
siusnannte. Das Buch war geplant als der erste Teil eines zweibändigen Werkes, dessen zweiter Teil von den
Planeten handeln sollte.1Zu dieser Fortsetzung ist es anscheinend nicht gekommen; auch in den Verzeich-
nissen der unveröffentlichten Werke Zesens taucht sie nicht auf.2Andererseits ist das Coelumnicht das erste
Werk, das Zesens intensive Beschäftigung mit der Astronomie bezeugt. Im ersten Abschnitt verweist er auf
seine Ancilla astronomiae3, ein ebenfalls nicht überliefertes, aber offenbar vollendetes Werk, das sich mit
Aufbau und Handhabung eines von Willem Blaeu, dem Vater von Johan, konstruierten Sphärenmodells be-
fasste4– ein von Willem Blaeu gefertigter Himmelsglobus liefert auch den Ausgangspunkt für die Betrach-
tungen im Coelum. Ja, das Interesse für Astronomie ist gewissermaßen durch die Familiengeschichte vorge-
prägt, denn schon der Großvater Abraham Zesen veröffentlichte Disquisitionesoder Propositiones de
Sole, wie der Enkel mit spürbarem Stolz mehrfach vermerkt.5
Die Ausgabe von 1662 ist der einzige greifbare Textzeuge des Coelum.Eine in älteren Werkverzeich-
nissen gelegentlich erwähnte Ausgabe von 1663 (anders als die von 1662 im Duodezformat) ließ sich bisher
nicht nachweisen.6Falls es sie tatsächlich gegeben hat, scheint sich kein Exemplar erhalten zu haben.7
Das Coelum zählt nicht zu den prominenten Werken Zesens. In dem zehnseitigen Artikel von Karl
Dissel in der Allgemeinen Deutschen Biographie8wird das Werk nicht einmal erwähnt. Auch die Spuren der
Benutzung sind eher spärlich– ihnen wird im geplanten Kommentarband näher nachzugehen sein– und die
Beurteilungen nicht immer freundlich.9 Zesen hat einen Teil des hier gesammelten Materials später in den
Heidnischen Gottheiten(1688)10gewissermaßen ‘recycelt’ – ganze Passagen darin sind mehr oder we-
niger wörtliche Übersetzungen aus dem Coelum. Die Neuausgabe des Coelumgibt den Interessierten Ge-
legenheit, sich ein eigenes Bild von den Qualitäten und Eigenarten des Werks zu machen.
1 Vgl. das Widmungsschreiben von Johannes Crusius (*8v) und S.2 des Coelum(„DeErraticis… in peculiari Trac-
tatu acturi…“).
2 Vgl. Karl F. Otto: Philipp von Zesen. A Bibliographical Catalogue. Bern und München 1970, S.246–253.
3 Coelum, S.2.
4 Vgl. Otto, S.246, Nr.4 mit dem vollständigen Titel und den Nachweisen.
5 Coelum, S.1, S.138, S.202. Der genaue Titel lautet: Capita PROPOSITA ad Disputandum publicè in Schola
Philosophica, continentia quaedam scitu necessaria de SOLE, quem Manilius ducem chori celestis appel-
lat.Es handelt sich um ein zwölfseitiges, noch ganz dem ptolemäischen Weltbild verpflichtetes Thesenpapier für eine aka-
demische Disputation am 7.April 1565 in Leipzig.
6 Otto, S.107 (Nr.97) mit den Nachweisen. Auch eigene Recherchen blieben erfolglos.
7 Bei der im Katalog der Universitätsbibliothek Mannheim verzeichneten angeblichen Ausgabe von 1672 (Signatur:
Sch072/148 an 1) handelt es sich um die von 1662.
8 Karl Dissel: Philipp von Zesen. In: ADB Bd.45, 1900, S.108–118.
9 Boll zählt das Werk zu den „kritiklosen Kompilationen“ (Franz Boll: Sphaera. Leipzig 1903, S.456).
10 Neudruck in: Sämtliche Werke, Band XVII/1. Berlin und New York 1998.
VI Vorwort
1. Exemplarbeschreibung
Das Titelblatt hat folgenden Wortlaut:
PHILIPPI CÆSII | à ZESEN | COELVM | ASTRONOMICO- | POETICVM | sive |
MYTHOLOGICUM | STELLARVM FIXARVM, | hoc est, | Signorum cœlestium, sive
Constellationum omnium | ad certas imagines redactarum, inque Cœlo fictitio | sive Or-
gano Globi Astronomici continui, mytholo- | gico nomine & picturâ, ab Antiquis repræ-
senta- | tarum | SVCCINCTA DESCRIPTIO. | [Verlagsemblem mit Inschrift:] INDEFESSVS
AGENDO | AMSTELÆDAMI, | Apud IOANNEM BLAEU. |cIO IOc LXII.
Format:
Oktav. Bogen- und Seitenzählung.
Bogenzählung: *, ** (2 Blätter), A-Z, Aa-Cc, Dd (4 Blätter).
Blattzählung jeweils 2 bis 5.
Seitenzählung 1–379 (von A bis Aa 6).
Kustoden finden sich regelmäßig auf allen Seiten.
Gliederung:
<*1> Titelblatt.
<*1v> leer.
*2 Widmung: INCLYTÆ | AMSTELÆDAMENSIS | REIPVBLICÆ | CONCORDI |
CAPITVM | QVADRIGÆ | […] PHILIPPVS CÆSIVS à ZESEN. *2v Widmungsgedicht:
CÆSIA quæ PALLAS […] ipse DEVS.Unterz. P. C. à C.
*3– <*8r> PRÆFAMEN.
<*8v> Widmungsschreiben von Johannes Crusius: EPISTOLA | CLARISSIMI VIRI | IOANNIS
CRVSII I.Cti.
**– <**2v> Autorenregister (dreispaltig gedruckt): NOMENCLATOR | AVCTORVM | & Ar-
tificum, quorum auctoritate in hoc | Opusculo usi sumus.
Seite 1: COELI | ASTRONOMICO- | POETICI, | seu | MYTHOLOGICI | stellarum
fixarum | MEMBRVM I. | De stellis circa Globum artificiosè pictis, earumque | discrimine,
appellatione, ac distributione: | item de via lactea, seu Galaxia.
Seite18: MEMBRVM II. | De Signis, seu Asterismis in globo considerandis | in genere; & in
specie de Signis Zodiaci, | eorumque pictura, & appellatione.Seite21: I. ARIES; der Widder
/ das Lentzen- | gestirn:(usw.– es folgen 12Kapitel über die 12Zeichen des Tierkreises).
Seite 104: MEMBRUM III, | de Signis extrazodiacalibus septentrionalibus. […] I. URSA MI-
NOR; der kleine Beer(usw.– es folgen 23Kapitel über die 23 nördlichen extrazodiakalen Sternbilder).
Seite 225: MEMBRUM IV, | de Signis extrazodiacalibus Meridionalibus. […] I. CETUS; der
Walfisch;(usw.– es folgen 29Kapitel über die 29 südlichen extrazodiakalen Sternbilder).
Seite 379 am Textende: FINIS.
Seite <Aa 6v>: INDEX | Rerum, & verborum memorabilium, quæ in | hoc opere continen-
tur.(39 ungezählte Seiten, jeweils zweispaltig gedruckt, bis Seite Dd v)
Seite <Dd 2r>: EMENDANDA | AC | INSERENDA.
Die Seiten <Dd 2v> bis <Dd 4> sind leer.
Vorwort VII
2. Die Neuedition: Der lateinische Text
Der lateinische Text wird in dieser Edition als photomechanischer Nachdruck der Ausgabe von 1662 dar-
geboten (reproduziertes Exemplar: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Signa-
tur 8 Astr. II, 603), ergänzt durch Zeilenzählung am Rand und durch gelegentliche textkritische Anmer-
kungen am Fuß der betreffenden Seite.
Die Entscheidung für die Reproduktion des Originals anstatt eines Neusatzes hat folgende Gründe: Die
Ausgabe von 1662 ist sorgfältig gedruckt, enthält nur wenige Druckfehler und ist auch für Nicht-Spezia-
listen gut lesbar, so dass schwierige Lesbarkeit als Grund für einen Neusatz entfällt. Das historische Druck-
bild hat zudem den Reiz der Authentizität. Ein Neusatz zöge auch eigene Probleme nach sich: So müssten
Druckfehler korrigiert und Zesens Korrekturliste auf der letzten Seite (Emendanda ac Inserenda) in den
Text eingearbeitet werden, und es würde sich die Frage nach weiteren Korrekturen stellen, etwa der von fal-
schen Namensformen, von Griechischfehlern, von fehlerhaften Zitaten, Stellenangaben usw. Bei einem repro-
graphischen Nachdruck entfallen solche Überlegungen; die notwendigen Anmerkungen und Korrekturen er-
scheinen als Fußnoten zum lateinischen Text oder zur Übersetzung bzw. im Kommentar. Das erscheint mir–
eine geeignete Vorlage vorausgesetzt– als eine den digitalen Reproduktionstechniken gemäße Form der Edi-
tion, die einerseits darauf verzichtet, einen historisch nicht bezeugten „kritischen“ Text herzustellen, anderer-
seits aber den Leser nicht mit einer bloßen Abbildung des Originals allein lässt. Allerdings hat diese Lösung
beimCoelum auch einen Nachteil: Das Format der übrigen Bände der Zesen-Gesamtausgabe kann wegen
des erforderlichen größeren Satzspiegels bei diesem Band nicht eingehalten werden. Das ist bedauerlich, aber
nicht zu vermeiden.
Ein textkritischer Apparat im eigentlichen Sinn erübrigt sich schon deswegen, weil die hier reproduzierte
Ausgabe von 1662 der einzige erhaltene Textzeuge ist. Die Anmerkungen zum lateinischen Text können
sich auf die Einarbeitung von Zesens Liste der Emendanda ac Inserendaam Schluss des Buches sowie
auf die Korrektur von Druckfehlern und Versehen beschränken, also von Fehlern des Druckes, nicht des
Textes selbst. Die Auseinandersetzung mit den von Zesen zu verantwortenden Textfehlern findet im Wesent-
lichen im Kommentar statt; im Vorgriff darauf enthalten schon die Anmerkungen zur Übersetzung einige
Korrekturen (dazu unten mehr).
Im Unterschied zum üblichen textkritischen Apparat steht in den Anmerkungen zum lateinischen Text
links von der eckigen Klammer die fehlerhafte oder problematische Lesart des Textes und rechts von der
Klammer die Eigenkorrektur Zesens oder die Korrektur bzw. die Bemerkungen des Herausgebers.
Textkorrekturen nach expliziter Anweisung der Emendanda ac Inserendaerhalten die Sigle EI.Wo
sich Korrekturen aus Zesens Aufforderung an den Leser ergeben, selbst die entsprechenden Änderungen vor-
zunehmen11, wird die Sigle EIin Klammern gesetzt: (EI)
Außerdem werden in den Anmerkungen offensichtliche Druckfehler oder Versehen (z.B. 332,1 Sulis
statt Solis) korrigiert. Vermerkt werden auch falsche Schrifttypen (kursiv statt recte und umgekehrt), feh-
lender Absatz-Einzug sowie Grammatikfehler, sofern sie die Beziehungen im Satz entstellen (z.B. 7,16
11 „Cetera corrigenda relinquimus ipsis Lectoribus…“ Es handelt sich dabei um falsche Tempusformen bei Quer-
verweisen. Zesen hat die einzelnen Kapitel offenbar nicht in der im Druck dargebotenen Reihenfolge verfasst und bei der
Herstellung der endgültigen Ordnung übersehen, dass sich in einigen Tempusformen bei Querverweisen noch die Reihenfolge
der Entstehung widerspiegelt. So verweist er etwa mit der Perfektform diximus(39,34) im Kapitel Geminiauf das Ka-
pitel über das Sternbild Herkules, das erst auf S.154 beginnt.
VIII Vorwort
impugnantiumstatt korrektem impugnantia,bezogen auf nomina; auch auf einen fehlenden Subjekts-
akkusativ im AcI wird gelegentlich hingewiesen). Andere Abweichungen von der klassischen Syntax (z.B.
326,22 postquam dixisset) sind Eigenheiten von Zesens lateinischem Idiom und bleiben in den Anmer-
kungen zum Text unkommentiert.
Bei Zitaten werden fehlerhafte, problematische oder von modernen Ausgaben abweichende Lesarten nur
dann in den Anmerkungen vermerkt und ggf. korrigiert, wenn sie eklatant grammatischfalsch sind (z.B.
bellostatt bellaim Horaz-Zitat 58,38) oder das Verständnis der betr. Stelle beeinträchtigen (z.B. fehlen-
des generisim Arnobius-Zitat 78,38); im Übrigen ist der Nachweis wie die Korrektur von Zitaten Sache
des Kommentars.
Griechische und hebräische Wörter und Zitate bleiben in den Anmerkungen zum lateinischen Text un-
kommentiert, auch wenn sie Fehler enthalten. Diese werden nicht als Satz- oder Druckfehler, sondern als
Textfehler bewertet, die auf Zesens Konto gehen und im Kommentar oder auch schon in den Anmerkungen
zur Übersetzung zu korrigieren sind. Das gilt auch für falsche Übersetzungen griechischer und hebräischer
Wörter.
3. Die Übersetzung
Die Übersetzung wird als Paralleldruck mit derselben Seitenzählung wie das lateinische Original geboten.
Lediglich beim Index,dem ausführlichen Sach- und Personenregister am Schluss des Werks, wird die deut-
sche Fassung nachder lateinischen abgedruckt, da mit der auch in der deutschen Version durchgeführten al-
phabetischen Anordnung die Parallelität der Textteile aufgehoben ist. Das Autorenregister (Nomenclator
Auctorum & Artificum) zu Anfang wird nicht übersetzt.
Der Text wird in der durch die Emendanda ac Inserendakorrigierten Fassung übersetzt; d.h. bei der
Überprüfung der Übersetzung sind auch die Anmerkungen zum lateinischen Text heranzuziehen, die die
von Zesen durchgeführten Korrekturen verzeichnen. Auf größere Ergänzungen Zesens wird zudem in den
Fußnoten zur Übersetzung aufmerksam gemacht.
Verse werden als Verse wiedergegeben. Dabei greife ich nach Möglichkeit auf vorhandene und bewährte
Übersetzungen zurück; sie werden im Kommentar zur Stelle vermerkt. Wo sie fehlen, musste ich mich selbst
als Verseschmied betätigen. Zitate werden grundsätzlich in der Zesen gebotenen Form übersetzt, auch wenn
diese vom originalen oder korrekten Wortlaut abweicht. Nur bei den in den Anmerkungen zum lateinischen
Text angezeigten problematischen Zitatstellen wird auch die Übersetzung angepasst, wobei eine Fußnote auf
den Eingriff hinweist.
Bei lateinischen Wörtern im Übersetzungstext werden die Ligaturen œund æzu oeund aeaufgelöst.
Die Verwendung der Majuskeln Uund Vam Wortanfang wird heutigen Gepflogenheiten angepasst (Ursa
und nicht Vrsa); hingegen wird in Majuskelpassagen (Überschriften, Inschriften-Zitate) das oft willkürliche
Schwanken des Originals zwischen Uund Vbeibehalten.
Lateinische Werktitel werden in der bei Zesen vorgefundenen Form zitiert, die nicht immer mit dem ori-
ginalen oder üblichen Titel übereinstimmt, wie sich schon an dem oben erwähnten Werk seines Großvaters
Abraham Zesen zeigt.12 Dabei werden die zahlreichen Abkürzungen aufgelöst. Mit der Verifikation der
12 S.o. Anm.5. Zesen zitiert das Werk als Propositiones Astronomico-Physicae de Soleoder als Disquisitiones.
Vorwort IX
Werktitel und Autorennamen ist schon eine beträchtliche Vorarbeit für den Kommentar geleistet, der die Titel
in der originalen Form mit den erforderlichen Angaben anführen wird.
Die Übersetzung folgt dem lateinischen Text auch dort, wo er inhaltlich fehlerhaft ist; d.h. falsche Stellen-
oder Autorenangaben, falsche Namensformen oder Zahlen und andere sachliche Irrtümer des lateinischen
Originals werden in der deutschen Fassung beibehalten. Korrekturen sind Sache des Kommentars sowie– in
geringem Umfang– der Anmerkungen zur Übersetzung.
Falsche oder ungewöhnliche Namensformen des lateinischen Textes werden in der Übersetzung (ggf. mit
bestimmten Anpassungen, s.u.) u.a. deshalb beibehalten, weil sie oft in einer bestimmten Tradition stehen
und damit Auskunft über die Quellen und Traditionslinien geben, denen Zesen folgt. Zwei Beispiele: In
Bezug auf den Fluss bei Sparta verwendet Zesen einmal den Ablativ Euroteo(121,16), der auf einen No-
minativ Euroteus statt des üblichen Eurotas zurückgeht. Dieselbe Form taucht im selben Zusam-
menhang auch im Schilder-Boeck(1604) des Karel van Mander13auf, das Zesen vielleicht als Quelle ge-
dient hat, sofern nicht beide eine gemeinsame Quelle benutzen. Oder: Wenn Zesen 201,32 den Schwan feh-
lerhaft als Ales Laystrius(statt Caystrius,‘vom Fluss Kaystros’) bezeichnet, so ist seine– wie fast immer
nicht genannte – Quelle Julius Schillers Coelum stellatum Christianum, wo sich derselbe Fehler fin-
det.14Solche Besonderheiten sollen auch für Leser, die hauptsächlich die deutsche Fassung benutzen, kennt-
lich bleiben.
Zur Erleichterung der Lektüre erfolgen einige Korrekturen– hauptsächlich bei Namensformen und grie-
chischen Zitaten, nicht aber z.B. bei falschen Stellenangaben und Verweisen– schon in den Fußnoten zur
Übersetzung. Diese Anmerkungen geben auch Hinweise auf Schwierigkeiten der Übersetzung, auf Unstim-
migkeiten des lat. Textes u.ä., aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Zur Wiedergabe ursprünglich griechischer Namensformen
Keine befriedigende Lösung gibt es bei der Wiedergabe ursprünglich griechischer Namen, die bei Zesen in la-
teinischem Gewand auftreten. Zwei Forderungen werden in diesem Zusammenhang gewöhnlich erhoben: Die
Übersetzung solle dem Sprachgebrauch folgen, und sie solle konsequent sein. Leider sind diese beiden Forde-
rungen nicht miteinander vereinbar, jedenfalls solange man unter ‘Konsequenz’ die strikte Orientierung ent-
weder an den griechischen oder an den lateinischen Namensformen versteht.
Der Sprachgebrauch, sofern auf dem sehr speziellen Gebiet antiker griechischer Namen davon überhaupt
die Rede sein kann, bevorzugt manchmal die griechische, manchmal die lateinische Form, wobei noch ortho-
graphische und manchmal auch morphologische Anpassungen an deutsche Gewohnheiten zu berücksichtigen
sind. So spricht man latinisierend von Tantalus-Qualen, von einer Sisyphus-Aufgabe, einer Herkules-
Arbeit, einer Achillessehne, einem Pyrrhus-Sieg, von Dädalus und Ikarus, von Ödipus und
Ägisth; jemand ist ein Krösus und beobachtet einen anderen mit Argusaugen, besichtigt Delphi usw.
Umgekehrt redet man mit griechischer Namensform von Odysseusund nicht von Ulixes, fährt nach Rho-
dosund Knossosund nicht nach Rhodusund Cnossusoder Gnosususw. Allerdings scheinen sich bei
Namen von historischen Persönlichkeiten, von Dichtern, Politikern, Wissenschaftlern usw. die griechischen
13 Dort S.37v. Zitiert nach der digitalisierten Form in der DBNL (Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren,
http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/).
14 Julius Schiller: Coelum stellatum Christianum.Augsburg 1627,Constellatio IX, S.46.
Description:Philipp von Zesen (1619-1689) verbindet in seinem 1662 in Amsterdam erschienenen Coelum astronomico-poeticum zeitgenossische Astronomie mit philologischer Mythenforschung. In 64 Kapiteln referiert er die mit den Sternbildern verbundenen antiken Mythen und deutet sie in rationalistischer Weise.Die Ne