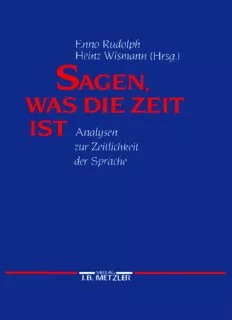Table Of ContentSagen, wasdieZeit ist
ENNO RUDOLPH/ HEINZ WISMANN (HRSG.)
Sagen, was die Zeit ist
.Analysen zur Zeitlichkeit
der Sprache
J. B.METZLERSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG
STUTTGART
DieDeutscheBibliothek- CIP-Einheitsaufnahme
Sagen,wasdieZeit ist:Analysenzur Zeitlichkeitder Sprache
IEnnoRudolph;Heinz Wismann (Hrsg.),- Stuttgart:
Metzler,1992
NE:Rudolph, Enno[Hrsg.]
ISBN978-3-476-00773-5
ISBN978-3-476-03371-0(eBook)
DOI 10.1007/978-3-476-03371-0
DiesesWerkeinschlielilichallerseiner Teileisturheberrechtlichgeschiitzt.Jede
VerwertungauBerhalb der engen GrenzendesUrheberrechtsgesetzesistohne
ZustimmungdesVerlagesunzulassigund strafbar.Das gilt insbesonderefiir
VervieWiltigungen,Obersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung inelektronischenSystemen.
© 1992Springer-Verlag GmbHDeutschland
UrsprunglicherschienenbeiJ.B.MetzlerscheVerlagsbuchhandlung
undCarlErnstPoeschelVerlagGmbHinStuttgart1992
lnhalt
Vorwort
Seite 1
HEINZ WISMANN
Zur Sprache selbst
ErinnerungandieplatonischeAporiedes Benennens
Seite5
ANDRELAKS
Zeitgewinn
BemerkungenzumUnterscbiedzwischenMetapherundVergleichin.Aristoteles'
»Rhetorie«
Seite11
FRANCO VOLPI
MyEtv, cX1tO<pCdVE0'3cu alsepJlEVEDEtv
Die OntologisierungderSprache (Myoc,) beimfriihen HeideggerimRiickgriff
auf.Aristoteles
Seite21
GUNTER FIGAL
Die Intuition einer radikal historischen Philosophie
SpracheundZeit inderPhilosophie MartinHeideggers
Seite43
ULRICH POTHAST
Sagen, wieviel Uhr esist
WittgensteiniiberdasSchatzenderTageszeit
Seite63
INHALT
ENNO RUDOLPH
Sprache zwischen Mythos und Erkenntnis
Zu CassirersDiagnosederTragik spracblicben Fortscbritts
Seite79
HORST TURK
»Aber die Zeit verliert uns«
ZurStrukturderbistoriscbenZeit am BeispielvonBkcbners»Danton«
Seite93
ROLAND REUSS
Das Gedicht und seine Zeit
Zu PaulCelans ))SCHWIMMHA u TE zwischendenWorten,«
Seite 113
HELMUT SCHNELLE
Der Ausdruck der Zeitlichkeit in den Sprachen
Seite131
CARL FRIEDRICH VON WEIZSACKER
Deskriptive zeitliche Logik
Seite 155
Vorwort
DaB Sprechen etwas mit Zeit zu tun hat, ist eine ebenso evidente wie
triviale Feststellung. Gleichwohl haben Sprachphilosophen, Sprachtheore
tiker,Logiker,LinguistenundPoetologenvonPlatonbisheutesichdiesem
Zusammenhang zumeist nur beiHiufig gewidmet. Sprache hat grammati
sche Strukturund sie steht gerade auch dort, wo siesich- wie oftmals in
derPoesie- der VerpflichtungaufGrammatikverweigert,inAbhangigkeit
von einer Grammatik des Verstehens. Zudem ist Sprache nicht rnoglich
ohne die Konstruktion eines semantisch organisierten Zusammenhanges
von Begriffen.Begriffeaberbildenwirdurch Abstraktion, genauer: in der
Regel durch»negativeAbstraktion«,wie ErnstCassireresnennt, urndamit
zugleich deren Fragwiirdigkeit zu markieren. Unter »negativer Abstrak
tion« verstehtCassirerdie vertrautelogische Methode, durch das Absehen
vonindividualisierendenPradikatenzu Universalienzu gelangen,ohnedie
die Wissenschaft nicht arbeiten kann, die aber auch die Alltagssprache
regieren. Cassirerkritisiert, dafdies Verfahrenschliefllich zur Vernichtung
jeder Bestimmtheit fiihren mufl, sodaf unserem Denken der »Riickweg«
vom »Iogischen Nichts« des Begriffs zu den konkreten Sonderfallen ver
sperrtist,
DerRiickwegscheinturnso mehrverschlossen,wennmanbedenkt,daB
die Abstraktion von der zeitlichen Verfafstheit sowohl des Sprechens als
auch der Gegenstande, von denen die Rede ist, unmittelbar mit der Ver
nachlassigung aller individuellen Besonderung einhergeht. Von der Zeit
lichkeit der Gegenstande der Sprache, des Sprechaktes und der jeweiligen
Situationdes Sprechers- den Autor geschriebenerSpracheeingeschlossen
- abzusehen, heifst,unwahr zu reden, iiber die Welt und iiber sich selbst.
Cassirer - zweifellos einer der maBgeblichen Sprachphilosophen unseres
Jahrhunderts- hat daraus die Konsequenz gezogen, der Spracheim alIge
meinen und der Wissenschaftssprache im besonderen die Kompetenz zu
bestreiten,derzeitlichenVeranderlichkeitihrerjeweiligenGegenstandswelt
gerecht werden zu konnen, Universalien verfehlen die Individualitat der
Phanorneneebenso wie ihre Zeitlichkeit.
Auf ED.E. Schleiermacher geht die fiir seine und die nachfolgende
Hermeneutik grundlegende Einsicht zuriick, daf mit jeder Verbindung
VORWORT
von Subjekt und Pradikat etwas sprachlich Neues, und damit moglicher
neuer Sinn entsteht. Dies gilt selbst fiir Wiederholungen von Aussagen,
genauer also dafiir, etwas »aufs neue« zu sagen. Diese These formuliert
nicht nur die fiir Schleiermachers Lehre von der »Kunst des Verstehens«
leitende Voraussetzung,·dali Sprache bedingt durch die unvermittelbare
Individualitat der Menschen einem Veranderungsprozefs unterworfen ist,
der sich vollstandiger Kontrolle entzieht. Dies bedeutet auch, daB der
Interpret, ja jeder Horer bzw. Leser von gesprochenem oder geschriebe
nem Wort dem Sinn des Geauflertenstets nachlauft,Einuniiberwindlicher
Rest an Fremdheit und Unverstehbarkeit bleibt, der wesentlich schon da
durch bedingt ist, daf Sprecher und Sprachgegenstand niemals auBerhalb
der Zeit stehen. So gesehen, kommen Interpret und Zuhorer immer zu
spat.
Ernst Kapp hat darauf verwiesen, daf die Entstehung der Logik als
philosophischer Disziplin in der griechischen Antike aus der Not heraus
geschah, sicheres Wissen iiber veranderliche Phanornene, und das heilit
iiber die ganze Welt, nicht erlangen zu konnen. Diese Not gebar die Tu
gend logischen Redens, die Tugend des Sprachspiels als Modell fiir das
Streirgesprach,dasder Spielregelunterliegt,hypothetischvonder Zeitlich
keit und damit von der Naturder Phanomenezu abstrahieren.Jedes logi
sche SchluBverfahrenfunktioniert nach dieser Pramisseund nurnach ihr.
Aber nicht nur mit der Kulturdes logischen Sprechens habendie Grie
chen der Universalitat der Zeitlichkeit- lange vor Heidegger- Rechnung
getragen. So kulminiert die Zeitauffassung des Aristoteles, von der nach
Heidegger die gesamte abendlandische Tradition der Zeitphilosophie ab
hangt, in der Einsicht, daBdie Zeit »Ursache des Untergangs« aller Dinge
sei. Die Diskrepanz zwischen der Moglichkeit, die Dauer zeitlicher Pro
zesse zu messen einerseits und der Unfahigkeit unserer Begriffe, der Zeit
lichkeit von Prozessen gerecht zu werden andererseits, stellt das Aus
gangsproblem der aristotelischen Zeittheorie dar. Nach Aristoteles behel
fen wir uns kiinstlich, indem wir aufProzessedeutend, »[etzt«sagen, wohl
wissend, daB »jetzt« nicht zeitlich, sondern imaginierter Zeitstillstand ist,
Zeitstillstand aber kommt nach Auffassung der Griechen in der Welt nir
gends vor. Erst Physik und Philosophie der Neuzeit haben Zeit und Be
griffderartformalisiert- sosagt Kantetwa: »DieZeitsteht,und siebewegt
sichnicht«-, daf von dort aus jener vonCassirer angemahnte»Riickweg«
zum konkretenzeitlichen Phanomennichtmehrmoglichist.Durch»jetzt«
Sagen die Zeit zum Stillstandzu bringen, bedeutetdie blofieFiktiviratvon
Sprache zuzugeben,urnsiegleichwohlzum hermeneutischenRegulatorder
Welt zu machen: indem wir sprechen, betriigen wir uns und die Welt urn
die Zeitlichkeitder Phanornene.
2
VORWORT
Kann Sprache diesem Dilemma auch anders als in der Form eines
Sprachspiels begegnen, das nur funktioniert unter der zuvor getroffenen
UbereinkunfteinesVerzichts aufdasbessere Wissen von der Zeitlichkeitall
dessen, wovonwir sagen, dafes»ist«?DieserFragehabensichdieAutoren
des vorliegendenBandes von volligverschiedenen Standpunktenund Dis
ziplinenaus gestellt. 1mVerlaufezweierTagungenzum Themades Buches
wurden philosophische, philologische, poetologische, linguistische und
wissenschaftstheoretische Gesichtspunkte zusammengetragen - bisweilen
auch kontrovers ausgetragen -, von denen aus das genannte Dilemma
entwedernoch praziserbeschriebenwordenistoderaber auch Angebotezu
seiner Uberwindung unterbreitet wurden. Dreider bedeutendsten Sprach
philosophenunseres Jahrhunderts- LudwigWittgenstein,MartinHeideg
gerund ErnstCassirer - stehendabei aufder Seitederer, die das Scheitern
der Spracheander Zeitentwedermit konstruktiverSprachkritikauswerten
(Wittgenstein) oder - auf jeweils hochst unterschiedliche Weise - neue
Auswegevorschlagen:der eine iiberden WegeinerNeubesinnungaufden
Sinn von >Zeit<(Heidegger),der andereiiberden WegeinerNeubesinnung
aufdieLeistungsfahigkeitvon Sprach- und Begriffsformen (Cassirer).
Zwei poetologischeBeirrage, von denender eineder Interpretationeines
DramasvonGeorg Biichner, der andereder Interpretationeines Gedichtes
vonPaul Celangewidmetist, versuchendie poetischeSprache daraufhinzu
befragen, wie Zeit in ihr thernatisch wird und wie sie zugleich selbst die
Zeitlichkeit von Sprachgestalt und Sprachgehalt zum Ausdruck bringt.
Erganzt werden diese Uberlegungen von einer ebenso philologisch wie
hermeneutisch orientierten Untersuchung zur Metaphorologie des Aristo
teles: die Metapher als diejenige ausgezeichnete Form sprachlichen Aus
drucks, die im Gegensatz zu allen anderen Arten des Vergleichs durch
»Zeitgewinn«, jadurch Zeitiiberlistung charakterisiert ist. Und ein streng
auf die Aktualitat der gegenwartigen Linguistik bezogener Beitrag ver
sucht sodann die Rede vom Singular der Sprache zu relativieren und das
Verhaltnis von Modalitat und Zeitmodus als strukturierendes Moment in
den Sprachennachzuweisen.
DerBand wird eroffnetmit einerInterpretationdes Textes,der die erste
uns bekannte Sprachtheorie innerhalb der abendlandischen Philosophie
enthalt: Platons Kratylos. Die Leitfrage dieses Textes ist derjenigen des
vorliegendenBuches unmittelbaranalog: 1stSprache lediglich Konvention,
erwachsenaus der Einsichtin die Unzulanglichkeit der Worte und Benen
nungen fur die Sachverhalte, oder erfaBt, ja faBtSprache die Realitat der
Dinge, wie sind?
DenAbschlufsder DiskussionschliefllichbildetCarlFriedrichvon Weiz
sackers Versuch, zur KonstruktioneinerLogikzu gelangen, die die Struk-
3
VORWORT
turzeitlicherAussagenentwirft.Eine »deskriptivezeitliche Logik« istnach
v.Weizsiickernotwendig, will die Physikangesichts des quantenphysikali
schen Problems, iiber irreversible Prozesse nur Wahrscheinlichkeitsaussa
gen (und das heifstZukunftsaussagen) machen zu konnen, nicht Theorie
verzichtleisten.
Die in diesem Buch dokumentierten Diskussionen verstehen sich in
besonderem Sinne als interdisziplinar, da es den Teilnehmern darum geht,
Sprache nicht allein als das hermeneutische Reservat der Geisteswissen
schaften zu betrachten. Die Diskussionen fanden in der Forschungssratte
der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg statt. Sie sind Teil
eineriiber viele Jahre veranstalteten Tagungsreihe, die unter jeweilsande
ren Aspekten iiber das Spannungsverhaltnis zwischen Zeit und Logik in
Wissenschaft und Philosophie handelte. Dieser Band schliefst an friihere
Publikationen an, die aus diesem Diskussionszusammenhang entstanden
sind,wie z.B.Zeit,Betuegang, Hand/ung,StudienzurZeitabhand/ungdesAristo
teles(1988); ZeitundLogikbeiLeibniz.Studienzu ProblemenderNaturpbiloso
pbie,Mathematik,LogikundMetaphysik (1989).
D.H.
4