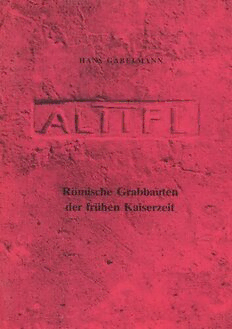Table Of ContentLimesmuseum Aalen
Zweigmuseum des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart
Öffnungszeiten des Limesmuseums:
Täglich außer montags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr
Gruppenführungen nach Vereinbarung
Kleine Schriften zur Kenntnis der römischen Besetzungsgeschichte
Südwestdeutschlands
Nr. 22
Zu beziehen über
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart, Altes Schloß
(Sekretariat der Archäologischen Sammlungen)
Umschlag Vorderseite:
Ziegel (later) mit Stempel der in Aalen stationierten Reitereinheit von 1000 Reitern AI. (a)
II FL(avia pia fidelis Domitiana milliaria). Gefunden im Kastellbad.
Umschlag Rückseite:
Inschrift, gefunden in der St. Johanniskirche, Aalen. Ao: Limesmuseum Aalen.
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D[ol(icheno)]/T(itus) Vitalius [Ad]/ventus De[cur(io)] Al(ae) II
Fl(aviae) pro sa[lu]/te sua et su[or(um)/v(otum) s(olvit) l(aetus) l(ibens) m(erito).
Jupiter Dolichenus, dem besten und größten, (hat) Titus Vitalius Adventus, Befehlshaber
einer Turma (Schwadron von 42 Reitern) der Ala II Flavia, für sein und der Seinen Heil
(den Weihestein mit dem Bildnis des Gottes aufstellen lassen und damit) sein Gelübde
eingelöst froh und freudig nach Gebühr.
HANNS GABELMANN
Römische Grabbauten
der frühen Kaiserzeit
Herausgegeben von der Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und
Hohenzollern e. V. mit Unterstützung des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart
und der Stadt Aalen.
Schriftleitung: Dr. Philipp Filtzinger, Stuttgart
Druck: Druckhaus Waiblingen
J979
Vorwort
Herrn Professor Dr. Hanns Gabelmann, Archäologisches Institut der Universi-
tät Bonn, verdanken wir den Überblick über die römischen Grabbauten der
frühen Kaiserzeit. In seiner Habilitationsschrift befaßt sich Herr Gabelmann mit
den .Werkstattgruppen der oberitalischen Sarkophage'; er ist Mitarbeiter am
-Corpus der antiken Sarkophagreliefs'. Herr Gabelmann beschäftigt sich vor
allem mit der römischen Plastik der Nordprovinzen. Mit seinen Studien zur
Grabkunst ist es ihm gelungen, die engen Verbindungen zwischen Oberitalien
und der Rheinzone herauszuarbeiten.
In Baden-Württemberg sind bis jetzt nur Teile von Grabdenkmälern nach Art
der Igeler Säule bei Trier bekannt geworden. In den Fundamenten der Kirche in
Risstissen (Alb-Donau-Kreis) sind Reliefs mehrerer Grabdenkmäler vermauert.
Es war immer ein Anliegen von Herrn Professor Peter Goessler, diese
qualitätvollen Reliefs zu retten, bevor sie durch die Witterung ganz zerstört
werden. Hierzu ist es jetzt höchste Zeit.
Bei Kirchentellinsfurt konnte Oskar Paret nur noch Teile eines Familiengrabes,
das zu einem römischen Gutshof (Villa rustica) gehörte, bergen. Das Grabmal
war bereits im Mittelalter als Steinbruch benutzt worden. Vier Köpfe des
Grabmals sind im Lapidarium des Württembergischen Landesmuseums im
Stiftsfruchtkasten (Schillerplatz i) ausgestellt (Nr. 39). Zu Pfeilergrabmälern
gehören die an mehreren Orten in Baden-Württemberg gefundenen pyramiden-
förmigen Schuppendächer sow.ie Pinienzapfen von bisweilen beträchtlicher
Größe als Bekrönung dieser Schuppendächer. Ph. Filtzinger
Geschmack und Vermögen bestimmen die Form
des Grabmals
In keiner Gattung der römischen Architektur ist die Vielgestaltigkeit der Formen
so unübersehbar wie bei den Grabbauten. Diese Vielfalt ist vor allem durch die
Verwirklichung persönlicher Wünsche der Auftraggeber zu erklären. Der
Phantasie waren hier weniger Grenzen als in der Nutzarchitektur mit ihren
festgelegten Funktionen gesetzt. So ließ sich z. B. der Großbäcker Eurysaces vor
der Porta Maggiore in Rom einen Grabbau errichten, der sich aus übereinander-
gestapelten Getreidescheffeln (Abb. 44, 1.2) zusammensetzt. Ein Liebhaber von
Circusspielen erbaute sich bei Ariccia ein Grabmonument (sog. Grab der
Horatier und Curiatier), das von hohen Kegeln bekrönt, an das Aussehen von
Zielsäulen (metae) im Circus erinnerte. Einer der reichen Weinhändler der
Trierer Gegend ließ sein Grabmal mit einer aus Weinamphoren aufgebauten
Pyramide bekrönen und von zwei mit Fässern beladenen Moselschiffen einrah-
men. Der „fröhliche Steuermann" des Schiffes dient heute noch auf Flascheneti-
ketten der Weinreklame.
Mit einem aufwendigen Grabbau (monumentum, vom lat. monere - mahnen)
Verband man die Absicht, sich der Nachwelt im Gedächtnis zu erhalten. Im
Gegensatz zum 19. Jahrhundert n. Chr., in dem zahlreiche antike Grabmalfor-
men auf unseren Friedhöfen wiederaufgenommen wurden, ist unsere Zeit, was
die Verewigung in Monumenten angeht, skeptischer geworden. Allein im Süden
Europas, wo die Bestattung in mit Marmorplatten verschlossenen Wandnischen
(locnli) noch Völlig antiken Sitten entspricht, werden heute noch Mausoleen
errichtet.
Ebenso wie in der römischen Staatskunst Triumphe und Siege durch Bögen und
Säulen der Nachwelt überliefert wurden, sollten die zumeist an den Ausfallstra-
ßen der Städte stehenden Grabbauten die memoria an die Verstorbenen
wachhalten. Nicht nur die Inschrift, sondern auch Porträtstatuen und auf die
Toten bezogene Reliefdarstellungen sollten von ihrer Person, ihrem Leben und
ihrer gesellschaftlichen Stellung künden.
Während der römische Adel sich zumeist auf eher schlichte Grabanlagen
beschränkte, konnten Schichten wie die Freigelassenen, die ihnen fehlende
gesellschaftliche Wertschätzung durch übertrieben reiche Grabbauten kompen-
sieren. Der Vergleichsweise größte Grabluxus wurde sicherlich Von den seviri
Pan, rechte Nebenseite des Poblicius-Grabrnals, Köln
5
(Sechsmännerkollegium) getrieben: dies waren ehemalige Freigelassene, die, zu
Geld gekommen, den Kult der vergöttlichten Kaiser zu versehen hatten.
In der römischen Grabarchitektur ist wie in anderen Gattungen der römischen
Kunst eine eklektische Haltung zu beobachten, die erlaubt, auch Formen anderer
Kulturen wiederaufzunehmen. So ließ sich z.B. C.Cestius vor der Porta
Ostiensis in Rom - in Nachahmung der ägyptischen Pharaonen - eine Pyramide
mit einer Grabkammer im Inneren errichten. Das Rundgrab des Kaisers
Augustus sollte, obwohl äußerlich in hellenistischer Bauordnung gehalten, an die
Gräber etruskischer Könige erinnern. In Pompeji wird in der Form der Exedra
(halbrunde Sitzbank) eine Form in die Nekropolen übernommen, wie sie zuvor
nur in griechischen Heiligtümern als Sitzgelegenheit für vornehme Festteilneh-
mer errichtet worden war.
Trimalchio bestimmt die bildliche Ausstattung seines Grabes
Die Anweisungen der Auftraggeber an die Steinmetzwerkstätten müssen, wie
uns erhaltene schriftliche Quellen lehren, bis in die Details gegangen sein. Bei
Petron (Cena Trimalchionis 71) ist uns ein allerdings als Satire gedachtes
Gespräch mit einem Steinmetzen überliefert. Trimalchio macht hier genaue
Angaben über die bildliche Ausstattung seines eigenen Grabes: zu Füßen der
Statuen des Ehepaares sollen die Lieblingshündchen Platz finden. Die Frau soll
eine Taube in Händen halten. Von den dargestellten Weinamphoren soll eine
zerbrochen sein und über ihr soll ein Sklavenjunge über seine Unachtsamkeit
weinen: ein ausgesprochenes Genremotiv! Der Relief schmuck soll die Kämpfe
des von Trimalchio favorisierten Gladiator mit Namen Petraites vorführen.
Auch sollen Schiffe die Quelle seines Reichtums anzeigen. Trimalchio selbst - er
hat es als Freigelassener zum sevir gebracht - soll auf einem Tribunal bei einer
Geldverteilung (wie in der Bildkunst - vor allem auf Münzen - sonst nur der
Kaiser) gezeigt werden. Als Kleidung maßt sich Trimalchio die toga praetexta
(weiße Toga mit purpurfarbenem Randstreifen) an, die eigentlich nur den
Beamten aus dem Patrizierstand zukam.
Auch in dem sog. Testament eines Lingonen (CIL. XIII, 5708), das durch eine
ins io. Jahrhundert n. Chr. gehörende Pergamentkopie einer antiken Inschrift
überliefert ist, gab es detaillierte Angaben für eine Grabanlage: Der Verfasser des
Testaments wünscht, daß für ihn eine Grabnische mit einer Sitzstatue aus
Marmor errichtet wird. Ein davorstehender Altar, in den die Urne eingelassen
werden soll, dient dem Totenkult. Das Ganze sollte wie üblich in einem
Grabgarten (cepotaphium) stehen. In solchen Grabgärten wurden nicht nur
Blumen, sondern auch Obst und Wein angepflanzt. Notwendig war deshalb bei
großen Anlagen sogar eine Wasserversorgung. Zur Pflege des Lingonengrabes
sollten drei Gärtner mit Lehrlingen angestellt werden. Aus einem auf einer
Marmortafel erhaltenen Plan einer Grabanlage ist sogar noch die strenge
Geometrie der Bepflanzung zu entnehmen. In den Grabgärten standen vielfach
aufgemauerte Triklinien, auf denen sich an den Totenfesten (Parentalia und
Rosalia) die Angehörigen zum Mahl versammelten. Dabei wurden auch den
Toten Speisen vorgesetzt - eine Sitte, die auf dem Balkan noch heute geübt wird.
Der Gedanke, für die Toten Grabbauten zu errichten, wurde aus Rom und
Italien wie auch andere Formen der Grabkunst (z. B. Grabstelen und -altäre) in
die Nordprovinzen übernommen. Daß es auch im römischen Germanien des i.
Jahrhunderts n. Chr. bereits Grabbauten gegeben hat, konnte früher nur
vermutet werden. Zur Gewißheit wurde es erst durch die sensationelle Entdek-
kung des Poblicius-Grabmals (Abb. 18-21), das jetzt im Kölner Museum
wiederaufgebaut worden ist. Das früheste datierbare Fragment eines Grabbaus
am Rhein ist ein erst 1974 mit anderen Architekturteilen geborgener Architrav
(Abb. 22). Er trägt eine tabula mit Inschrift, die von Greifen gehalten wurde. Die
beiden Brüder, für die der Grabbau errichtet wurde - M. und C. Cassius -,
gehörten der Legio XIV Gemina an, die von 13 v. Chr. bis 43 n. Chr. in Mainz
stand.
Bautypen
Maiisoleumsgrundform
Im Zentrum unseres Interesses sollen diejenigen Formen von Grabbauten
stehen, die in die Nordprovinzen übernommen und dort weitergebildet worden
sind. Dabei handelt es sich vor allem um turmartige Grabbauten mit zwei und
mehr Geschossen. Der für diese Grabbauten häufig verwendete Begriff des
.Grabturmes' wird diesen Erscheinungen jedoch nicht gerecht, denn das
Obergeschoß dieser Bauten öffnet sich zumeist in einer Säulenstellung in
griechischer Bauordnung. Regelrechte, auch in ihrem oberen Teil geschlossene
Grabtürme gibt es hingegen in Nordafrika und in Palmyra.
Die Bauten, die hier abgebildet werden, verbindet - so variabel sie im einzelnen
auch sein mögen - eine bestimmte Grundform: sie setzen sich zusammen aus
einem geschlossenen, unzugänglichen, hohen Untergeschoß und einem sich
öffnenden Obergeschoß, das die Statuen der Verstorbenen aufnehmen kann. Das
geschlossene Postament kann glatt gelassen und nur oben und unten von Profilen
eingerahmt sein (z. B. Abb. 3.12) oder es wird von Pilastern seitlich eingefaßt
und dann durch einen Architrav und einen Fries oben abgeschlossen (z. B. Abb.
5.16.18). Die Zweiteilung in ein geschlossenes Sockelgeschoß und einen sich in
einer Säulenstellung öffnenden Oberbau verbindet diese Bauten mit dem
berühmtesten antiken Grabbau, dem Mausoleum von Halikarnaß (Abb. 2), das
zu den sieben Weltwundern gezählt wurde. Für die Grundform unserer
Monumente läßt sich daher der Begriff .Mausoleumsgrundform' verwenden. Das
Mausoleum von Halikarnaß hat seinen Namen von dem karischen König
Mausolos, für den der Grabbau um 350 v. Chr. von seiner Frau und Schwester
Artemisia errichtet worden ist. Ein griechischer Architekt, Pytheos, leitete den
Bau und am Bildschmuck wirkten die berühmtesten griechischen Bildhauer
(Skopas, Timotheos, Bryaxis, Leochares) mit. In der Antike hat man dann
freilich - wie auch noch heute - jeden stattlichen Grabbau als Mausoleum
bezeichnen können. Bewußt war jedoch, daß man Grabstätten von Königen so
nennt (Florus 2, 21, 10: „- sepulcbra regum sie vocant —").
In der wissenschaftlichen Terminologie ist der Begriff, wenn wir von ..Mauso-
leumsgrundform' sprechen, dagegen eingeschränkter: wir verwenden ihn hier
nur für Bauten, die in ihrer Grundstruktur dem Mausoleum von Halikarnaß
entsprechen.
Die Form des Grabbaus des Mausolos hat ihrerseits Vorbilder in Lykien
(Landschaft im Süden Kleinasiens): so z. B. in dem aus Xanthos nach London
transportierten sog. Nereidenmonument aus den Jahren um 400 v. Chr. (Abb.
i). Die Friese mit Kampfszenen, die den oberen Abschluß des Sockels
schmücken, hat auch das Mausoleum von Halikarnaß übernommen. Mausolos
war nach dem großen Aufstand der Satrapen gegen den persischen Großkönig
363 v. Chr. auch Herr über Lykien geworden. So erstaunt es nicht, daß
Artemisia, bzw. ihr Architekt Pytheos die Grabbauten lykischer Fürsten als
Vorbild für den Grabbau in Halikarnaß wählte. Die Bestattung von Toten in
Grabkammern auf hohen Pfeilern hat in Lykien eine alte Tradition. Es ist eine
Form, die durch die äußere .Erhöhung' der Toten ihre Entrückung in eine andere
Welt andeuten soll. Der Oberbau des Nereidenmonumentes stellt in seiner
äußeren Form einen griechischen ionischen Tempel dar (Abb. i). In klassischer
Zeit konnte es nur ein Dynast aus einem griechisch-orientalischen Randbereich
wagen, für seinen Grabbau eine Form zu übernehmen, die in Griechenland nur
den Göttern vorbehalten war. Der Anspruch des Grabherrn auf göttergleiche
Verehrung spiegelt sich auch darin, daß sich das Fürstenpaar im Giebel des
Grabtempels wie Götter thronend darstellen ließ. Der Fries über der Cella zeigt,
daß den Verstorbenen sogar Stiere geopfert worden sind.