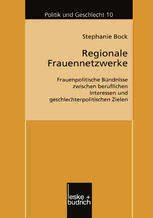Table Of ContentStephanie Bock
Regionale Frauennetzwerke
Politik und Geschlecht
Herausgegeben vom
Arbeitskreis "Politik und Geschlecht"
der Deutschen Vereinigung
für Politische Wissenschaft e.V. (DVPW)
Band 10
Stephanie Bock
Regionale Frauennetzwerke
Frauenpolitische Bündnisse
zwischen beruflichen Interessen und
geschlechterpolitischen Zielen
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2002
Gedruckt auf säurefreiem und alterungs beständigem Papier.
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Zug!.: Kassel, Universität, Diss., 2001.
ISBN 978-3-8100-3525-7 ISBN 978-3-663-11280-8 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-11280-8
© 2002 Springer Fachmedien Wiesbaden
Ursprünglich erschienen bei Leske + Budrich, Opladen 2002
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung au
ßerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages un
zulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
Dank! ............................................................................................................. 7
Einleitung ...................................................................................................... 9
1. Frauenpolitische Kooperations- und Bündnisformen ................ 17
1.1 Vernetzung als feministische Bündnispolitik:
Zum Stand der Forschung ............................................................... 18
1.1.1 Kooperationsformen von Frauen:
Von der Schwesterlichkeit zur Differenz in Netzwerken ................ 18
1.1.2 Frauennetzwerke und andere Kooperationsformen ......................... 22
1.2 Regionale Frauennetzwerke ........................................................... 27
1.2.1 Regionale Frauennetzwerke:
Eine spezifische Ausprägung von Politiknetzwerken .. , .................. 27
1.2.2 Frauennetzwerke als neue Politikform:
"Schwache" Bindungen und Informalität ....................................... 36
1.2.3 Regionale Frauennetzwerke als strategische Bündnisse ................. 41
1.2.4 Regionale Frauen- und Geschlechterpolitik .................................... 44
1.3 Fazit ................................................................................................ 45
2. Ein Weg zu neuen Politikstrukturen in der Region?
Aktuelle Entwicklungen und Forschungsergebnisse .................. 49
2.1 Region und Regionalisierung: Begriffsklärungen ........................... 52
2.2 Regionale Politikstrukturen ............................................................. 55
2.3 Frauenpolitische Akteurinnen in den Regionen:
Relevant oder unsichtbar? .............................................................. 59
2.4 Grundlegende Gemeinsamkeiten regionaler Frauennetzwerke
im Kontext aktueller Regionalpolitik .............................................. 63
2.5 Demokratisierung durch Regionalisierung? .................................... 69
3. Methodisches Vorgehen und Vorstellung der Fallbeispiele ...... 73
3.1 Auswahl der Fallbeispiele ............................................................... 73
3.2 Leitfadenorientierte Expertinneninterviews .................................... 78
5
3.3 Struktur und regionale Kontexte der ausgewählten
Frauennetzwerke ............................................................................. 84
3.3.1 Die regionale Frauenbeauftragtenkonferenz Rhein-Main ............... 84
3.3.2 Das regionale Frauennetzwerk Südostniedersachsen ...................... 88
3.3.3 Der FrauenRatschlag Stuttgart ........................................................ 92
3.3.4 Die regionalen Bestimmungsfaktoren frauenpolitischer
Netzwerkpolitik .............................................................................. 96
4. Netzwerke statt fester Bündnisse:
Ergebnisse der empirischen Untersuchung ................................ 99
4.1 Regionale Frauennetzwerke als soziale Beziehungsnetze ............... 99
4.1.1 Inklusivität und Exklusivität ......................................................... 100
4.1.2 "Gründerinnen -Macherinnen - Konsumentinnen":
Horizontale oder vertikale Netzwerkbeziehungen? ...................... 107
4.1.3 "Das Netz des Vertrauens schaffen":
Zur Bedeutung sozialer Beziehungen ...... ................ ..... ... ......... .... 110
4.2 Regionale Frauennetzwerke als Strategie regionalpolitischer
Einmischung ................................................................................. 114
4.2.1 "Die Grenze der Kirchturmspolitik überschreiten":
Gründe für eine regionale Geschlechterpolitik ............................. 115
4.2.2 "Unser Ding ist die Region": Themen der Vernetzung ................. 121
4.2.3 ,,Farbtupfer in dunkelblauen Riegen":
Strategien regionaler Frauennetzwerke . ........ ... ....... ....... ......... ...... 131
4.2.4 Regionale Geschlechterpolitik: Ein Erfolg? ................................. 140
4.3 Konsens und Konflikte zwischen beruflichen Interessen
und einer gemeinsamen Geschlechterpolitik ................................. 143
4.3.1 Rückkopplungen zwischen Netzwerkengagement und
beruflichen Tätigkeiten ................................................................. 144
4.3.2 "Denn alleine ist man nichts":
Frauennetzwerke als informelle Beziehungsnetze ...... ...... ... ... ...... 150
4.3.3 Der Netzwerkspagat zwischen "kleinstem gemeinsamem
Nenner" und Partikularinteressen ................................................. 155
4.3.4 Regionale Frauennetzwerke:
Pendeln zwischen Karriere und Politik ......................................... 159
4.4 Perspektiven der Vernetzung ........................................................ 160
5. Die Spezifik regionaler Frauennetzwerke: Zwischen
notwendiger Unschärfe und gemeinsamer Zielsetzung ........... 169
Literaturverzeichnis ................................................................................. 185
Anhang ....................................................................................................... 201
6
Danke!
Diese Arbeit zu Netzwerken hätte nicht entstehen können, ohne meine zahl
reichen ,,Netzwerke". Dass ich nicht durch die Maschen gefallen bin, sondern
die unterstützende, helfende und liebevolle Seite der Netzwerkbeziehungen
schätzen lernen konnte, verdanke ich all denen, die mich vor allem während
der Endphase dieser Arbeit begleiteten und unterstützten. Habt alle herzlich
Dank dafür.
Ein herzliches Dankeschön gilt den von mir untersuchten Frauennetzwerken,
vor allem meinen Gesprächspartnerinnen, die mit mir ihre Erfahrungen, Ein
schätzungen und besonders ihre rare Zeit teilten.
Danken möchte ich auch meinen beiden Betreuerinnen Prof. Dr. Ulla
Terlinden und Prof. Dr. Barbara Zibell, die mich dabei unterstützten, den
Wald vor lauter Bäumen nicht zu übersehen und mich davor bewahrten, mich
in den Details zu verstricken.
Ganz herzlich sei all jenen gedankt, die meine Texte gelesen, kommen
tiert, diskutiert, korrigiert und mich bei der Formulierung und Konkretisie
rung meiner eigenen Gedanken unterstützt haben: Katharina Fleischmann,
Claudia Horch, Ines Kurschat, Tanja Paulitz, Barbara Reuter, Claudia Wu
cherpfennig. Für den letzten Schliff sorgten die Herausgeberinnen der Reihe
,,Politik und Geschlecht" durch ihre konstruktiven Anmerkungen.
Für die zahlreichen aufbauenden Einladungen zu Speis' und Trank ein
dickes Danke an Gunda Thielking.
Ganz besonders möchte ich Ute Mai danken, die mir im Kampf mit
Druckformatvorlagen und allen Widrigkeiten der Computerwelt zur Seite
stand und der es in dieser bewegten Zeit immer wieder gelungen ist, mir das
Leben mit seinen vielfältigen, schillernden und lustvollen Seiten zu zeigen.
7
Einleitung
"Vernetzung ist das Stichwort unserer Zeit! Frauen machen sich stark fürein
ander. Sie kooperieren, geben Erfahrungen weiter, mischen sich ein. Sie sind
Expertinnen für Politik, Kultur, Wirtschaft, Soziales. Das gilt für Gleichstel
lungsbeauftragte ebenso wie für viele ehrenamtlich und unbezahlt arbeitende
Frauen in Verbänden, Projekten und Netzwerken" (Dickei, Brauckmann
1998, S. 3). Mit diesen Worten beginnt der begleitende Text zu einer um
fassenden Datenbank frauenspezifischer Kontaktstellen, Projekte, Organisa
tionen und Netzwerke in Deutschland. Doch weshalb entscheiden sich immer
mehr Akteurinnen für diese Form der Kooperation? Was ist das Besondere an
den zunehmenden Formen vernetzter Zusammenarbeit und was unterscheidet
die Kooperation in Netzwerken von anderen Bündnissen?
Die Forderung nach sozialer und politischer Vernetzung ist weit verbrei
tet und die Bezeichnung unterschiedlicher Kooperationsformen als Netzwerk
allerorten anzutreffen. Doch bleibt der Begriff ,,Netzwerk" schillernd und
ungenau, scheint alle Kooperationsformen gleichzeitig und doch keine spezi
fische zu umfassen. Der Unübersehbarkeit und gleichzeitigen Unübersicht
lichkeit von Frauennetzwerken stehen nur wenige systematisierende und
analysierende Arbeiten gegenüber, die sich mit diesen Kooperationen aus ein
andersetzen. Der inflationäre Gebrauch der Netzwerkmetapher für unter
schiedliche Formen der Kooperation und der Beziehungen zueinander fordert
jedoch eine tiefergehende Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen gera
dezu heraus. Auch im Rahmen der Frauenbewegung werden politische Struk
turen im Unterschied zu den Inhalten kaum thematisiert, geschweige denn
diskutiert.
Frauenpolitische Akteurinnen entwickeln im Schatten der Wahrnehmung
empirischer Forschung neue Politikformen und -strategien in Regionen: Re
gionale Frauennetzwerke, die auf lockeren und dennoch miteinander verbun
denen Kooperationsstrukturen basieren. Bei regionalen Frauennetzwerken
handelt es sich um freiwillige Kooperationen frauen- und geschlechterpoliti
scher Akteurinnen, die sich aus unterschiedlichen Gründen, beruflich oder
privat motiviert regionalpolitisch engagieren. Verbunden sind sie durch ein
gemeinsames Interesse an einer regionalen Frauen- und Geschlechterpolitik
bzw. ihren Bezug auf ein feministisches Politikverständnis. Mit und in Netz-
9
werken verfolgen regionale Akteurinnen eine Erweiterung und Veränderung
regionalpolitischer Debatten um geschlechterpolitische Inhalte. Soziale und
politische Bündnisse von Frauen, die somit im regionalen Kontext entstehen,
sind als Teil regionalpolitischer Strukturen zu begreifen und bilden einen
Knotenpunkt in den politischen Akteurlnnennetzen einer Region. Regionale
Netzwerke von Frauen stellen gleichzeitig eine mögliche Antwort auf die
Frage nach zukünftigen Organisationsformen im Kontext feministischer
Bündnispolitik dar. Auf der einen Seite zielen sie auf eine verstärkte Teilhabe
und Präsenz von Frauen in machtvollen Positionen, auf der anderen Seite
kämpfen sie für den Abbau von Herrschaftsverhältnissen. Sie verfolgen die
Umsetzung eines erweiterten Zugangs von Frauen zu politisch-öffentlichen
Strukturen und entwickeln Ansatzpunkte eines geschlechterpolitischen Ver
ständnisses regionaler Bezüge.
Heide Funk und Gerrit Kaschuba (1994) verorten diese Kooperations
formen im Spannungs feld zwischen traditioneller ,,Ehrenamtlichkeit" und
neuen politischen Initiativen und identifizieren sie unter Verweis auf ihre
Netzwerkstrukturen als Potenzial einer eigenständigen politischen Öffentlich
keit von Frauen. Frauenpolitische Initiativen zu Regionalentwicklung und
Regionalplanung können als neue Wege politischer Einflussnahme beschrie
ben werden. Sie formen ein Aktionsfeld, dem bisher von Seiten der Frauen
und Geschlechterforschung nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Diese in den vergangenen zehn Jahren verstärkt in Erscheinung tretenden
regionalen Netzwerke von Frauen, die auch meine berufliche Tätigkeit als
Regionalplanerin begleiteten, weckten meine wissenschaftliche Neugier: Wa
rum schließen sich frauenpolitische Akteurinnen in Netzwerken zusammen?
Was bewegt sie, sich mit regionalen Prozessen und Strukturen zu beschäfti
gen? Da sie, so meine berufliche Wahrnehmung, erfolgversprechende Strate
gien entwickeln, um Aspekte des Geschlechterverhältnisses in die Gestal
tungsprozesse einer Region einzubringen, und sich zudem aktiv in die ent
sprechenden Politikprozesse einmischen, war mein wissenschaftliches Inter
esse geweckt.
Nachgegangen wird in dieser Untersuchung deshalb als einer Ausprägung
politischer Vernetzungen von Frauen dem Phänomen regionaler Frauennetz
werke, die im Kontext regionaler Politikprozesse als besondere Organisati
onsformen mit bestimmten Stärken und Schwächen aufgebaut und weiterent
wickelt werden. Dabei verorte ich die Beschäftigung mit regionalen Frauen
netzwerken an der Schnittstelle zwischen Planungs- und Politikwissenschaft.
In der Analyse ,,regionaler Frauennetzwerke" verbinden sich drei Kontexte,
die allesamt intensiv diskutiert werden und vielversprechend sind: Netzwerke
als Kooperationsmodelle, die auf Grund ihrer lockeren Strukturen Verbindun
gen und Solidarität ohne Zwang und Verpflichtung versprechen,jrauenpoliti
sehe Akteurinnen, die sich in zahlreiche Differenzen zersplittert auf der Suche
nach einem dennoch gemeinsamen Weg befinden und schließlich die Region
10
als neu entdeckte Ebene verbunden mit Erwartungen an bessere Politik und
Mitwirkung.
Zwei wissenschaftliche Diskussionsstränge liegen darauf aufbauend den
Überlegungen dieser Untersuchung zugrunde. Die zunehmenden Diskussi
onen um neue Bündnisformen frauenpolitischer Akteurinnen im Kontext der
Frauenbewegung, die ausgelöst durch die theoretische Debatte um ein zu
künftiges "feministisches Wir" in eine kritische Reflexion der vorhandenen
Politikformen der Frauenbewegung münden, dienen als ein Ausgangspunkt.
Dabei beziehe ich mich auf die wachsende Artikulation von Differenzen und
Unterschieden nicht nur zwischen sondern innerhalb der Geschlechter, die
neue Formen politischer Kooperation erforderlich machen. Poststrukturalisti
sche Theoretikerinnen haben durch ihr rigoroses Infragestellen einer gemein
samen Geschlechteridentität und eines einheitlichen Subjekts feministischer
Politik die Diskussionen um neue Politikformen der Frauenbewegung(en)
intensiviert. Auch wenn ihr provozierender Ton Widerspruch hervorruft, folgt
aus einer positiven Aufnahme ihrer Thesen, wie zu zeigen sein wird, nicht
unweigerlich das Ende jeder politischen Handlungsfahigkeit. Vielmehr er
scheinen ihre Überlegungen relevant für eine Beschäftigung mit Politiknetz
werken von Frauen, da Bündnisse unterschiedlicher Ausprägung und diffe
renter AkteurInnen als zukünftige Politikformen feministischer Bewegungen
in den Mittelpunkt rücken, so dass Netzwerke als politische Organisations
form entdeckt und aufgewertet werden. Hieraus lassen sich relevante Überle
gungen für eine zukünftige Politik der Frauenbewegung und ihre Aktionsfor
men ableiten.
Netzwerke sind eine mögliche Antwort auf die Frage nach den geeigne
ten Kooperations- und Politikformen eines gemeinsamen politischen Han
delns auf der Grundlage einer Anerkennung von Differenzen unter Frauen.
Ob Netzwerke nun "offene Bündnisse" in diesem Sinne darstellen oder ob
Bündnispolitik eine gemeinsame Identität voraussetzt bzw. diese im Prozess
des Netzwerkens entsteht, ist eine empirisch bisher nicht vertiefte Fragestel
lung und berührt auch im Kontext von Frauenbewegung und Frauenpolitik
selten verfolgte Überlegungen. Dieser Problemkontext soll in dieser Untersu
chung aufgegriffen werden. Dabei knüpft er an das Defizit politikwissen
schaftlicher Forschung an, die sich bisher kaum mit den von unterschiedli
chen Akteurinnen gebildeten Kooperationsformen befasst und die Frage nach
Motiven, internen Konflikten und der Binnenstruktur der Netzwerke der so
zialen Netzwerkforschung überlassen hat.
Gleichzeitig ziehe ich als zweiten wissenschaftlichen Zugang dieser Un
tersuchung die im Kontext der Debatte um die Aufwertung der Regionen
konstatierte Demokratisierung regionaler Politikprozesse durch Politiknetz
werke hinsichtlich ihrer Folgen für eine Geschlechterperspektive heran. Be
zug nehme ich dabei auf die Debatten um die Implikationen einer Regionali
sierung politischer Strukturen und Inhalte, wobei vor allem die Erweiterung
11