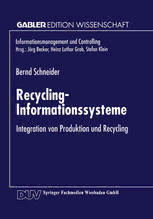Table Of ContentSchneider
Recycl in g-1 nformationssysteme
GABLER EDITION WISSENSCHAFT
Informationsmanagement und Controlling
Herausgegeben von
Professor Dr. Jörg Becker
Professor Dr. Heinz Lother Grob
Professor Dr. Stefan Klein
Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Münster
Informationsmanagement und Controlling stellen Führungsfunktionen
von Unternehmungen und Verwaltungen dar. Während die Aufgabe
des Informationsmanagements in der effizienten, auch strategisch ori
entierten Gestaltung des betrieblichen Informationseinsatzes sowie
technologiegestützter Informationssysteme und -infrastrukturen be
steht, hat Controlling die Entwicklung und Nutzung einer auf Informa
tionssystemen basierenden Infrastruktur zur koordinierten Durchfüh
rung von Planung und Kontrolle zum Inhalt. Angesichts zunehmender
Verflechtungen und Kooperationen zwischen Unternehmungen gewin
nen interorganisatorische Aspekte für beide Bereiche an Bedeutung.
Die Schriftenreihe greift diese Fragen auf und stellt aktuelle For
schungsergebnisse aus der Wirtschaftsinformatik und der Betriebs
wirtschaftslehre zur Diskussion.
Bernd Schneider
Recycling-
!
nformationssysteme
Integration von Produktion
und Recycling
Mit einem Geleitwort
von Prof. Dr. Stefan Klein
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Schneider, Bernd:
Recycling-lnformationssysteme : Integration von Produktion und Recycling
/ Bernd Schneider. Mit einem Geleitw. von Stefan Klein.
(Gabler Edition Wissenschaft : Informationsmanagement und Controlling)
Zugl.: Münster (Westf.), Univ., Diss., 1999
ISBN 978-3-8244-7018-1 ISBN 978-3-663-08913-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-08913-1
D 6 (1999)
Alle Rechte vorbehalten
© Springer Fachmedien Wiesbaden 1999
Ursprünglich erschienen bei Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH,
Wiesbaden, und Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden, 1999
Lektorat: Ute Wrasmann / Monika Mülhausen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechrlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung des Verlage.~ unzulässig und strafbar. Das gilt insbeson
dere für Vervielfältigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
http:/ /www.gabler-online.de
http:/ /www.duv.de
Höchste inhaltliche und technische Qualität unserer Produkte ist unser Ziel. Bei der Produktion
und Verbreitung unserer Bücher wollen wir die Umwelt schonen. Dieses Buch ist deshalb auf säu
refreiem und chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die Einschweißfolie besteht aus Polyäthylen
und damit aus organischen Grundstoffen, die weder bei der Herstellung noch bei der
Verbrennung Schadstoffe freisetzen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Na
men im Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären
und daher von jedermann benutzt werden dürften.
ISBN 978-3-8244-7018-1
Geleitwort V
Geleitwort
Demontage und Recycling sind wichtige Elemente einer kreislauforientierten und ressourcen
schonenden Wirtschaft. Ähnlich wie bei der Produktion ist zu erwarten, daß die Effizienz von
Demontage-und Recyclingprozessen durch Planungs-und Steuerungssysteme verbessert wer
den kann. Während die Konzepte zur computergestützten Produktionsplanung und -Steuerung
(PPS) weit fortgeschritten sind, sind wesentliche Bereiche einer computergestützten Demon
tage- und Recyclingplanung und -Steuerung (DRPS) bislang allerdings erst ansatzweise
behandelt worden. Da die Demontage - abstrakt betrachtet - die Umkehrung der Montage
darstellt, liegt es nahe, die Anwendbarkeit von Ansätzen aus dem Bereich der PPS auf die
DRPS zu überprüfen.
Bemd Schneider greift die Vermutung einer strukturellen Ähnlichkeit zwischen Produktion
und dem inversen Prozeß der Demontage auf, kommt bei seiner Analyse aber zu tiefgreifen
den Unterschieden zwischen PPS und DRPS. Diese betreffen insbesondere den Informations
bedarf und die Planungskalküle. Daher konzipiert er als Basis zur Entwicklung eines DRPS
Systems zunächst die Datenstruktur "Verwertungsgraph". Herr Schneider integriert dabei Er
gebnisse eines empirischen Forschungsprojektes und nimmt Bezug auf die CALS-Initiative,
die die Erarbeitung von Methoden und Standards eines lebenszyklusumfassenden Informa
tionsmanagements zum Ziel hat.
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Kapitel l bis 3 behandeln die Grundlagen, Ein
flußgrößenund Rahmenbedingungen der DRPS. Herr Schneider erarbeitet eine Systematisie
rung von Recyclingtypen und -prozessen sowie einen morphologischer Kasten der Betriebsty
pen. Am Beispiel der Altautoentsorgung und des Elektro-bzw. Elektronikrecyclings werden
die erarbeiteten Systematisierungen angewendet und überprüft.
Die Kapitel 4 bis 6 bilden den Kern der Arbeit. Ausgehend von der Grunddatenverwaltung
erläutert Herr Schneider die verschiedenen Facetten der Fertigungsplanung und -steuerung
und erörtert ihre Übertragbarkeit auf die DRPS. In Anlehnung an die sogenannten "Recy
clinggraphen" wird die Datenstruktur "Verwertungsgraph" entwickelt. Dabei werden ver
schiedene Formen der Repräsentation von für das Recycling relevanten
• Struktur-(Aufbau der Baustruktur),
• Prozeß-(Abbilden des Demontagepfades) und
• Aggregationsinformationen (Bildung von Baugruppen)
erörtert. Anhand konkreter Beispiele aus dem Automobilrecycling werden unterschiedliche
Anforderungen an Verwertungsgraphen, zum Beispiel Repräsentation von Fertigungs- und
Zustandsvarianten, Bearbeitungsfolgen oder Materialverträglichkeiten, identifiziert und im
Hinblick auf den Entscheidungsprozeß bei Demontage und Recycling veranschaulicht. Aus
der Perspektive des Produktlebenszyklus werden Möglichkeiten und Grenzen der Verbesse
rung der Demontage-und Recyclingplanung durch eine verbesserte Dokumentation von Pro
duktionsdaten erörtert.
VI Geleitwort
Herr Schneider hat sich einem komplexen Problemausschnitt der Demontage-und Recycling
planung zugewendet. Neben der konstruktiven Leistung des Entwurfs einer Datenstruktur für
Verwertungsgraphen liegt ein wesentliches Verdienst der Arbeit darin, Möglichkeiten und
Grenzen der Übertragung von Ansätzen der PPS überprüft und eine detaillierte und systemati
sche Analyse von organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen von Demontage
und Recycling, insbesondere am Beispiel von Automobilen und Elektronikprodukten, aufge
zeigt zu haben.
Es ist zu hoffen, daß sein Beitrag aufgegriffen und zur Entwicklung eines DRPS eingesetzl
wird.
Stefan Klein
Votwort VII
Vorwort
In den letzten Jahren ist ein tiefgreifender Wandel im Umweltbewußtsein zu beobachten, der
nicht nur das Denken und Handeln des einzelnen prägt, sondern sich auch auf die Unterneh
mung erstreckt. Wo früher achtlos die Ressource "Umwelt" - die Umwelt diente gleicher
maßen als Rohstoffquelle als auch als Platz für die Entsorgung von Abfällen aller Art -ge
nutzt wurde, tritt zunehmend eine ökologisch vertretbare Nutzung. Häufig ist jedoch das öko
logische Handeln kein reiner Selbstzweck der Unternehmen, sondern wird vielmehr durch
harte ökonomische Kalküle begründet: Die Förderung der Ökologie geschieht hier über den
Umweg der Ökonomie.
Neben der umweltgerechten Produktion kommt der umweltgerechten Entsorgung -insbeson
dere komplexer Massengüter- eine zunehmende Bedeutung zu. Dies belegen Vorhaben und
Aktivitäten des Gesetzgebers wie Altauto- und Elektroschrott-Verordnung sowie diverse
Rücknahmeverpflichtungen.
Vor dem Hintergrund der Ökonomie kommt der wirtschaftlichen Durchfiihrung- bzw. einer
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit-von Demontage-und Recyclingmaßnahmen eine große
Bedeutung zu. Eine Rationalisierung der Geschäftsprozesse kann dabei auf zwei Ebenen er
folgen: Zum einen kann eine technische Rationalisierung über einen höheren Automatisie
rungsgrad durch spezielle Betriebsmittel erfolgen, zum anderen ist eine organisatorische
Rationalisierung auf der Basis einer besserenlgenaueren/wirklichkeitsnäheren Planung reali
sierbar. Die Wirksamkeit einer organisatorischen Rationalisierung hängt in weiten Bereichen
wesentlich von der Verfügbarkeit von Informationen über die zu behandelnden Produkte, die
Qualität dieser Daten und die Form ihrer Strukturierung ab.
Ausgehend von einer Erhebung der Anforderungen an eine solche Datenstruktur -wobei als
Nebenbedingung eine "Abwärtskompatibilität" mit Datenstrukturen aus der Produktionspla
nung und -Steuerung aufgenommen wurde -erfolgte in der Arbeit eine Modeliierung der Da
tenstruktur Verwertungsgraph. Zum Abschluß der Arbeit werden Einsatz-und Anwendungs
potentiale von Verwertungsgraphen im gesamten Produktlebenszyklus aufgezeigt.
Ein "Promotionsprojekt" ist- zumindest in vielen Phasen -für den Autor weniger "anstren
gend" als für seine persönliche Umwelt. Allen zu danken, die zum Gelingen dieser Arbeit bei
getragen haben, ist daher ein aussichtsloses Unterfangen.
Mein besonderer Dank gilt aber meinem Doktorvater, Herrn Prof Dr. Kar! Kurbel, von dem
ich während der gemeinsamen Arbeit viel über das "Handwerk Wissenschaft" lernen konnte
und dessen wahrer Wert sich oft erst viel später offenbarte. Herrn Prof Dr. Stefan Klein, mei
nem Zweitgutachter und jetzigem Chef, gebührt viel Dank für seine stete Diskussionsbereit
schaft, seine Ermunterungen, und vor allem für sein großes Verständnis und Entgegenkom
men, mir während der "langen heißen Phase" meiner Arbeit die Freiräume zum Abschluß
meines Dissertationsvorhabens zu gewähren.
VIII Vorwort
Für viele Anregungen und kritische Diskussionen in der frühen Phase meiner Arbeit danke
ich Herrn Prof. Dr. Claus Rautenstrauch, sowie "meinen" Diplomanden Dipi.-Wirt. Inform.
Andre Etzrodt, Dipi.-Wirt. Inform. Jörg Schaper und Dipi.-Wirt. Inform. Martin Stobitzer.
Ihre Arbeiten ermöglichten eigentlich erst eine Präzisierung und Abgrenzung der Thematik
meiner Arbeit.
Mein größter Dank gilt jedoch meiner Frau Monika und meiner Tochter Samantha (wenn
gleich letztere mit ihren I V2 Jahren sicher nichts mit den Worten "Papa schreibt an seiner
Diss." anfangen konnte), meinen Eltern und meinen Schwiegereltern, die mich in jeder Bezie
hung unterstützten und ohne die mein "Projekt D" wohl nicht hätte realisiert werden können.
Bernd Schneider
Inhaltsverzeichnis IX
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1.1 Ausgangslage und Problemstellung
1.2 Zielsetzung, Motivation und Eingrenzung 4
1.3 Vorgehensweise und Gliederung 14
2 Recycling und Demontage - Begriffe und Konzepte 17
2.1 Allgemeine Begriffe 18
2.2 Entsorgung und Entsorgungsgüter 19
2.3 Recycling-Kreislauftypen 22
2.4 Recycling-Formen 23
2.5 Recycling-Behandlungsprozesse 24
2.6 Recycling komplexer zusammengesetzter Produkte 26
2.7 Aufgaben und Bedeutung der Demontage 30
2.8 Einflußgrößen auf die Demontage 30
2.9 Betriebstypologien von Recycling-und Demontagebetrieben 34
3 Abläufe und Strukturen in Produktions-und Recyclingunternehmen 37
3.1 Aufgaben, Ziele und Ablauf der PPS und DRPS 37
3.2 Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Produktion und Recycling 39
3.3 Marktstrukturen und Implikationen auf die Planung 43
3.4 Unternehmenstypen und Planungsprinzipien 46
3.5 Gegenwärtige Situation in der Entsorgungsbranche 49
3. 5 .1 Demontagetechnologien 50
3.5.2 Zukünftige Entwicklung 51
3. 5 .3 Unsicherheiten bei der Demontage 53
3.6 Fallstudie Altautoentsorgung 54
3. 7 Fallstudie Elektro-und Elektronikaltproduktrecycling 63
3.8 Materialflüsse in Demontage-und Recyclingunternehmen 72
4 Adaption von Ansätzen und Konzepten der Produktionsplanung und -Steuerung 76
4.1 Grunddaten und Grunddatenverwaltung 78
4.1.1 Der Begriff "Teil" 82
4.1.2 Teilestammdaten 86
4 .1.3 Erzeugnisstrukturen und abgeleitete Darstellungsformen 90
4.1.4 Arbeitsgänge und Arbeitspläne 97
4.1.5 Ressourcen-, Arbeitsplatz-und Betriebsmitteldaten 101
4.1.6 Fertigungsstrukturdaten 106
4.1.7 Betriebskalender und Schichtmodell 108
4.1.8 Lieferanten-, Kunden-und Lagerdaten 108
4.1.9 Detaillierung der Grunddaten 109