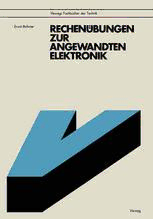Table Of ContentErwin Bohmer
Rechenubungen zur angewandten Elektronik
~- Aus dem Programm
Elektrotechnik/Elektronik
Grundlagenwerke
Elemente der angewandten Elektronik
von E. Bohmer
und erganzend
Konstruktive Gestaltung
und Fertigung in der Elektronik
von H. Muller
Band 1: Elementare integrierte Strukturen
Band 2: Prinzipien konstruktiver Gestaltung
Erganzende Obungsbucher
E lektron i k- Aufgaben
Bauelemente - Analoge Schaltungen - Digitale Schaltungen
von H. Brauer und C. Lehmann
Elektroaufgaben, von H. Lindner und E. Balcke
Band III: Leitungen, Vierpole, Fourier-Analyse,
Laplace-Transformation
Beispiele und Aufgaben zur Laplace-Transformation,
von H. J. Lohr
Einfache Ausgleichsvorgange der Elektrotechnik,
von K. Hoyer und G. Schnell
Analyse elektrischer und elektronischer Netzwerke
Mit BASIC-Programmen (Sharp PC-1251 und PC-1500),
von D. Lange
Vieweg -----------------/
~
Erwin Bohmer
Rechenubungenzur
angewandten Elektronik
3., tiberarbeitete und erweiterte Auflage
Mit 92 Aufgaben und Losungen,
zum Teil mit BASIC-Programmen
Friedr. Vieweg & Sohn Braunschweig/Wiesbaden
CI P-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Bohmer, Erwin:
Recheniibungen zur angewandten Elektronik /
Erwin Bohmer. - 3 .. iiberarb. u. erw. Aufl. -
Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg. 1987.
(Viewegs Fachbiicher der Technikl
Dr.-Ing. Erwin Bohmer ist Professor fur Technische Elektronik
an der Universitat-Gesamthochschule Slegen
1. Auflage 1981
Nachdruck 1982
2., uberarbeitete Auflage 1984
Nachdruck 1985
3., uberarbeitete und erweiterte Auflage 1987
Aile Rechte vorbehalten
© Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH. Braunschweig 1987
Softcover reprint of the hardcover 1s t edition 1987
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschiitzt. Jede Verwertung in
anderen als den gesetzlich zugelassenen Fallen bedarf deshalb der vorherigen
schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Lengericher Handelsdruckerei. Lengerich
ISBN-l3: 978-3-528-24189-6 e-ISBN-13: 978-3-322-86181-8
DOl: 10.1007/978-3-322-86181-8
VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE
Der vorliegende Aufgabenband will Studenten der Elektrotechnik und
der Physik in die Berechnung elektronischer Schaltungen einfUhren.
Am Anfang stehen Rechenbeispiele mit Wider standen tmd Dioden. Es
folgen Netzwerke mit Kondensatoren und Spulen, anschlieBend Ver
starkerschaltungen mit Feldeffekttransistoren, bipolaren Transisto
ren und Operationsverstarkern. Lineare und nichtlineare Probleme
werden gleichermaBen behandelt. Die einzelnen Aufgaben werden in
einer Themenfolge dargestellt, wobei eine Untergliederung in sechs
Kapitel vorgenommen wird, die nach den jeweils dominierenden Bau
elementen benannt sind.
Vorausgesetzt werden beirn Leser Kenntnisse der Gleich- und Wechsel
stromlehre, wie sie in den ersten Studiensemestern erworben werden,
sowie Grundkenntnisse ftber die jeweiligen Bauelemente. Sofern dazu
eine Nacharbeitung erforderlich ist, kann man den Hinweisen auf das
irn gleichen Verlag erschienene Lehrbuch "Elemente der angewandten
Elektronik" folgen.
Das vorliegende tibungsmaterial habe ich fUr einfuhrende Lehrveran
staltungen zur elektronischen Schaltungstechnik an der universitat
Gesamthochschule Siegen zusammengestellt. Dabei wurde ich durch
interessierte Studenten und Mitarbeiter wesentlich unterstutzt.
Besonders dankbar bin ich fUr den Einsatz von Herrn cando ing.
Eberhard Schmick, der die Zeichnungen anfertigte und beirn Korrektur
lesen half. Herr Ing. grad. Horst otto hat wie bei der Erarbeitung
des oben genannten Lehrbuches wieder die Schaltungen irn Laborexpe
riment Uberprftft. Frau Andrea Winkel hat einen GroBteil der Aufgaben
texte und LOsungen geschrieben, wofftr ich ebenfalls danke.
Siegen, im August 1980
VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE
Abgesehen von wenigen Verbesserungen hat sich die Neuauflage gegenuber
der ersten Auflage nicht verandert. Die den Aufgaben jeweils voran
gestellten Hinweise sind auf die inzwischen erschienene zweite Auf
lage des Lehrbuches angepaBt worden.
Siegen, im August 1983 Erwin BOhmer
VORWORT ZUR DRITTEN AUFLAGE
Die vorliegende dritte Auflage wurde angepaBt an die bereits erschie
nene vierte Auflage des Lehrbuches. In einem zusatzlichen Anhang C
wird an einigen Beispielen die EinsatzmOglichkeit eines Mikrocomputers
bei der Schaltungsberechnung gezeigt. Bei der Erstellung der Programme
hat mich Herr Dr.-Ing. E. LOcherbach unterstutzt. Fraulein Iris Thomas
schrieb die Kommentare, wofur ich mich bedanke.
Siegen, im Dezember 1986
Erwin BOhmer
v
INHALTSVERZEICHNIS
Einfuhrung ---------------------------------------------- 1
I Widerstande und Dioden
I. 1 Belasteter Spannungsteiler --------------------------------- 2
I. 2 Schichtwiderstand - Temperaturbeziehungen ------------------ 4
I. 3 Schichtwiderstand - Frequenzgang --------------------------- 5
I. 4 Drahtwiderstand -------------------------------------------- 6
I. 5 Widerstandsrauschen ---------------------------------------- 7
I. 6 Varistor - nichtlinearer Widerstand ------------------------ 8
I. 7 Kaltleiter - PTC-Widerstand -------------------------------- 9
I. 8 HeiBleiter - I-U-Kennlinien -------------------------------- 10
I. 9 KompensationsheiBleiter ------------------------------------ 11
I.lO HeiBleiter - MeBbrucke ------------------------------------- 12
I.ll Fotowiderstand --------------------------------------------- 14
I.l2 Feldplatte ------------------------------------------------- 15
I.l3 Siliziumdiode - Kennlinien --------------------------------- 16
I.l4 Reihenschaltung Diode - Widerstand ------------------------- 17
I.15 Fotodiode - Fotoelement ------------------------------------ 18
I.l6 Leuchtdioden - Antiparallelschaltung ----------------------- 19
I.17 Spannungsstabilisierung mit Z-Diode ------------------------ 20
I.18 Begrenzerschaltung mit Z-Diode ----------------------------- 22
I.19 Begrenzerschaltungen mit vorgespannten Dioden -------------- 23
II Kondensatoren und Widerstande
II. 1 Kondensator an ohmschem Spannungsteiler -------------------- 24
II. 2 Kondensator mit Wechselladung ------------------------------ 25
II. 3 ImpulsUbertragung durch RC-Glieder ------------------------- 26
II. 4 Einschwingvorgang am RC-HochpaB ---------------------------- 27
II. 5 RC - Spannungsteiler --------------------------------------- 28
II. 6 Tastteiler zum Oszilloskop --------------------------------- 30
II. 7 Dreigliedriger RC-TiefpaB ---------------------------------- 32
II. 8 Dreigliedriger RC-HochpaB ---------------------------------- 33
II. 9 Wien - BrUckenschaltung ------------------------------------ 34
II.l0 Doppel - T - Filter ---------------------------------------- 35
II.ll Kondensatoraufladung mit rampenformiger Spannung ----------- 36
II.12 Kondensatoraufladung mit Wechselspannung ------------------- 37
II.13 Einweggleichrichter mit Ladekondensator -------------------- 38
II.14 Lineare und quadratische Gleichrichtung -------------------- 40
II.15 Parallelgleichrichterschaltungen --------------------------- 41
III Spulen, Schwingkreise und tlbertrager
III. 1 NF - Eisendrosselspule ------------------------------------- 42
III. 2 LC - Siebschaltung ----------------------------------------- 43
III. 3 Spule mit Ferritschalenkern -------------------------------- 44
III. 4 Spule mit Gleichstromvormagnetisierung --------------------- 45
III. 5 Spule mit hoher GUte --------------------------------------- 46
III. 6 Parallelschwingkreis --------------------------------------- 47
III. 7 Spannungsteiler mit Parallelschwingkreis ------------------- 48
III. 8 Schaltvorgange am Parallelschwingkreis --------------------- 50
III. 9 Parallelschwingkreis als ResonanzUbertrager ---------------- 52
III.l0 Breitband - AnpassungsUbertrager --------------------------- 54
III.ll ImpulsUbertrager ------------------------------------------- 56
VI
IV Feldeffekttransistoren
IV. 1 JFET - Kennlinien in 2-parameterdarstellung ------------ 58
IV. 2 JFET als spannungsgesteuerter Stromsteller ----------------- 59
IV. 3 JFET als spannungsgesteuerter Wider stand ------------------- 60
IV. 4 Wechselspannungsteiler mit JFET ---------------------------- 61
IV. 5 JFET - Kennlinien in 3-Parameterdarstellung ---------------- 62
IV. 6 Konstantstromschaltung mit JFET ---------------------------- 63
IV. 7 JFET als Kleinsignalverstarker ----------------------------- 64
IV. 8 Sourceschaltung - Analyse der Parameterstreuung ------------ 65
IV. 9 Sourceschaltung - Frequenzganganalyse ---------------------- 66
IV.l0 Mehrstufiger Verstarker in Sourceschaltung ----------------- 68
IV. 11 Drainschaltungen (Sourcefolger) ---------------------------- 70
IV.12 Gateschaltung ---------------------------------------------- 72
IV. 13 Gegentaktschaltung ----------------------------------------- 73
IV.14 MOSFETs - Kennlinien und Ersatzschaltbild ------------------ 74
IV.15 MOSFETs als Umkehrverstarker ------------------------------- 75
IV.16 MOSFET als Schalter ---------------------------------------- 76
V Bipolare Transistoren
V. 1 Emitterschaltung - GroBsignalverhalten --------------------- 78
V. 2 Transistor mit Widerstandssteuerung ------------------------ 80
V. 3 Transistor als Schalter ------------------------------------ 81
v. 4 Emitterschaltung als einfacher Kleinsignalverstarker ------- 82
V. 5 Emitterschaltung mit Parallelgegenkopplung ----------------- 84
V. 6 Gegenkopplung und Klirrdampfung ---------------------------- 86
V. 7 Emitterschaltung mit Emitterwiderstand --------------------- 88
V. 8 Emitterschaltung mit Emitterwiderstand als Stromquelle ----- 90
V. 9 Emitterfolger (Kollektorschaltung) ------------------------- 92
V.l0 Bootstrap - Schaltungen ------------------------------------ 94
V.11 Emitterschaltung mit Uberbrucktem Emitterwiderstand -------- 96
V.12 Emitterschaltung mit unterteiltem Emitterwiderstand -------- 98
V.13 NF - Verstarker mit starker Gleichstromgegenkopplung ------- 100
V.14 NF - Verstarker mit Wechselspannungsgegenkopplung I -------- 102
V.15 NF - Verstarker mit Wechselspannungsgegenkopplung II ------- 104
V.16 Dreistufiger Breitbandverstarker --------------------------- 106
V.17 Schmalbandverstarker --------------------------------------- 108
VI Operationsverstarker
VI. 1 Nichtinvertierender Verstarker ----------------------------- 110
VI. 2 Invertierender Verstarker ---------------------------------- 111
VI. 3 Bruckenverstarker ------------------------------------------ 112
VI. 4 Aktive BrUckenschaltung ------------------------------------ 113
VI. 5 Umschaltbarer Spannungsverstarker -------------------------- 114
VI. 6 Frequenzgang und Stabilitat -------------------------------- 116
VI. 7 Wechselspannungsverstarker --------------------------------- 118
VI. 8 Aktive RC - Filter ----------------------------------------- 120
VI. 9 Empfindlicher Strom-Spannungs-Wandler ---------------------- 122
VI. 10 Spannungs-Strom-Wandler fur erdfreie Last ------------------ 124
VI.11 Spannungs-Strom-Wandler fur geerdete Last ------------------ 126
VI.12 Spannungs-Strom-Wandler fUr groBe Strome ------------------- 128
Anhang A Miller-Theorem ---------------------------------- 130
Anhang B Blockbild-Darstellung---------------------------- 131
Anhang C BASIC-programme---------------------------------- 132
Sachwortverzeichnis----------------------------------------- 14&
VII
EINFOHRUNG
Grundlage fur die Berechnung einer elektronischen Schaltung
ist in der Regel ihr sogenanntes Ersatzschaltbild (kurz: Er
satzbild), mit dem die Eigenschaften der Schaltung modellar
tig nachgebildet werden. In einfachen Fallen - z.B. beim
ohms chen Spannungsteiler - ist bei tie fen Frequenzen das nor
male Schaltbild auch als Ersatzschaltbild verwendbar. Fur den
Bereich hoherer Frequenzen mussen jedoch auch in diesem ein
fachen Fall Kapazitaten und eventuell Induktivitaten hinzuge
fugt werden, um dann auftretende "parasitare" Effekte zu er
fassen. Grundsatzlich stellt ein so erweitertes Ersatzbild
nur eine unvollkommene Nachbildung der wirklichen Schaltung
dar und hat auch stets nur einen begrenzten Gultigkei"tsbe
reich. Die auf ihm basierende Rechnung kann also nur eine Na
herungsrechnung sein, die naturlich umso genauer wird, je bes
ser die Nachbildung ist. An dieser Stelle muB allerdings da
vor gewarnt werden, stets eine moglichst vollkommene Nachbil
dung anzustreben. Der damit verbundene Aufwand ist normaler
weise unvertretbar. Abgesehen davon bereitet die Beschaffung
einzelner Parameter Schwierigkeiten. Viel wichtiger ist fur
die Schaltungspraxis die Entwicklung eines einfachen Ersatz
bildes im Sinne einer ersten oder zweiten Naherung, aus dem
die wesentlichen funktionalen Zusammenhange klar erkennbar
werden.
Nach diesem Grundsatz wird bei den folgenden Rechenbeispielen
verfahren, wobei zur Rechenvereinfachung haufig zwei Wege be
schritten werden:
1. Lineare Widerstandsnetzwerke in Verbindung mit Quellen wer
den zu einer einfachen Spannungsersatzschaltung oder Strom
ersatzschaltung reduziert.
2. Bei Verstarkerschaltungen mit einer Kopplung zwischen Ein
gang und Ausgang wird die Kopplung moglichst nach dem Mil
ler-Theorem aufgelost.
Das erste Verfahren ist Studenten normalerweise gelaufig, wah
rend das zweite eine besondere Einfuhrung verdient, die im An
hang A gegeben wird. Daran anschlieBend wird im Anhang B die
Methode der Blockbild-Darstellung eines Netzwerkes erklart, die
bei der Beschreibung gegengekoppelter Systeme von Nutzen ist,
um den Wirkungsmechanismus der Gegenkopplung besonders deutlich
zu machen.
In einem Anhang C wird am Beispiel einiger Aufgaben aus den vor
angegangenen Kapiteln gezeigt, wie man sich eines Computers zur
Losung spezieller elektrotechnischer Probleme bedienen kann.
Mitgeteilt werden dazu einige einfache Basic-Programme, die An
regungen zur eigenen Programmentwicklung geben sollen. Drei zu
satzliche Programme zur Normwertbestimmung fur Widerstande kon
nen zudem fur den Schaltungsentwickler hilfreich sein.
Als nutzliche Rechenhilfsmittel sind auf dem ruckseitigen Buch
deckel eine Kurventafel und die bekannte "HF-Tapete" abgebil
det. Die erstere kann der Fehlerabschatzung bei Naherungsrech
nungen dienen. Die "HF-Tapete" ist hilfreich bei allen Schal
tungsanalysen und - dimensionierungen in Verbindung mit Kapazi
taten und Induktivitaten. Sie dient der uberschlagigen Rechen
kontrolle und kann in manchen Fallen auch die Rechnung ersparen.
-1-
WIDERSTANDE UND DIODEN
[ 1. 1 Belasteter Spannungsteiler
Lehrbuch: Abschnitt 1.5
Gegeben sei ein Spannungsteiler mit den linearen Wider standen
Rl und R2 an der Spannung U1' Der Ausgang des spannungsteilers
w rd mit einem variablen Widerstand RL belastet.
I1 U1 10 V
R1 f1-: R1 400 Q
I2
U1 I R2 600 Q
Rz ~j RL
a) Man berechne allgemein die Spannung U21 den Strom I2 sowie
die vom Lastwiderstand aufgenommene Leistung P2'
b) In welcher Beziehung stehen die Strome I2 und I1 zueinander?
c) Man stelle die drei GraBen nach a) in einem Diagramm mit
logarithmischer Teilung der Achsen in Abhangigkeit von dem
Lastwiderstand RL dar.
d) Durch eine Leerlauf- und KurzschluBbetrachtung ermittle man
das Spannungsquellen- und Stromquellenersatzbild fUr die
Spannungsteilerschaltung.
e) Man stelle die Ausgangsspannung U2 in Abhangigkeit vom Aus
gangsstrom I2 dar.
f) Bei welchem Lastwiderstand RL ist die Ausgangsspannung
gerade halb so groB wie die Leerlaufspannung?
g) Welche Leistung P2 ergibt sich zu f) ?
L6sungen
R2 • RL
R2 +RL
a} u .
1
R2'~
R +---
1 R2+RL
2
U .
1
Man prufe an diesem Beispiel die
GGltigkeit der folgenden sehr
nutzlichen Stromteilerregel.
Bei einer einfachen Stromverzweigung mit zwei parallelen Wider standen er
geben sich die Teilstr6me jeweils aus dem Gesamtstrom, indem man diesen
durch die Summe der Widerstande teilt und jeweils mit dem gegenliberliegen
den Widerstand multipliziert.
- 2 -
c) mA,mW Grenzwert 25rnA Grenzwert 6V V
100'+---r- P2max = 37,5 -,...-----.,--....."",,:---+10
t i
2~------~--------~---J------~~~--~r-------~
1+--~-I-----If---L---+--~-+----t0,1
1 10 102 103 104 Q.
RL-
d) Leerlaufspannung U1
U1
KurzschluBstrom 25 rnA
Rl
U2 0 = Rl -R2 = 240 n
1nnenwiderstand *)
12k R1+R2
Spannungsersatzbild: Stromersatzbild:
Spannungsquelle Stromquelle
in Reihe mit Ri parallel mit Ri
e)
V
5 U20 - 12-Ri f) ~ R. 240 n .
6 V - 12 -240 n ~
2 3V-12,5rnA
37,5 mW
O;--'-.--'-r-~--------
o
5 10 15 20 25mA h-
(Leistungsanpassung)
Bei linearen Widerstanden Rl und R2 ist der 1nnenwiderstand des Teilers
konstant_ Die Ausgangsspannung U2 nimmt dann linear tiber dem Ausgangs
strom ab_
*) Den 1nnenwiderstand Ri findet man auch, indem man die Eingangsspannung U1
zu Null setzt (KurzschluB uber Eingangsklemmen) und dann den Widerstand
an den Ausgangsklemmen miBt_
- 3 -