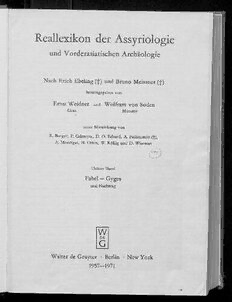Table Of ContentReallexikon der Assyriologie
und Vorderasiatischen Archäologie
Nach Erich Ebeling (f ) und Bruno Meissner (f)
herausgegeben von
Ernst Weidner und Wolfram von Soden
Graz Münster
unter Mitwirkung von
R. Borger, P, Calmeyer, D. O. Edzard, A. Falkenstein (f),
A- Moortgat, H. Otten, W. Röllig und D. Wiseman
Dritter Band
Fabel — Gyges
und Nachtrag
w
DE
G
Walter de Gruyter • Berlin • New York
1957-1971
ISBN 3 11 003705 X
©
1971 by Walter de Gruyter & Co., vormals G. J. Göschen’sche Verlagshandlung — J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung —
Georg Reimer — Karl J. Trübnet — Veit & Comp., Berlin 30
Alle Rechte des Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe, der Übersetzung, der Herstellung von Mikrofilmen und Photokopien
auch auszugsweise, Vorbehalten. Printed in Germany.
Satz und Druck: Walter de Gruyter & Co., Berlin 30
V orbem erkung.
Nach langer Unterbrechung nimmt das Reallexikon der Assyriologie nunmehr sein
Erscheinen wieder auf. Es steht zu hoffen, daß es mit Hilfe zahlreicher Mitarbeiter
gelingen wird, die Lieferungen in regelmäßigen Zeitabstänclen herauszubringen und
so das große Werk in absehbarer Zeit zu einem guten Ende zu führen.
Während der letzten Jahre hatte Erich Ebeling weitreichende Vorarbeiten für
die neuen Bände geleistet. Er hatte auch die Beiträge mit dem Anfangsbuchstaben
F und die Hälfte der Beiträge mit dem Anfangsbuchstaben G bereits zum Druck ge
geben. Der neue provisorische Herausgeber begann seine Tätigkeit, als der Umbruch
von F schon vorlag. Er und seine eifrige Mitarbeiterin, Frau Dr. Margarete Falkner,
konnten sich damit begnügen, in diesem Teil hier und da, wo es nötig war, verbessernd
einzugreifen, sie haben aber sonst an der vorliegenden Gestaltung der Beiträge nichts
geändert.
*
Bruno Meissner war es, der 1922 gemeinsam mit der Verlagsbuchhandlung
Walter de Gruyter & Co., Berlin, den Plan, ein Reallexikon der Assyriologie heraus
zugeben, zur Wirklichkeit werden ließ. Für die Teilnahme an der Herausgabe wurde
Erich Ebeling gewonnen. Das Leben und Wirken der beiden Gelehrten, deren Tat
kraft wir das Reallexikon der Assyriologie verdanken, möge hier noch einmal kurz an
unserem Auge vorüberziehen.
Bruno Meissner wurde am 25. April 1868 in der kleinen westpreußischen Stadt
Graudenz geboren. Nach dem Studium nahm er ein Jahr an den deutschen Aus
grabungen in Babylon teil, dann war er als Lehrer am Seminar für orientalische
Sprachen in Berlin tätig. Im Jahre 1904
wurde er an die Universität Breslau be
rufen, wo er siebzehn Jahre lang den Lehr
stuhl für Orientalische Sprachen inne
hatte. Im Jahre 1921 folgte er einem Rufe
an die Universität Berlin als Nachfolger
von Friedrich Delitzsch. Seit 1931 vertrat
er zugleich in der Preußischen Akademie
der Wissenschaften die Assyriologie. Auch
nach seiner Emeritierung führte er seine
wissenschaftlichen Arbeiten unermüdlich
weiter, bis ihm am 13. März 1947,
wenige Wochen vor der Vollendung des
79. Lebensjahres, der Tod die Feder aus
der Hand nahm.
Alle Teilgebiete der Assyriologie, also
die Philologie, die Geschichte, die Archäo
logie, die Religion, die Rechtskunde und
sämtliche Realien, hat Meissner mit voll
endeter Meisterschaft beherrscht. In der
Fülle seines Wissens hatte er kaum seines
gleichen. Es ist völlig unmöglich, hier
alle seine in Buchform erschienenen Pu
blikationen und seine zahlreichen Zeit-
schriften-Aufsätze aufzuführen. Seine be
deutendste wissenschaftliche Leistung
legte er 1920/25 in zwei Bänden unter
dem Titel Assyrien und Babylonien vor,
eine Kulturgeschichte des Zweistromlandes, die nur einMann schreiben konnte, der wirk
lich in allen Zweigen der Wissenschaft vom Alten Orient zu Hause war. Die letzten bei
den Jahrzehnte seines Lebens widmete Meissner der Ausarbeitung eines neuen Hssy-
rischen Handwörterbuches, das er etwa zur Hälfte fertigstellte und das nun von W. von
Soden ergänzt und zu Ende geführt wird.
In Breslau und Berlin hat Meissner zahlreiche Schüler für die Assyriologie begeistert
und zu tüchtigen Gelehrten ausgebildet. Zu seinem 60. Geburtstage wurde er durch
eine umfangreiche Festschrift, zu seinem 70. Geburtstage durch eine Plakette geehrt,
die wir hier im Bilde wiedergeben.
Erich Ebeling wurde am 21. No
vember 1886 in Berlin geboren. Das Stu
dium an der Universität seiner Heimat
stadt schloß er 1908 mit dem Doktor
examen ab, das er summa cum laude be
stand. Im Jahre 1920 habilitierte er sich
an der Universität Berlin, wurde dort ao.
Professor und später Ordinarius für Orien
talische Philologie und Religionswissen
schaft. Am 28. Oktober 1955 starb er im
Alter von 68 Jahren, schon lange krank,
aber noch mitten aus vollem Schaffen
heraus. Für seine großen Verdienste um
die Wissenschaft hat ihn die Bayerische
Akademie der Wissenschaften durch Er
nennung zum korrespondierenden Mit
glied geehrt.
Unter den Forschern auf dem Gebiet
der antiken Religion Mesopotamiens und
ihrer mannigfachen Ausdrucksformen
stand Ebeling an führender Stelle, er hat
aber daneben auch auf vielen anderen
Teilgebieten der Orientkunde grundle
gende Publikationen veröffentlich t. In den
neun Heften der Keilschrifttexte aus Assur religiösen Inhalts, in den Keilschrifttexten aus
Assur juristischen Inhalts, in den Literarischen Keilschrifttexten aus Assur und in vielen
kleineren Arbeiten legte er eine kaum übersehbare Fülle neuen Materials vor, er hat
damit, wie kaum einer seiner Zeitgenossen, für eine gewaltige Erweiterung des Blick
feldes der Assyriologie gesorgt.
Die religiösen Urkunden im weitesten Sinne des Wortes hat Ebeling in einer großen
Reihe von Publikationen ausgewertet; genannt seien hier vor allem die 330 Seiten
umfassende Übersetzung der babylonisch-assyrischen Texte, die er zu dem Sammel
werk Altorientalische Texte zum Alten Testament beisteuerte, ferner die Bücher 7 od
und Leben nach den VorStellungen der Babylonier, Tie babylonische Label und ihre Be
deutung für die Literaturgeschichte, Parfi'nnvezepte und kultische Texte aus Assur, Die
akkadische Gebetsserie ,,Handerhebung“. Daneben fesselten ihn besonders die Briefe
aus alt- und neubabylonischer Zeit, er hat ihnen vier umfangreiche Werke gewidmet.
Daß er auch auf historischem Gebiete ausgezeichnet Bescheid wußte, zeigte er in zwei
Bändchen der Sammlung Göschen, welche die Geschichte des Vorderen Orients von
der ältesten Zeit bi; zum Einbruch des Islams behandelten.
Bald nach der Gründung des Reallexikons der Assyriologie wurde Ebeling die
treibende Kraft des Ganzen, und er ist es bis zuletzt geblieben. Nie erlahmte seine
Energie trotz der großen Last, die von Anfang an auf seinen Schultern ruhte. Er stellte
die Stick Wörter zusammen, verhandelte mit den Mitarbeitern und arbeitete selbst
die Mehrzahl der Be iträge aus. So wird dieses große Werk, das als unentbehrliches
Rüstzeug für alle Orientalisten anerkannt ist, vor allem mit Ebelings Namen ver
knüpft bleiben. Ernst Weidner.
Abkürzungen.
(Das im Reallexikon der Assyriologie, Band I, S. V—XI gegebene Abkürzungsverzeichnis hat
weiterhin Gültigkeit. Hier sind die Abkürzungen verzeichnet, die neu hinzugekommen sind.)
AAA = Annals of Archaeology and Anthropology.
AASOR = Annual of the American Schools of Oriental Research.
AG - K. L. Tallqvist, Akkadische Götterepitheta.
AJ = The Antiquaries Journal.
AMT — R. C. Thompson, Assyrian Medical Texts, London 1923.
AnOr = Analecta Orientalin.
Antiqu. = Antiquity.
AR — J. Köhler und A. Ungnad, Assyrische Rechtsurkunden,. Leipzig 1913.
ARM = Archives Royales de Mari.
ArO(r) = Archiv Orient älni.
ASAW = Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften.
AT = Altes Testament.
BASOR = Bulletin of the American Schools of Oriental Research.
BIN — Babylonian Inscriptions in the Collection of James B. Nies.
BiOr = Bibliolheca Orientalis.
BM = British Museum.
BMS = L. W. King, Babylonian Magic and Sorcery, London 1896.
BRM — Babylonian Records in the Library of J. Pierpont Morgan.
CCT = Cuneiform Texts from Cappadocian Tablets in the Briii: h Museum.
CR = Comptes Rendus des Seances de PAcademie des Inscriptions et Belles-Lettres.
DAB — R. C. Thompson, Dictionary of Assyrian Botany, London 1949.
DAWW — Denkschriften der Akademie der Wissenschaften in Wien.
Fara = A. Deimel, Die Inschriften von Fara, Leipzig 1922 — 24.
FuF == Forschungen und Fortschritte.
HAB = F. Sommer und A. Falkenstein, Die hethitisch-akkadische Bilingue des Hattusili I.
(Labarna II.), München 1936.
Hinke = W. J. Hinke, A new Boundary Stone of Nebuchadrezzar I, Philadelphia 1907.
HSS = Harvard Semitic Serie.-,.
ILN = Illustrated London News.
JCS — Journal of Cuneiform Studies.
JKP' — Jahrbuch für kleinasiatische Forschung.
JNES = Journal of Near Eastern Studies.
JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society.
JRGS = Journal of the Royal Geographical Society.
JTVI = Journal of the Transact ions of the Victoria Institute.
KAO = Im Kampf um den Alten Orient, lirsg. von A. Jeremias und FI. Winckler.
LKA — E. Ebeling, Li.erarrche Keil chrifttexte aus Assur, Berlin 1953.
LKTU = A. Falkenstein, Literarische Keilschrifttexte aus Uruk, Berlin 1931.
LTB(A) — Die lexikalischen Tafelserien ... in den Berliner Museen, Berlin 1933.
M(D)P = Memoires de la Delegation en Perse.
Memoir — Old Testament and Semi.ic Studies in Memory of W. R. Harper, Chicago 1908.
ML _ Musee du Louvre.
MSL = B. Landsberger, Materialien zum sumerischen Lexikon, Rom 1937ff.
NBD = E. W. Moore, Neo-Babylonian Documents in the TJniversity of Michigan Collection,
Ann Arbor 1939.
NBRU = M. San Nicolö und A. Ungnad, Neubabylonische Rechts- und Verwaltungsurkunden,
Leipzig 1935-
NBRVT = O. Krückmann, Neubabylonische Rechts- und Verwaltungstexte, Leipzig 1933.
NBTJ = E. Ebeling, Neubabylonische Briefe aus Urulc, Berlin 1930—34.
Newell — H. H, von der Osten, Ancient Oriental Seals in the Collection of E. T. Newell, Chicago
1934-
Nik. = M. W. Nikolski, Dokumenti chozjajstvennoj otcestosti drevnej Chaldei, Moskau 1915.
NKREA = P. Koschaker, Neue keilschriltliche Rechtsurkunden aus der El-Amarna-Zeit, ASAW,
phil.-hist. KL, 39. Bd., - Nr. V.
OIC = Oriental Institute Communications.
OIP --= Oriental Institute Publications.
Or = Orientalia.
Parfümrezepte = E. Ebeling, Parfümrezepte und kultische Texte aus Assur, Rom 1950.
PBS = University of Pennsylvania. The Museum. Publications of the Babylonian Section.
REN = R. P. Doughcrty, Records from Erech, Time of Nabonidus, New Haven 1920.
RHR = Revue de l’Histoire des Religions.
RLA = Reallcxikon der Assyriologie.
SAK = F. Thureau-Dangin, Die sumerischen und akkadischen Königsinschriften, Leipzig 1907-
SCWA = W. H. Ward, The Seal Cylinders of Western Asia, Washington 1910.
SK(I.) = H. Zimmern, Sumerische Kultlieder, Leipzig 1912.
§L -- A. Deimel, Sumerisches Lexikon, Rom ig28ff.
SLT = E. Chiera, Sumerian Lexical Texts, Chicago 1929.
SRT = E. Chiera, Sumerian Religious Texts, Upland 1924.
SSB = F. X. Kngler, Sternkunde und Sterndienst in Babel, Münster i. W. igojff.
TCL — Musöe du Louvre. Textes cuneiformes.
TDP = R. Labat, Traite akkadien de diagnostics et prognostics mcdicaux, Paris 195
TMB = F. Thureau-Dangin, Textes mathematiques habyloniens, Leiden 1938.
TuL = E. Ebeling, Tod und Leben nach den Vorstellungen der Babylonier, Berlin 1931.
TJCP = University of California Publications in Semitic Philology.
UE = Ur Excavations.
UET = Ur Excavations. Texts.
UVB = Ausgrabungen in Uruk, Vorberichte.
VACh = Ch. Virolleaud, L'Astrologie chaldeenne, Paris 1903 —1912.
WO = Die Welt des Orients.
WUM = Welt und Mensch im Alten Orient.
Fabel. Die ältesten Beispiele der F. jetzt Kramer, Bibliccd Parallels from
finden sich unter den in Nippur ent Sumerian Lit. S. 25]). Wie bei den an
deckten sumerischen Texten aus altbaby deren Gedichten verteilen sich die übrigen
lonischer Zeit (etwa Epoche der Dyn. v. Stücke der Fuchsfabel auf mittel- und neu
Isin). Die Form dieser Dichtungen ist das assyrische Zeit. Zur ersten gehören KAR
sog. Streitgespräch (Tenzone). Die Themen VIII Nr. 323 und VAT 13836 (s. Ebeling
sind Sommer und Winter, Vieh und Korn, MAOG II 3 S. I7ff. und Ders. JCS IV
Schäfer und Bauer, Picke und Pflug, S. 215 ff.), zur zweiten KAR I Nr. 48,
Baum und Rohr, Vogel und Fisch [eine Frg. 3 + CT XV pl. 33; CT XV pl. 31 f.;
allerdings unvollständige F. mit diesen K. 8567 [CT XV pl. 38] par. KAR I Nr. 48,
Akteuren, nicht in Tenzonen-Form, Zim Frg. 3, 1. Kol.; Rassam 2 (s. Ebeling
mern SK II Nr. 204 = Witzei Or NS MAOG II 3 S. 20ff. und JCS IV S. 2igff.;
XVII 1, S. 1 ff.], Silber und Bronze. Die Meier a.a.0.).Der mesopotamische Fuchs
Texte beginnen mit einer mythologischen zeigt sich in diesem Gedicht als das Urbild
Einleitung. Jeder der genannten Partner unseres Reineke Fuchs. Mit dem Wolf hat
versucht dann die eigenen Vorzüge hervor er ein Bündnis, das gegen den Diener des
zuheben und die des anderen herabzu Schäfers, den Hund, gerichtet ist. Seiner
setzen. Der Streit wird durch eine Gott Verbrechen wegen wird er bei dem Richter
heit geschlichtet, s. Kramer BASOR Samas verklagt und weiß sich in beweg
Nr. 122, April 1951, S. 30L, dort weitere lichen Tönen zu verteidigen. Das Stück
Lit. Dieselbe Fabelart ist auch in mittel- VAT 13836 (s. oben) erzählt, wie der Fuchs
und neuassyrischer Zeit nachweisbar. Aus und der Wolf sich gegenseitig verpetzen,
erstgenannter Periode stammt die Fabel ein Motiv, das ja auch in unserer Geschichte
vom Streit der Dattelpalme mit der von Reineke Fuchs vorkommt.
Tamariske (in zwei Exemplaren vorliegend Die Fabel in Form der Tenzone hat sich
KAR III Nr. 145 und VIII 324, s. Ebe- von Babylon in die Nachbarländer ver
ling MAOG II 3 S. 6ff.). Dazu kommt breitet, nach Persien (mittelpersisches Ge
aus neuassyrischer Zeit das Streitgespräch dicht von der Dattelpalme und der Ziege),
zwischen Pferd und Ochse (s. CT XV Israel (Dornstrauch und die anderen
pl. 34; 35; 37; 36 und dazu Ebeling Bäume, s. Rieht. 9, 8 ff. und II Könige
a.a. O. S. 27ff.) und zwischen agalu und 14, 9), zu den Aramäern (Dornstrauch
einem unbekannten Tiere (CT XV pl. 37, und Granatapfelbaum im Achiqar-Roman,
s. Ebeling a. a. O. S-37ff.). Besondere Be Ebeling a. a. O. S. 14f.), Armenien (Streit
handlung verdient dieTenzone vom Fuchs, der Bäume um die Herrschaft, s. Ebe
seinen Kumpanen und dem Hunde. Sie ling a. a. O. S. 16), Ägypten (Sykomore
ist gewiß auch sumerischen Ursprungs, und unbekannter Baum, s. Erman Litera
jedoch sind von dem sumerischen Werke tur Ägyptens S. 311, dazu Ebeling a.a. O.
nur Andeutungen und ein größeres Bruch S. 16) und ist schließlich auch von dem
stück aus einem zweisprachigen späteren griechischen Dichter Kallimachos in seiner
Texte erhalten (s. Weidner OLZ XVII Dichtung vom Lorbeer und Oelbaum auf
Sp. 305ff.; Meier AfO XI S. 363, Tf. 2, genommen worden (s. Diels Internat.
dazu Ebeling JCS IV S. 22off. [vgl. aber Wochenschrift für Kunst und Wissenschaft
IV Sp. 993ff-) ■ In einer Sammlung von Fackel als Symbol. Der Gott Gibil, t
Witzen und Bonmots aus dem J. 716 v.Chr. dessen Name inMetathesis vielfachBIL-GI S
(KAR IV Nr. 174 und Weidner AfO geschrieben wurde, da es sich um einen
XVI S. 80) sind Fabeln in kürzester Form bannenden, magisch wirkenden Gott han- (.
(2—3 Zeilen) wiedergegeben. Unter ihnen delt, heißt „flammendes" (BIL = Feuer) S
verdient diejenige von der Mücke und dem „Rohr" (Gl), also genau „Fackel". Sein Er- s
Elefanten eine Hervorhebung, weil sie bei kennungszeichen war also anfangs die F. d
Babrios (Nr. 84 Schneidewin) in grie selbst. Später, als die Lampe an Stelle (:
chischer Sprache wieder vorkommt (s. der F. getreten war, hat man dem Feuer- I
Ebeling MAOG II 3 S. 49h). Gegen die träger Gibil die Lampe als Erkennungs- e
Bezeichnung „Tenzone“ für Fabel s. Zeichen übertragen. Er ist in dem Kudurru h
Landsberger JNES VIII, S. 295!. des Nazi-Maruttas (Kol. IV, Z. 18—19) u
Weber Die Literatur der Babylonier und ausdrücklich als sipru = Instrument des s'
Assyrer, S. 303!!; Johnston Beast Fables, Gottes Nusku bezeichnet worden, also als d
AJSL 1912 S.3iff.; Ebeling ,Die babylonische Lampenträger des Feuers (des Nusku), ti
Fabel und ihre Bedeutung für die Literaturge
s. Flamme. Die Übersetzung „Bote“ e:
schichte, MAOG IX 3; Ders. JCS IV, S. 2i5ff.;
Greßmann Israels Spruchweisheit-, Meissner wäre auch möglich und hätte denselben w
BuA II, S. 427 ff.; Di eis s. oben; Meissner Die Sinn. v
babylonisch-assyrische Literatur, S. 82f. (auf
BIL-GI = GI-BIL: Deimel Pantheon, Nr. Si
Grund von Ebeling, s. oben); Jeremias
598; F. Jean Religion sum. 1931, S. 128I; d
Handbuch der Altorientalischen Geisteskultur2,
Howardy Clavis Nr. 90, 276: GI-BIL =■ w
S. 441 ff. (zum kosmisch-mythologischen Hin
qanü suruptu = „flammendes Rohr“, a.a.O. „
tersinn einer Art von Fabeln); Nougayrol Nr. 277: GI-BIL-LÄ = gizillu = „Fackel“, £
MHanges Syriens . . . Dussaud, S. 73 ff. 279; GI-BIL-LÄ = tiparu = „Fackel“; E. d
Für bildliche Darstellung von Fabelstoffen
Unger Keilschrift-Symbolik, 1940, Nr. 48 = g
vgl. Jeremias a.a.O., S. 440; M. v. Oppen
Gl = „Rohr“; Nr. 157 = BIL = „Feuer“. V)
heim Der Teil Halaf, S. i59ff. (Tierkapellen);
Ungnad AfO, Beih. 1, S. 134(1 Kudurru des Nazi-Maruttas LSS, II, 2, „
S. 15 (Frank); Scheil MP II, S. 90, Anm. 8; “
Ebeling. Delitzsch HW, S. 683. S
Tallqvist AG, S. 313, Girru = Gibil, Bilgi a
Fabeltiere s. Dämonenbilder und
a.a.O., S. 229. Eckhard Unger. (1
Mischwesen.
Fahne s. Standarte.
Fackel, sum. g i z i 11 a, akk. qanü suruptu, n
tiparu. Die F. wurde aus Rohrbündeln Fähre, Fährmann, Furt. Die große s;
(s. sum. Namen), die'vielleicht in leicht- Menge der Flußläufe in der babylonischen -?
brennende Substanzen (Asphalt u. dgl., s. Landschaft bedingte ein häufiges Hin- und F
Erdpech) getaucht wurden, hergerichtet. Herübergehen über mehr oder weniger S
Sie diente neben der Lampe (s. d.) der tiefes Wasser. Man konnte dies schwim
Beleuchtung der Wohnung, bei der Feuer mend oder mit Benutzung von auf- is
post (s. d.) zur Zeichengebung. Im Kultus geblasenen Hammelschläuchen tun. Prak- T
sorgte sie kathartisch für Sühnung der tischer war natürlich dafür das Boot. Die n
beteiligten Personen neben Räucherbecken Briefe aus Mari zeigen uns mehrfach, daß d
(passim in Beschwörungsritualen) und ver die Bereitstellung von Booten für die Fluß-
scheuchte oder vernichtete die Dämonen passierung eine Verkehrsnotwendigkeit sc
und Hexen in effigie (s. z. B. Maqlü I war und daß bei Fehlen solcher Fahrzeuge (\
Z. 135ff. oder IV R 49, Z. 47). Beachte peinliche Schwierigkeiten entstanden (vgl.
die interessante Fackelprozession in Uruk ARM XV S. 291, dort Stellen unter ba- Si
(s. Thureau-D angin in Rituels accadiens teau). V
S. n8ff.), die wohl auch kathartischen Nicht jede Stelle am Flusse war, etwa iil
Zweck hatte. Für die Fackel als Omen durch Strudel, hohes Ufer u. dgl., für den z.
träger vgl. Ungnad AO X 3 S. 18, 31, Übergang günstig. Man erwählte daher N
als Symbol des Feuergottes (bildlich dar dafür solche, die durch die Praxis sich als sc
gestellt) vgl. folgendes Stichwort. besonders geeignet erwiesen hatten (akk. s.
nibiru). Beispielsweise seien genannt: die
Ebeling.
>il, Übergangsstelle von Mankisu (s. OIP 43 Fahrlässigkeit. Die Unterscheidung
Gl S. 130, Anm. 58; Jean RA XXXV S. ixo; zwischen einer vorsätzlichen und fahr
en ARM II Nr. 25, Z. 9) oder Tirqa/Sirqn lässigen Handlung ist bereits in der älteren
m- (ARM III Nr. 57, Z. 14). An solchen Zeit ersichtlich; ausdrücklich und direkt
er) Stellen sammelten sich gelegentlich Wohn- wird sie erst im Codex Hammurapi
ir- siedelungen an, denen nach dem Charakter (=CH)—und zwar im Verkehrsrecht eben
F. des Ortes auch der Name gegeben wurde so wie im Strafrecht — durchgeführt. Aus
Ile (z. B. Nibiru Sa Assur, s. d., Nebirtu, s. d.). den Gesetzesfragmenten von Esnunna
er- Daß man an besonders wichtigen Orten (=CB) sind nur solche Fälle zu verzeichnen,
gs- einen ständigen Fährverkehr eingerichtet in denen dieF. aus dem schädlichen Erfolge
■ru hat, kann nicht mit Sicherheit gesagt deduziert werden kann. So z. B. haftet für
[9) werden. Dafür spricht die Uberfahrt die durch Tiere zugefügten Schäden ihr
les Steuer (mikis nebiri) und weiter der Name Eigentümer, wenn er über die gefährliche
als des Fährmanns der Unterwelt Humut- Eigenschaft der Tiere amtlich benach
u), tabal „Hole eiligst weg“, womit wohl nur richtigt wurde und trotzdem — offenbar
e“ ein stets dienstbereiter Schiffer benannt aus eigener F.— keine Vorsichtsmaßnahme
en werden kann, der auf den Ruf „Hol über“ getroffen hat (§§ 54—57 CB); ähnliche
von dem jenseitigen Ufer veranlaßt wird, Haftung trifft auch den in gleicher Weise
Sfr. seine Fähre in Bewegung zu setzen. Auch nachlässigen Eigentümer einer schadhaften
T; die Bezeichnungen für ein Fährschiff Mauer (§58 CB); nach §36 CB haftet
~ muttabritu, muStabritu mit der sumerischen auch der Verwahrer für die übernommenen
;1u Entsprechung PES.PES, die bedeutet, Sachen mit Ausnahme der unabwendbaren
E. daß man solche Schiffe besonders breit Eingriffe eines Dritten bzw. im Falle der
= gebaut hat (vgl. Salonen Wasserfahrzeuge Vernichtung der verwahrten Sache infolge
ry in Babylonien S. 23) und die Uferboote, des Hauseinsturzes des Verwahrers, wobei
g.’ Schaef fer Cuneiform Texts of RasShamra auch seine Sachen zugrunde gegangen sind
S. 39, lassen schließen, daß solche Schiffe (§ 37 CB). Nach den in Nippur gefundenen
ilgi am Fährplatz zur Benutzung liegen blieben Gesetzesfragmenten des Königs Lipit-Istar
(vgl. dazu Maqlu VII Z. 8f., wo es heißt: von Isin (= CL) haftet der Eigentümer
„es ruht das Fährschiff, ruht der Hafen, eines Grundstückes für den Einstieg in das
ruhen die Schiffsleute [= Fährleute] alle- Nachbarhaus, den er durch vernach
ße samt“). Für weite Fahrten flußauf und lässigte Sicherheitsmaßnahmen herbei
en -ab waren solche Schiffe kaum geeignet, geführt hat (Art. 11 CL); ebenso kann die
nd Für andere Namen des Fährschiffes vgl. Haftung des Mieters eines Rindes auch
;er Salonen a. a. O. für fahrlässige Verletzung des Rindes
m- Ein literarisch berühmter Fährmann geltend gemacht werden (Art. 34ff. CL).
xf- ist Ur-sanabi, der im Gilgames-Epos den Auch im Fragment der sog. sumerischen
ik- Titelhelden nach der Insel des Uta- Gesetze aus Üruk kann in der gemäß §1
)ie napistim hinüberbringt über die Wasser angeordneten Strafe für die Verletzung
aß des Todes. einer schwangeren Frau, durch welche ihr
iß- Im Zauber spielt das Abbild eines Fähr eine Fehlgeburt verursacht wurde, eine
eit Schiffes, in dem die Hexe sitzt, eine Rolle Sanktion eventuell für die fahrlässige
ige (vgl. Maqlu VIII Z. 35ff.). Handlung erblickt werden, während die
gl. Gewiß gab es auch manche seichten nächste Bestimmung denselben Straferfolg
a- Stellen, wo man, wenigstens bei niedrigem mit doppelter Buße bestraft, falls der
Wasserstande, den Fluß trocknen Fußes Schaden nachweisbar vorsätzlich zugefügt
wa überschreiten konnte, sog. Furten (s. wurde. Ferner wird hier (vgl. §§ 26, 27)
en z.B. NÖtscher Or 51—54 S. 139 Z. 136f.). noch die Haftung des Eigentümers eines
1er Notizen über solche Orte sind jedoch, an- Viehhofes bestimmt: dieselbe betrifft die
als scheinend, nicht erhalten. Für Brücken jenigen Verluste, bei denen der Hirte seine
:k. s. d. Für Nibiru — Marduk s. d. Unschuld nicht nachweisen kann; das Ein
Ebeling. dringen eines Löwen wird als ein den Eigen-
tümer betreffender Schaden angeführt, wo Die Schadenersatzhaftung auf Grund
gegen der Verlust des Viehes die Schaden der F. nähert sich in gewissen Fällen der
ersatzpflicht des Hirten zur Folge hat. Haftung für den Erfolg. So haftet z. B.
Im CH wird bereits ausdrücklich zwi der Arzt, der Tierarzt, der Baumeister
schen der vorsätzlichen und der fahr und der Schiffer (§§ 218—220; 225;
lässigen Strafhandlung unterschieden, wo 229—233; 235); das Gesetz macht alle
bei die Differenz zwischen dem Gebiet des diese Personen für den Sachschaden, die
Strafrechtes und des Verkehrsrechtes im körperlichen Verletzungen oder Lebens
heutigen Sinne nicht durchgeführt wird. verluste haftbar, ohne ausdrücklich anzu
Für den CH ist wohl charakteristisch, daß führen, ob der Schaden z. B. durch Mangel
der Gesetzgeber sich selbst als einen Herr an Kenntnis oder F. verursacht wurde.
scher bezeichnet, bei welchem die Schuld in Es scheint jedoch, daß der Gesetzgeber
der Ausübung seiner Gewalt von vorn auch in diesen Fällen eine verschuldete,
herein ausgeschlossen ist (a-na salmat widerrechtliche Handlung zur Bedingung ^
qaqqadim . . . ü-ul e-gu „den Schwarz für eine Schadenersatzhaftung machen
köpfigen . . . gegenüber war ich nicht wollte. ®
nachlässig“). In einigen Bestimmungen Nicht ohne Interesse sind mehrere ^
des CH wird ausdrücklich unter Sanktion Formen von dem Worte egü in den alt- ^
gestellt, wenn sich jemand bei der Aus babylonischen- Briefen zu verfolgen, wie ^
übung der Vertrags Verpflichtungen nach z. B. ana Intim lä tegi „gegen das Haus sei ^
lässig (egü) benimmt: so trägt die Folgen nicht nachlässig“; pihatka. . . . lä tegi „in ^
der eigenen F. der Handelsgehilfe (samal- deiner Pflicht sollst du nicht lässig sein". .
lüm), wenn er versäumt hat, eine Quittung Die Warnung vor einer F. kommt sehr oft ^
über das seinem Auftraggeber ausbezahlte in den altbabylonischen sowie auch neu- ^
Geld von diesem zu verlangen (§ 105 CH); babylonischen Briefen auch unter anderen
für die F. ist auch der Verwahrer ver Wendungen vor, wie z. B. ana eqlim ... j
antwortlich, welcher aus diesem Grund nidi ahirn lä taraSSi „dem Felde . . . sollst
^ . . 9fl
die ihm zur Aufbewahrung gegebenen du nicht Nachlässigkeit zeigen"; nadi ahi ^
Sachen abhanden kommen ließ (§ 125 CH); lä tarassü (neubabyl.) „Nachlässig dürft ^
ferner haftet der Schiffer, welcher ein ihr nicht werden“ oder litka . . . ana ^
Schiff gemietet hat, für die fahrlässige muhhi lä tanamdi „du sollst dich darin jj
Versenkung oder Vernichtung des Schiffes nicht nachlässig zeigen“ u. a. g
(§ 236 CH); schließlich haftet als nach In den hethitischen Gesetzen war die p
lässig der Hirte, welcher die Entstehung Unterscheidung zwischen der vorsätz
einer Viehkrankheit in der Hürde ver lichen und fahrlässigen Handlung be- »■
schuldet hat (§ 267 CH). Außerdem spricht kannt. Die letztere wird durch die Wen- ß
der CH ausdrücklich noch über den durch düng „wenn (nur) seine (= des Täters) jj,
F. (megütum) verursachten Schaden, und Hand frevelt" ausgedrückt (vgl. Art. 3 ff. s.
zwar im Falle des § 245 CH, nach welchem des sog. hethit. Kodex); eine ähnliche ja
derjenige haftbar wird, der ein Rind ge Unterscheidung finden wir in den mosai- ar
mietet und dann durch Nachlässigkeit sehen Gesetzen (z. B. Ex 21, 13). be
oder Schlagen (d. h. absichtlich) dessen
G. R. Driver-J. C. Miles The Babyloniern sal
Tod verursacht hat. Ein andermal wird
Laws 1952. I. M. Djakonov Zakony Vavi- de
die F. durch die Redewendung „die Hände lonii, Assirii i chettskovo carstva. Vüstnik jsj.
in den Schoß legen“ bzw. „sich auf seine drevnej istorii 1952. D. Daube Negligenee in p
Seite werfen“ (aham nadü) ausgedrückt, the Early Talmudic Law of Contract (Peshitah), c
Festschrift F. Schulz 1951. A. Falkenstein- (di
wie es in den §§ 53 und 55 CH vorkommt;
M. San Nicolb Das Gesetzbuch Lipit-Istars die
hier werden die Sicherheitsmaßnahmen vonlsin, OrientaliaXIX, 1950. M.SanNicolö pa
bei der Befestigung eines Felddeiches Rechtsgeschichtliches zum Gesetzbuch des Bila- w
sowie bei der Öffnung eines Bewässerungs lama von Esnunna, Orientalia XVIII, 1949.
E. Ebeling Altbabylonische Briefe der Louvre- Al
grabens bestimmt, um die Nachbargrund-
Sammlung aus Larsa, MAOG XV, 1942. Max Süi
stücke vor evtl. Schaden zu schützen. Mühl Untersuchungen zur altorientalischen yg