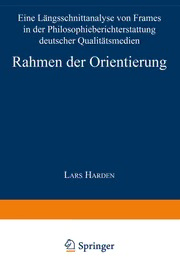Table Of ContentLars Harden
Rahmen der Orientierung
SO ZIALWI SS EN SCHAFT
Lars Harden
Rahmen der Orientierung
Eine Längsschnittanalyse von Frames
in der Philosophieberichterstattung
deutscher Qualitätsmedien
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Beate Schneider
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhältlich
Dissertation Hochschule für Musik und Theater Hannover, 2002
ISBN 978-3-8244-4499-1 ISBN 978-3-663-08903-2 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-08903-2
1. Auflage September 2002
Alle Rechte vorbehalten
© Springer Fachmedien Wiesbaden, 2002
Ursprünglich erschienen bei Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden 2002.
Lektorat: Ute Wrasmann / Anita Wilke
www.duv.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verla.9s unzulässig und strafbar. Das gilt insbe
sondere für Vervielfältigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung: Regine Zimmer, Dipl.-Designerin, FrankfurVMain
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Geleitwort
Wenn Medien Wissenschaft thematisieren, dann geht es meist um Medizin oder Natur
wissenschaften, um spektakuläre Forschungen und Erfindungen, die unser Leben erleichtern
oder verlängern. Geistes- und Sozialwissenschaften sind Stiefkinder der aktuellen Berichter
stattung. Die Beschäftigung mit Philosophie scheint gar mit dem Typus der gelehrten Zeit
schriften und moralischen Wochenschriften publizistisch marginalisiert worden zu sein.
Andererseits lässt sich die Philosophie als Orientierungsdisziplin deuten, der gerade in Zeiten
gesellschaftlichen Umbruchs und krisenhafter Ereignisse zumindest von den Medien Beach
tung geschenkt werden könnte, die den Diskurs um die großen politischen und weltanschauli
chen Fragen mitbestimmen. Die vorliegende empirische Analyse dokumentiert deswegen
nicht nur die Philosophieberichterstattung in den politischen Zeitschriften SPIEGEL und
ZEIT seit Beginn ihres Erscheinens, sondern auch deren Bezugnahme auf gesamtgesell
schaftliche Zusammenhänge. Von medienwissenschaftlichem Interesse ist dabei vor allem,
inwieweit solche übergreifenden Bezüge Orientierungsangebote durch die philosophische
Betrachtungsweise erkennen lassen, bzw. ob sich die Philosophieberichterstattung als genui
nes Orientierungsangebot der Medien interpretieren lässt.
Die Untersuchung folgt dem kommunikationswissenschaftlichen Konzept des Framings und
hat sowohl in der theoretischen Aufarbeitung als auch durch die stringente Operationalisie
rung den Ansatz wesentlich voran gebracht. Als großer Gewinn erweist sich, dass die um
strittene Dichotomie zwischen qualitativ-deutungsanalytischem und quantitativ-standardisier
tem Vorgehen aufgehoben und beide Ansätze integriert wurden. Anlage und Ergebnisse der
Studie erhellen zudem bisher strittige Grundannahmen der Selektionsforschung im Hinblick
auf die Dauerhaftigkeit von Selektionskriterien und die Ereignisorientierung. Die überaus
ambitionierte Aufgabe, Medienberichterstattung über einen so langen Zeitraum zu analysie
ren, Themenkarrieren zu verfolgen und die soziale Dimension einzubeziehen, hat sich für das
Projekt als lohnend und für die Wissenschaft als gewinnbringend erwiesen.
Professor Dr. Beate Schneider
Vorwort
Wenn ich wissenschaftliche Bücher zu lesen beginne, zumal Dissertationen, sind die Vor
worte immer eine spannende Angelegenheit. Gibt es vielleicht in diesem Fall einen zarten
Hinweis auf die kleinen und mittleren Katastrophen, die der Verfasser während seiner Arbeit
erlebt hat? Erfahre ich vielleicht dieses Mal, ganz ehrlich, dass das Werk erst nach einem
Zerwürfnis mit allen Betreuern, Beteiligten, Partnern und Verwandten und unter größten Mü
hen zu Stande gekommen ist? Gelingt es mir, etwas von der Person zu erfahren, die sich hin
ter den vielen Worten verbirgt? So von Autor zu Leser?
Bisher bin ich immer enttäuscht worden. Die Verfasser bedanken sich artig bei den wissen
schaftlichen und leiblichen Eltern, bei Instituten, Kollegen, Freunden und geliebten Men
schen. Meist in dieser Abfolge. Auch mein Dank gilt all jenen, die mir auf die eine oder ande
re Art ermöglicht haben, diese Arbeit zu schreiben. Reihenfolge und Intensität meiner Dank
barkeit sind den Betroffenen bekannt. Alle zusammen haben mir die Gelegenheit gegeben,
mein wissenschaftliches Interesse zu entwickeln und auszuleben.
Mir bleibt die Hoffnung auf viele Leser über den genannten Kreis von Personen hinaus.
Lars Harden
Zusammenfassung
Massenmedien gelten als wichtige Akteure im gesellschaftlichen und öffentlichen Diskurs.
Sie stellen Themen zur Verfügung, liefern Deutungen und Bewertungen und übernehmen in
sozialen Austauschprozessen wichtige Orientierungsfunktionen. Die vorliegende Dissertation
untersucht unter diesem Aspekt die Philosophieberichterstattung in zwei deutschen Quali
tätsmedien. Es geht dabei darum, ob sich Bezugsrahmen identifizieren lassen und ob diese in
Beziehung zu gesellschaftlichen Entwicklungen stehen.
Ausgehend von einer Betrachtung der Leistungsfähigkeit der Philosophie als Orien
tierungsdisziplin und ihrem historischen Verhältnis zu den Massenmedien wird folgende theo
retische Perspektive entwickelt: Bei der Bereitstellung von Themen durch die Medien spielen
die Persönlichkeit des Journalisten, Nachrichtenwerte und bestimmte organisatorische Vorga
ben eine Rolle. Inhalte gelangen also nicht willkürlich in die Medien, sondern nach bestimm
ten Gesetzmäßigkeiten. Weiterhin haben gesellschaftliche Bedingungen einen Einfluss auf
Medieninhalte. Die bisherige Selektionsforschung geht überwiegend davon aus, dass Inhalte
anhand relativ konstanter Kriterien ausgewählt werden. Andererseits kann nachgewiesen wer
den, dass Medien ihre Auswahlkriterien in Krisensituationen verändern. Somit muss eine Be
trachtungsweise entwickelt werden, die sowohl die Konstanz wie auch die Veränderlichkeit
von Auswahlkriterien integriert. Dazu dient der Framing-Ansatz. Rahmen werden hier als
Thematisierungsmuster auf der Ebene von Medieninhalten untersucht. Frames dienen als grö
ßere Sinnkomplexe für die Herstellung und Strukturierung von Bedeutung.
Mittels einer qualitativen Vorstudie konnten Frames aufgezeigt werden, die in einer standardi
sierten Inhaltsanalyse aller Artikel zum Thema Philosophie aus den Jahren 1946 bis 2000 aus
den Wochen ti tein SPIEGEL und ZEIT weitestgehend bestätigt wurden. Die Philosophiebe
richterstattung zeichnet sich durch Debatten zu folgenden Problemfeldern aus: Deutscher Fa
schismus, Selbstverständnisdebatte der Philosophie, Diskussion um die Struktur der Gesell
schaft um 1968, Umwelt & Atomkraft sowie Gentechnik. Diese Diskurse verlaufen zum Teil
relativ konstant über den Untersuchungszeitraum und zum Teil in zeitlich mehr oder weniger
stark eingegrenzten Phasen. Neben diesen Rahmen widmet sich ein Großteil der Philosophie
Artikel einer Routineberichterstattung, die in erster Linie aus Buchbesprechungen, Nachrich
ten u.ä. besteht.
Versteht man die Rahmen als inhaltlich aufgeladene Thematisierungsmuster und die Routine
berichterstattung als Ruhephasen, zeigt sich die Nützlichkeit des Framing-Ansatzes. Das
Schreiben über Philosophie verändert sich immer dann, wenn gesellschaftlich-werthaltige
Diskussionen von der Philosophieberichterstattung aufgegriffen werden. Solche Beiträge der
Philosophie-Artikel zum Gesellschaftsdiskurs gelingen verstärkt, wenn der Anschluss über
besonders prominente Akteure des Faches möglich ist. Somit liefert die Studie zwei wesentli
che Erkenntnisse: Sie exploriert, beschreibt und erklärt die Berichterstattungsmuster der Phi
losophieberichterstattung, und sie belegt die Nützlichkeit des Framing-Ansatzes bei der Be
schreibung und Erklärung sich wandelnder Selektionsentscheidungen in einer Längsschnitt
untersuchung.
Summary
The mass media clearly plays an important role in both private and public dialogue. It deli vers
not only themes for discussion but also interpretations and evaluations thereof, providing ori
entation within the process of social interaction. This dissertation investigates coverage on
philosophy through the analysis of two respected German media. The aim is to identify a ref
erential framework and to see if this corresponds to societal developments.
The following theoretical perspecti ve is based on an assessment of the efficiency of the field
of philosophy to provide orientation together with its historical relationship to the mass me
dia: the character of the journalist, the news value as weil as organizational requirements play
a role when a theme is distributed through the media. Contents do not appear randomly but in
accordance with specific requirements. Also do social conditions have an influence on media
contents. Until now most research assurnes that the selection process is based on relatively
constant criteria. At the same time it can also be proven that the media changes its criteria for
selection in times of crisis. It is therefore necessary to develop a method of approach that in
corporates both the constant as weil as the inconstant. The framing approach serves this pur
pose. Central theme patterns are clustered to enable media contents research. Frames serve the
purpose of producing and building a mutual structure of reference.
The frames revealed within a qualitative pre-study were confirmed, as far as possible, through
a standardized contents analysis of all articles to the theme philosophy in the weekly issues of
SPIEGEL and ZEIT between the years 1946 and 2000. Coverage on philosophy is most iden
tifiable within the following areas: German fascism, debates on the self-image of philosophy,
discussions on the structure of society around the time of 1968, environment, nuclear power
and genetic engineering. Within the period researched, the dialogues on fascism and self im
age were relatively constant throughout with all other areas going through phases of more or
less emphasis. Apart from these structures, the greater part of articles on philosophy devote
themselves to routine coverage of things such as book discussions, news, anniversaries, con
gress reports etc.
How expedient the framing approach is becomes apparent when the frames are seen as con
sisting of central theme patterns thriving with content and the coverage itself as merely rou
tine. Changes within this routine coverage occur whenever discussions of societal values take
place in which an angle for philosophical coverage exists, or, the rare exception, when phi
losophy originates the discussion. Philosophical articles that contribute to societal discussions
have a far greater chance of success when in conjunction with prominent figures from the
field. Also, the more such figures are actively engaged in the problem area involved, the
more relevance they gain for the media.
The dissertation supplies two essential findings: It explores, describes and illustrates in a
long-term study the pattern of philosophy coverage as weil as documenting the expediency of
the framing approach when it comes to describing and illustrating the shifting selection proc
ess.
Inhaltsverzeichnis
Strukturen schaffen .............................................................................................................. 1
2 Gegenstand und Perspekti ve ................................................................................................ 5
2.1 Blick auf die Philosophie .............................................................................................. 5
2.2 Historische Aspekte ....................................................................................................... 9
2.3 Politische Zeitschriften und Philosophie ..................................................................... 13
2.4 Medien als gesellschaftliche Akteure .......................................................................... 15
3 Mediale Selektion und Verarbeitung von Themen ............................................................ 21
3.1 Faktoren der Nachrichtenselektion .............................................................................. 21
3.1.1 Der Faktor Mensch ............................................................................................... 22
3.1.2 Der Charakter von Ereignissen ............................................................................. 24
3.1.3 Die Organisation der Redaktion ........................................................................... 30
3.2 Analyse komplexer Medieninhalte .............................................................................. 31
3.2.1 Mediale Wirklichkeitskonstruktionen .................................................................. 33
3.2.2 Krisen als Zeiten der Umdeutung ......................................................................... 36
3.2.3 Öffentlichkeitskonstrukte ..................................................................................... 42
3.3 Theoretische Neuorientierung ..................................................................................... 46
3.3.1 Mängel der Selektionsforschung .......................................................................... 46
3.3.2 Komplexität analysierbar machen ........................................................................ 49
4 Framing .............................................................................................................................. 51
4.1 Einordnung des Konzepts ............................................................................................ 53
4.1.1 "Fundorte" für Frames .......................................................................................... 55
4.1.2 Frames in Texten .................................................................................................. 58
4.2 Theoretische Basis des Konzepts ................................................................................ 60
4.2.1 Der Kommunikator und der Frame ...................................................................... 64
4.2.2 Übertragung auf Medien ....................................................................................... 66
4.3 Empirische Umsetzungen für Medien-Frames ............................................................ 73
4.3.1 Textnahe Zugänge ................................................................................................ 74
4.3.2 Deutungsanalytisch-quantitative Zugänge ........................................................... 78
4.4 Definition von Medien-Frames ................................................................................... 80
4.4.1 Rahmen vs. Thema ............................................................................................... 82
4.4.2 Die Bestandteile des Rahmens ............................................................................. 86
4.5 Framing und Philosophieberichterstattung .................................................................. 89
4.5.2 Sach-und Sozialdimension .................................................................................. 91
4.5.3 Zeitdimension ....................................................................................................... 93
5 Untersuchungsanlage ......................................................................................................... 97
5.1 Auswahl Medien und Artikel ...................................................................................... 97
5.2 Ablauf und Analyseschritte ....................................................................................... 100