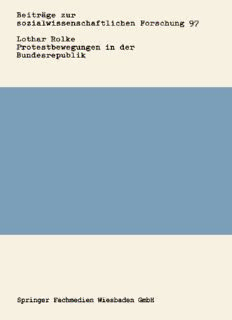Table Of ContentLot
Pro
Beiträge zur sozialwissenschaftliehen Forschung
Band 97
Meiner Frau Petra gewidmet
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Lothar Holke
Protestbewegungen in
der Bundesrepublik
Eine analytische Sozialgeschichte
des politischen Widerspruchs
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Rolke, Lothar:
Protestbewegungen in der Bundesrepublik: e. analyt.
Sozialgeschichte d. polit. Widerspruchs/ Lotbar Rolke. -
Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987
(Beiträge zur sozialwissenschaftliehen Forschung;
Bd. 97)
ISBN 978-3-531-11854-3 ISBN 978-3-663-14332-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-14332-1
NE:GT
Alle Rechte vorbehalten
© Springer Fachmedien Wiesbaden 1987
Ursprünglich erschienen bei Westdeutscher Verlag GmbH Opladen 1987
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb er engen Grenzen des Urheberrechts
gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrover
filmungen und die Einspeichelunglllld Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
ISSN 0175-615 X
V o r w o r t
Der politische Widerspruch außerhalb von Parteien und Parlamenten hat
in der Bundesrepublik bereits eine Geschichte. Seit mehr als 35 Jahren
artikuliert er sich in Form von Protestbewegungen. In den 50er Jahren
hatten sich nacheinander die Bewegungen gegen die Wieder- und die Atom
bewaffung formiert. Ostermarschbewegung, Notstandsopposition und Stu
dentenbewegung repräsentierten in den 60er Jahren den außerparlamenta
rischen Protest. In den 70er und 80er Jahren entstand dann das Geflecht
der neuen sozialen Bewegungen: die Bürgerinitiativ-, Ökologie- und
Friedensbewegung, die Alternativ-, Frauen- und Selbsthilfebewegung.
1983 gelang diesen Gruppierungen sogar die Teilparlamentarisierung auf
Bundesebene in Form einer eigenen Partei - ein für hiesige Verhält
nisse einmaliger Vorgang. Ohne Zweifel also, Protestbewegungen sind in
der Bundesrepublik zu einem politischen Faktor geworden.
Diese Entwicklung war 1980/81, als der Verfasser das hier vorliegende
Untersuchungsprojekt plante, noch nicht abzusehen. Im Gegenteil, noch
immer galten den bis dahin im Bundestag vertretenen Parteien solche
Widerspruchspotentiale als Quantite negligeable, die so plötzlich zu
kommen schienen, wie sie gefälligst zu verschwinden hatten. Aber die
Beständigkeit dieses Phänomens hatte die Aufmerksamkeit des Verfassers
erregt. Jenseits der ideologistischen und tagespolitischen Ober- und
Untertöne interessierte ihn die Frage, welche tatsächliche Bedeutung
Protestbewegungen in entwickelten Gesellschaften wie der Bundesrepu
blik haben. Bewegungstypische Rege1mäßigkeiten sollten identifiziert
werden, um Auskunft darüber zu erhalten, wann Protestbewegungen ent
stehen, wie sie verlaufen und was sie bewirken.
1981 konnte das Forschungsunternehmen beginnen. Der erkenntnissuchende
Blick in die kaum noch zu übersehende Fachliteratur hatte jedoch ge
zeigt, daß die angebotenen Erklärungen noch immer so vielfältig waren
wie die Anzahl der Forschergruppen und die Facetten des Phänomens. Was
fehlte war eine systematische Gesamtübersicht, die in der Lage war,
verallgemeinerungsfähige Erkenntnisse hervorzubringen. Tatsächlich kann
die hier vorgelegte Rekonstruktion der 35jährigen bundesrepublikanischen
Sozialgeschichte des politischen Widerspruchs ausweisen, daß es sich
bei den Protestbewegungen nicht um Einzelphänomene im zufälligen Nach
einander handelt, sondern um einen Entwicklungsprozeß der Kontinuität
in der Diskontinuität, der in Deutschland insgesamt demokratiefördernd
gewirkt hat. Die in diesem Zusammenhang systematischgewonnenen Ergeb-
- VI -
nisse geben die vom Verfasser erkannten Wahrscheinlichkeiten hinsicht
lich des Entstehungs-, Verlaufs- und Wirkungszusammenhangs an. Dabei
allein und unreflektiert auf Zahlenmaterial und Prozentangaben zu ver
trauen, hätte im Zweifelsfall geheißen, sich angesichts der Alterna
tive, vage ungefähr Richtiges oder auf sehr präzise Weise Falsches zu
sagen, für letzteres zu entscheiden. Deshalb hielt es der Verfasser
mit dem Amerikaner Shackles, der die erste Option mit dem Hinweis fa
vorisierte, daß sich auch die Wettervorhersage sicher leichter er
stellen ließe bei Abwesenheit der Atmosphäre.
Im Dezember 1985 konnte dann das Forschungsunternehmen beendet und die
Arbeit dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Justus-Liebig
Universität Gießen als Dissertation vorgelegt werden. Ich erwähne es
gerne, während der zurückliegenden Jahre haben mich viele ideell und
menschlich unterstützt. Meinen Freunden und Bekannten möchte ich des
halb auf diesem Weg herzlich danken.
Mein besonderer Dank aber gilt Herrn Prof. Dr. Franz Neumann für die
Betreuung dieser Untersuchung. Seine konstruktive Kritik und sein wis
senschaftliches Interesse hätte ich zu keinem Zeitpunkt missen wollen.
Für die Anregungen möchte ich Herrn Prof. Dr. Bruno Reimann danken,
mit dem ich wichtige Teile dieser Arbeit diskutiert habe. Herzlich
danken möchte ich auch Herrn Dr. Günter Schärer-Pohlmann, mit dem mich
ungezählte Diskurse verbinden, die wir telefonisch, brieflich und
persönlich geführt haben.
Der größte Dank aber gilt meiner Frau. Durch ihre Tatkraft und
Empathie ist mir die Vorstellung unmöglich geworden, daß diese Arbeit
ohne sie hätte zustande kommen können.
Für die sehr gewissenhafte und verständige Erstellung der Textvorlage
bin ich auch Frau Käthe Schlapp zu besonderem Dank verpflichtet.
Gießen, den 5. Juli 1986 Lothar Rolke
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungen XIII
I. Teil: Einleitung
1 • Forschungsgegenstand und Erkenntnisanspruch 1
2. Problemhorizont 2
3. Forschungsstrategische Grundannahme 5
4. Materialbasis und -aufbereitung 10
5. Theorieentwicklung 13
6. Zusammenfassung und Untersuchungsaufbau 19
II. Teil: Theoretische Grundlagen für die Analyse sozialer
Bewegungen 22
1 • Der Begriff der sozialen Bewegung in historischer
Perspektive 24
1 • 1 Soziale Bewegung als gesellschaftliche Entwicklung 25
1.2 Soziale Bewegung als praktische Negation 26
1.3 Die Arbeiterbewegung als Inbegriff der sozialen
Oppositionsbewegung 27
1 .4 Die Unvermittelbarkeit von Systemzweck und Individual
motiv 28
1.5 Zusammenfassung und Problembefund 30
2. Positive Merkmalsbestimmung sozialer Bewegung - eine
Kritik 32
2.1 Soziale Bewegung und Emanzipation 33
2. 1. 1 Die faschistische Bewegung als Desillusionierung 34
2.1 .2 Die Unsicherheit der Moderne als Problem 36
2.2 Die Arbeiterklasse als Vorbild für die Trägerschaft
sozialer Bewegung 39
2.2. 1 Das Ende der Arbeiterbewegung und die Suche nach
theoretischen Alternativen 39
2.2.2 Die Erosion der proletarischen Kultur 41
2.3 Die Allzuständigkeit der Organisationen der Partei
und der Gewerkschaft 43
2 .3. 1 Soziale Organisation und Systemintegration 43
2.3.2 Die Historizität der Arbeiterorganisationen 45
2.4 Problembefund und analytische Aussichten 47
3. Gesellschaftstheorie und Theorie sozialer Bewegung -
eine forschungspragmatische Skizze 49
3. 1 Gesellschaftstheoretische Vorüberlegungen 52
3. 1.1 Begründung des zweistufigen Gesellschaftsmodells 53
3.1.2 Die Dualität des Fragehorizonts 57
3.2 Gesellschaften als System und Lebenswelt 59
3.2.1 Konstituenten der Lebenswelt und Handlungsanalyse 60
3.2.2 Komplexitätssteigerung und Systembildung 64
3.2.3 Strukturkonflikte 69
3.2.3.1 Rolle und Person 70
- VIII -
3.2.3.2 Normenregulierte Beziehungen und Steuerungsmedien 73
3.2.3.3 Handlungswissen und selbstreferentielle Programmie 77
rung
3.2.3.4 Exkurs: Konstituenten des Orientierungssystems 84
3.2.4 System und Lebenswelt als labiles Balance-Verhältnis 86
3.3. Soziale Bewegung und gesellschaftliche Entwicklung -
eine gesellschaftstheoretische Antwort 92
3.3.1 Entstehung und historisches Selbstmißverständnis
der Akteure 92
3.3.2 Soziale Bewegung als Exponent der Lebenswelt 94
3.3.3 Soziale Bewegungen als Systemkontrahenten 99
3.3.3.1 ökonomisches System und Arbeiterbewegung 102
3.3.3.2 Politisches System und neue soziale Bewegungen 105
3.3.4 Soziale Bewegungen als Lernprozeß 106
3.4 Zusammenfassung und Grunddefinitionen 110
4. Untersuchungsanleitung 113
III. Teil: Protestbewegungen in der Bundesrepublik 1945/49 - 83.
Rekonstruktion einer Entwicklung 116
1. Kapi te 1: Antifaschistischer Konsens, gesellschaftliche Restau
ration und Vorentscheidungen für die Herausbildung
außerparlamentarischer Protestbewegungen 1945 - 49 117
1 • Der "antifaschistische Konsens" 118
2. Grundzüge der "Antifa-Bewegung" 122
2.1 Entstehungsbedingungen und Traditionslinien 124
2.2 Handlungsfelder und Handlungsrestriktionen 126
2.3 Strukturelle Grenzen der Antifa-Bewegung 130
3. Paralysierung des antifaschistischen Konsens als
Folge der Systemkonstituierung 131
3.1 Antifaschismus vs. Verwaltungswiederaufbau 133
3.2 Demokratie vs. antikommunistische Abgrenzung im
Parteiensystem 136
3.3 Antimilitarismus vs. ökonomische Westintegration 139
3.4 Antimonopolismus vs. gewerkschaftlicher Zentralismus 141
4. Vorentscheidungen für die Herausbildung außerparla
mentarischer Oppositionsbewegungen nach 1949 143
4.1 Die Integration der Arbeiterbewegung 146
4.2 Anzeichen für die Freisetzung der späteren Protest
potentiale 147
2. Kapitel: Kooperationsversuche von außerparlamentarischer und
parlamentarischer Opposition: Von der Ohne-mich-Bewe
gung zur Anti-Atomwaffenbewegung 1950 - 59 152
1. Wiederaufrüstung als Systemimperativ 153
2. Formierung und Verlauf der außerparlamentarischen
Oppositionsbewegung gegen die Wiederbewaffnung 158
2.1 Die diffuse Artikulation des Protests 158
2.2 Versuche der Organisierung: die Polarität von kommu
nistischer Volksbefragungsaktion und bürgerlichen
Neutra 1i sten 162
- IX -
2.2.1 Die KPD und die Volksbefragungsaktion 164
2.2.2 Die bürgerliche Opposition der Neutralisten 167
2.3 Die Neuformierung der Wiederbewaffnungsgegner in
der Paulskirchenbewegung und ihr Scheitern 172
3. Gründe des Scheiteros 177
3.1 Die Widersprüchlichkeit der Motivstruktur 177
3.2 Politisch-kulturelle Restriktionen 180
3.3 Die erzwungene Asymmetrie in den Interaktionsbe
ziehungen von politischem System und Bewegung 182
4. Die Folge-Bewegung gegen die Atombewaffnung 183
4.1 Rahmenbedingungen und Konsequenzen einer versuchten
westdeutschen Atombewaffnung 184
4.2 Von sporadischen Einzelaktivitäten zur "Initial
zündung" durch die Erklärung der "Göttinger Achtzehn" 185
4.3 Die Formierung der Kampagne "Kampf dem Atomtod" und
ihr Scheitern 187
4.4 Abklang und Nachwirkungen 190
5. Lernschritte und Nachwirkungen der Bewegungen der
50er Jahre 192
3. Kapitel: Die Verselbständigung und Professionalisierung des
außerparlamentarischen Protests: Die Bewegungen der
Ostermarschierer und Notstandsgegner 1960 - 68 und
ihre Konvergenz in der Apo 195
1 • Kontinuität der Protestanlässe 195
2. Die Entwicklung der Ostermarsch-Bewegung als selbst
organisierter Lernzusammenhang 197
2.1 Die Entstehung der Ostermarsch-Bewegung und ihre
konstitutiven Merkmale 199
2.2 Stabilisierung und Profilierung bis 1964 202
2.3 Die politische Verbreiterung 1964 - 68 210
2.4 Integrative Oberforderung und Erosion 1968 214
3. Die Notstandsopposition als Qualifikationshilfe des
außerparlamentarischen Protests 216
3.1 Die innergesellschaftliche Stoßrichtung der Hot-
standsgesetze 217
3.2 Die Bewegung gegen die Notstandsgesetze 219
3.2.1 Problemrezeption und Positionsbestimmung bis 1962 219
3.2.2 Zeitgewinn und Meinungsumschwung durch die "Spiegel
Affäre" und Profilierung der Notstandsopposition
bis 1965 222
3.2.3 Die Notstandsgegner ab 1965 in Bewegung 226
3.2.4 Das Ende in der Apo 1967/68 231
4. Verdichtung, Vernetzung und Handlungsgrenzen der
Protestbewegungen 233
5. Lernschritte und Folgewirkungen der frühen Bewegungen
der 60er Jahre 238