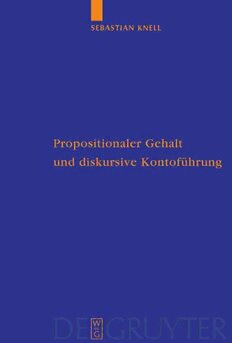Table Of ContentSebastian Knell
Propositionaler Gehalt und diskursive Kontoführung
W
DE
C
Quellen und Studien
zur Philosophie
Herausgegeben von
Jürgen Mittelstraß, Dominik Perler,
Wolfgang Wieland
Band 63
Walter de Gruyter · Berlin · New York
Propositionaler Gehalt
und diskursive Kontoführung
Eine Untersuchung zur Begründung
der Sprachabhängigkeit
intentionaler Zustände bei Brandom
von
Sebastian Knell
Walter de Gruyter · Berlin · New York
© Gedruckt auf säurefreiem Papier,
das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.
ISBN 3-11-018126-6
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut-
schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© Copyright 2004 by Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, D-10785 Berlin
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Ubersetzungen, Mikro-
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen
Printed in Germany
Umschlaggestaltung: Christopher Schneider, Berlin
Meinen Eltern
Vorbemerkung
Das vorliegende Buch ist die umgearbeitete und um mehrere Kapitel
gekürzte Fassung meiner Dissertationsschrift, die ich im Jahre 2002 an
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt eingereicht habe. Es
enthält eine detaillierte Untersuchung zu der Frage, ob Robert B. Bran-
dom in seiner 1994 erschienenen Monographie „Making It Explicit" eine
überzeugende Begründung für die These anbietet, nur sprachfähige
Wesen seien in der Lage, intentionale Zustände im eigentlichen Sinne zu
haben.
Bei der Arbeit an diesem Buch haben mich viele Menschen begleitet
und unterstützt, denen ich Dank schulde. An erster Stelle sei hier mein
Doktorvater Friedrich Kambartel genannt, der in den vergangenen Jahren
zu meinen wichtigsten philosophischen Lehrern gehört hat und mit dem
ich in einer frühen Phase des Projektes das intellektuelle Abenteuer der
Entdeckung von Brandoms neu erschienenem Opus teilen durfte. Ebenso
danken möchte ich Wolfgang Kuhlmann für das starke Interesse, das er
meiner Arbeit in vielen Gesprächen zwischen den Jahren 1999 und 2001
entgegengebracht hat, sowie für seine Bereitschaft, meinen Interpreta-
tionsvorschlägen zu Brandom in gemeinsamen Lehrveranstaltungen
freien Lauf zu lassen. Ein weiterer Dank gebührt Angelika Krebs, die
mir beim Abschluß der Arbeit mit Rat und Tat zur Seite stand und die
mich in der Endphase der Textproduktion auch dadurch unterstützt hat,
daß sie mich von zeitaufwendigeren Aufbauarbeiten an ihrem neu ange-
tretenen Baseler Lehrstuhl befreit hat.
Dank schulde ich außerdem Wolfgang Detel, der an der ursprüngli-
chen Version des Textes eine ausführliche konstruktive Kritik geübt hat.
Gewinnbringende Diskussionen zu Brandom konnte ich ferner mit Ale-
xander Becker, Eva Gilmer, Thorsten Jantschek, Dominik Perler, Ri-
chard Raatzsch, Susanna Schellenberg, Barbara Schmitz, Matthias Vogel
und Marcus Willaschek führen. Meinem früheren akademischen Lehrer
Jürgen Habermas danke ich dafür, daß er mein Dissertationsvorhaben
auch nach seiner Emiritierung über viele Jahre hinweg mit aufmuntern-
Vili Vorbemerkung
den Ratschlägen unterstützt hat. Ein besonderer Dank gebührt schließlich
Robert Brandom selbst, der durch seine Bereitschaft zu einer Vielzahl
von persönlichen Gesprächen in Frankreich, Deutschland und den USA
dazu beigetragen hat, mein Verständnis seines Buches zu verbessern -
auch wenn er keine Verantwortung für die vielen Mißverständnisse trägt,
die auf meiner Seite zurückgeblieben sein dürften.
Zum Gelingen der Arbeit wesentlich beigetragen hat ferner ein For-
schungsstipendium des DAAD, das mir im Jahre 1999 einen mehrmona-
tigen Aufenthalt an der University of Pittsburgh ermöglicht hat. Ebenso
möchte ich dem Fonds zur Förderung der Geisteswissenschaften der
Freiwilligen Akademischen Gesellschaft Basel für eine Zuzahlung zu
den Druckkosten danken. Sehr profitiert habe ich zudem von Eva Gil-
mers geduldiger Hilfe bei der sprachlichen Feinarbeit und der Lösung
stilistischer Probleme. Der Freundin von St. Sulpice danke ich für die
vielen inspirierenden Anlässe, den Beginn der eigentlichen Schreibphase
hinauszuzögern. Am meisten hervorzuheben ist jedoch Henriette Pleiger,
der ich neben einem überaus geistreichen coaching einfach alles verdan-
ke, was man sich während der Arbeit an einem philosophischen Buch
nur wünschen kann.
Basel, im April 2004 Sebastian Knell
Inhalt
Vorbemerkung VII
Einleitung: Die linguistische Wende der Philosophie und
die Stellung der Sprache in der Philosophie des Geistes 1
Erster Teil: Brandoms Theorie begrifflichen Inhalts 21
Kapitel I: Die Grundzüge der konstitutionstheoretischen Erklärung
begrifflichen Inhalts und das theoretische Modell der diskursiven
Kontoführung 25
(1) Die konstitutive Übertragung begrifflicher Gehalte
durch soziale Praktiken 25
(2) Zwei grundlegende explanatorische Prinzipien 30
(a) Die inferentielle Natur begrifflicher Gehalte 31; (b) Die konstitutive Über-
tragung begrifflicher Gehalte als praxisimplizite Form der Projektion 37
(3) Die Signifikanz assertorischer Äußerungen und
die Praxis der diskursiven Kontoführung 40
(a) Die systematische Rolle von Behauptungen innerhalb des Spiels des Lie-
ferns und Forderns von Gründen 42; (b) Grundelemente der rekonstruktiven
Theoriesprache Brandoms 44; (c) Das sprachtheoretische Modell der dis-
kursiven Kontoführung 49; (d) Überzeugungen als doxastische Festlegun-
gen 58; (e) Diskursive Kontoführungspraktiken als allgemeines Organ der
konstitutiven Übertragung propositionaler Gehalte 61
Kapitel Π: Kritische Rekonstruktion des theoretischen
Kernmodells 64
(1) Inferentielle Rollen als Rollen in komplexen
normativen Strukturen 66
(a) Zirkulär erscheinende Elemente in Brandoms Theoriesprache 66;
(b) Die gehaltkonstitutiven inferentiellen Rollen assertorischer
Äußerungen 71; (c) Die gehaltkonstitutiven inferentiellen
Rollen doxastischer Festlegungen 78
χ Inhalt
(2) Die Übertragung propositionaler Gehalte durch
diskursive Kontoführungspraktiken 85
(a) Diskursive Kontoführung als implizite Projektion
gehaltkonstitutiver normativer Rollen 86; (b) Verschiedene Aspekte des
kontoführenden Übertragungsvorgangs 90; (c) Die dreistufige Struktur der
konstitutionstheoretischen Erklärung propositionaler Gehalte 96
(3) Kritischer Nachtrag 101
Kapitel ΙΠ: Erweiterungen und Ergänzungen des
theoretischen Kernmodells 117
(1) Die begrifflichen Gehalte von Wahrnehmungsberichten,
Handlungsabsichten und subsententialen Ausdrücken 118
(a) Wahrnehmungsberichte und empirischer Gehalt 119; (b) Praktische
Festlegungen und Handlungen 125; (c) Subpropositionaler begrifflicher
Gehalt und substitutionelle Inferenzen 131
(2) Die repräsentationale Dimension begrifflichen Inhalts
und die Objektivität begrifflicher Normen 138
(a) Die umgangssprachliche Verankerung des Repräsentationsbegriffs
in De-re-Zuschreibungen sprachlicher Äußerungen und intentionaler
Zustände 143; (b) Der besondere Sinn von De-re-Zuschreibungen und die
sozialperspektivische Ausdifferenzierung inferentieller Rollen 147;
(c) Soziale Perspektivendifferenz und Objektivität 166
(3) Die expressive Rolle des logischen Vokabulars 172
Zweiter Teil: Zur Begründung der Sprachabhängigkeit intentionaler
Zustände in „Making it Explicit" 179
Kapitel IV: Die von Brandom vertretene Sprachabhängigkeitsthese ..181
(1) Systematische Vorklärungen 182
(a) Die globale SBI-These 183; (b) Die systematische Spannung zwischen
der globalen SBI-These und unserer alltäglichen Zuschreibungspraxis 193;
(c) Verschiedene Formen der systematischen Differenzierung 197; (d) Höher-
wertige und niedere Erscheinungsformen intentionaler Zustände 202;
(e) Vollwertige und defiziente intentionale Zustände 205
(2) Brandoms Version der SBI-These und die Lokalisation
der zugehörigen Begründung 211
(a) Das Begründungsziel 212; (b) Die Lokalisation des Argumentes 221;
(c) Erläuterung der weiteren Vorgehensweise 225