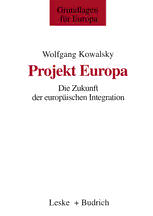Table Of ContentWolfgang Kowalsky
Projekt Europa
Reihe
Grundlagen für Europa
Herausgegeben von Wilfried Loth
Band 2
Wolfgang Kowalsky
Projekt Europa
Die Zukunft
der europäischen Integration
Leske + Budrich, Opladen 1997
Für Ingrid
Gedruckt auf säurefreiem und altersbeständigem Papier.
ISBN 978-3-8100-1859-5 ISBN 978-3-322-97386-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-97386-3
© 1997 Leske + Budrich, Opladen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfaltigungen, Übersetzungen, Mi
kroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ............................................................................................ 5
Geleitwort von Professor Wilfried Loth .......................................................... 7
Vorwort .......................................................................................................... 9
1. Perspektiven des politischen Projekts
der europäischen Integration ....................................................... 11
2. Etappen der europäischen Integration von 1958
bis zum Epochenbruch 1989/90 .................................................... 21
2.1 Vorgeschichte seit dem Ersten Weltkrieg ....................................... 22
2.2 Die politische Dimension ................................................................ 27
2.3 Die ökonomische Dimension .......................................................... 31
2.4 Strukturen, Institutionen, Verfahren
der Europäischen Union .................................................................. 36
3. Europa und die Europäische Union nach 1989/90 ..................... 45
3.1 Die politische Entwicklung ............................................................. 45
3.2 Die ökonomische und währungs politische
Entwicklung hin zur Währungsunion .............................................. 60
4. Europaleitbilder als Katalysatoren oder Blockaden des
europäischen Integrationsprozesses ............................................ 75
4.1 Rechtsintellektuelle Europakritik .................................................... 87
4.2 Linksintellektuelle Europakritik ...................................................... 94
4.3 Kongruenzen und Konvergenzen der Europakritik ....................... 103
4.4 Selbstblockaden der europapolitischen Debatte:
Erweiterung versus Vertiefung ...................................................... 104
4.5 Selbstblockaden einer gemeinsamen Außenpolitik:
Jugoslawien und die Folgen .......................................................... 108
4.6 Folgerungen fiir ein modemes Europaleitbild (I) .......................... 111
5. Erkundung der Europalosigkeit ................................................ 115
5.1 Die Kritik am Demokratiedefizit.. ................................................. 120
5.2 Demokratiedefizite des Europäischen Parlaments ......................... 127
5.3 Demokratisierung durch europäische Verfassungsgebung ............ 133
5
5.4 Demokratisierung als Selbsteuropäisierung .................................. 138
5.5 Folgerungen für ein modemes Europaleitbild (I1) ......................... 143
6. Das Spannungsverhältnis Supranationalität -
Nationalstaat im integrierten Europa ........................................ 151
6.1 Neue Dynamik im Verhältnis Nationalstaat-
Europäische Union ........................................................................ 154
6.2 Gegner supranationaler Integration: Strategien und
Formierungstendenzen .................................................................. 162
7. Europapolitische Voraussetzungen für die Umsetzung
eines modernen Europaleitbildes ............................................... 169
7.1 Die französisch-deutsche Kooperation beim
Aufbau Europas ............................................................................. 169
7.2 Die grundsätzlichen Optionen deutscher
Europapolitik der 90er Jahre ......................................................... 180
7.3 Eckpunkte der europapolitischen Debatte in Deutschland ............ 184
8. Entwicklungstendenzen deutscher Europapolitik
im Lichte integrationspolitischer Anforderungen
und ihrer Kosten ......................................................................... 205
8.1 Europapolitische Zukunftsszenarien .............................................. 216
8.2. Conclusio -Zivilisierung der europäischen
Binnenbeziehungen ? .................................................................... 224
Literaturverzeichnis ..................................................................................... 231
Abkilrzungsverzeichnis ............................................................................... 247
Personen verzeichnis .................................................................................... 251
Stichwortverzeichnis ................................................................................... 254
6
Geleitwort von Professor Wilfried Loth
Die Europäische Union ist zu einem zentralen Moment europäischer Staat
lichkeit geworden. Ob wirtschaftliche Produktivität, die Behauptung zivilge
sellschaftlicher Ordnung im Globalisierungssturm, innere Sicherheit, die Be
wältigung der ökologischen Herausforderung, das innereuropäische Gleich
gewicht oder die Handlungsfähigkeit nach außen: kein wesentlicher Politikbe
reich kann von der nationalstaatlichen Ebene allein aus mit Aussicht auf Er
folg gestaltet werden, in jedem spielt die europäische Handlungsebene eine
unabdingbare Rolle; oft ist sie ausschlaggebend oder sie könnte es sein.
Freilich ist die Union nicht in der Verfassung, die sie brauchte, um ihren
vielfältigen und weitreichenden Aufgaben gerecht zu werden. Ehrgeizige
Projekte wie die Währungsunion sind gefährdet, und langfristig droht die
Gemeinschaft durch Zuwachs immer weiterer Aufgaben in Verbindung mit
ebenfalls zunehmender Diversifizierung der Verfahrensweisen in die Hand
lungsunfähigkeit abzugleiten. Diese Malaise ist nicht zuletzt auf die Art und
Weise zurückzufiihren, in der über die Zukunft der Europäischen Union de
battiert wird: Die Debatte findet zwar statt, weil die europäische Ebene unter
dessen unübersehbar geworden ist; sie wird jedoch zumeist auf einem Niveau
gefiihrt, das die Größe der Herausforderung bei weitem verfehlt.
Hier setzt das neue Buch von Wolfgang Kowalsky ein: Es zeigt, wie un
angemessen, wie klischeehaft und abstrakt die Argumente derjenigen sind, die
glauben, sich als Kritiker des realen Integrationsprozesses profilieren zu müs
sen. Und es macht zugleich auf bestürzende Weise deutlich, wie wenig oft
auch in den Reihen derjenigen nachgedacht wird, die sich als grundsätzliche
Befiirworter des europäischen Integrationsprozesses verstehen. Die Heraus
bildung eines europäische Demos, der die Nationen des alten Kontinents nicht
etwa aufhebt, sondern ihnen durch eine Transformation europäischer Staat
lichkeit überhaupt erst eine Zukunft sichert, ist historisch ein so neuartiges
Phänomen, daß es die Europäer mit ihrer durch die Welt der Nationalstaaten
geprägten Begrifflichkeit oftmals überfordert.
Kowalsky deckt mit klarem Blick fiir das Wesentliche die Schwächen
gängiger Europa-Diskurse auf. Er macht mit überzeugenden Argumenten
deutlich, daß der Fortgang der europäischen Integration entscheidend von der
Bereitschaft abhängt, sich auf ein Kerneuropa einzulassen, das fiir die weni
ger integrierten Mitglieder anschlußfähig bleibt. Und er weist nach, daß die
7
Chancen rur ein solches Europa umso größer werden, je mehr Anstrengung
auf die Schaffung eines "sozialen Europas" verwandt wird: auf die Entwick
lung zivilisierter Binnenbeziehungen in der europäischen Gesellschaft. Ange
sichts des Diskussionsstandes ist das gewiß nicht einfach zu erreichen. Es ist
aber auch kein utopisches Ziel. Kowalsky nennt konkrete Reformmaßnahmen,
die weitreichende Wirkungen versprechen und gleichwohl grundsätzlich kon
sensflihig erscheinen.
Ihre Thematisierung trägt jedenfalls dazu bei, die Kräfte zu stärken, de
nen an einer Behauptung europäischer Zivilisation im Deregulierungsstrom
liegt. Kowalskys Buch ist darum eine breite Rezeption zu wünschen. Sie wür
de dazu beitragen, daß das Projekt Europa endlich mit dem Ernst und der Ge
nauigkeit diskutiert wird, die der Problemlage angemessen sind.
Essen, im März 1997 Wi/fried Loth
8
Vorwort
Professor Wilfried Loth hat mir die stringente Arbeit an diesem Werk durch
eine Einladung an das Kulturwissenschaftliche Institut im Wissenschaftszen
trum Nordrhein-Westfalen ermöglicht. Ich danke ebenfalls dem Vorsitzenden
der IG Metall Klaus Zwickel, seinen Abteilungsleitern Klaus Lang und Klaus
Schmid, dem Leiter der - bis dato - Grundsatzabteilung Reinhard Kuhlmann
dafür, daß sie mir einen zeitweiligen Ausstieg aus dem Berufsleben gestatte
ten. Ausdrücklich und mit Dank erwähnen möchte ich die zahlreichen Anre
gungen, die ich den fruchtbaren Diskussionen mit Dr. Gerda Falkner, Susanne
Mantino, Prof. Bemdt Keller, Prof. Franz Greß, Prof. Rainer M. Lepsius, Dr.
Wolfg ang Schroeder, Manfred Müller, wiederum Prof. Wilfried Loth und all
jenen, die hier nicht genannt werden können, entnehmen konnte. Für die sorg
fältige editorische Bearbeitung danke ich herzlich Dr. Jörg Gerkrath. Für das
Ergebnis - und die verbliebenen Fehler - trage ich natürlich alleine die Ver
antwortung.
Wolfgang Kowalsky Brüssel, im April 1997
9
1. Perspektiven des politischen Projekts der
europäischen Integration
Europessimismus und Euroschelte sind in Mode. Warum ist Europa kein
Thema (mehr), das Hoffnungen weckt -um nicht zu sagen: die Kraft zur Uto
pie hat? Hat der europäische Integrationsprozeß nach 1989 seine raison
d'etre verloren? Eine Überprüfung des europäischen Projekts ist seit dem
"Epochenbruch" bzw. der "Epochenwende" von 1989/901 und vor allem seit
"Maastricht" unumgänglich. Die Europäische Union hat sich diese Aufgabe
mit ihrer Regierungskonferenz vorgenommen, die unbeachtet von der breiten
Öffentlichkeit "im stillen Kämmerlein" tagt, während sich die europapoliti
sche Debatte auf Währungsunion und Konvergenzkriterien konzentriert. Die
einstige "Europhorie" ist nicht allein in Deutschland längst in Euroskepsis
umgeschlagen2 und droht auszuwachsen zu einer "Europhobie" und der
Furcht vor dem Eintausch einer "Stahlmark" gegen einen "wabbligen Euro":
"Newsweek" vom 29. Januar 1996 war "Europhobia" ein Titelthema wert.
Routine, Nüchternheit und Abgeklärtheit haben den europäischen Elan der
frühen Jahre vergessen lassen. Nach dem Sinn der politischen Einigung zu
fragen ist höchst unzeitgemäß, obwohl ihre Legitimität und damit ihre
Grundlage einer schleichenden, nach Maastricht disruptiven Erosion unter
liegt.
Vermutlich gibt es ziemlich banale Gründe rur die Europaabstinenz: Der
Horizont der Weltkriege entfernt sich zusehends, und Europa ist erstens in
zwischen in vielem normaler Alltag, die Erfahrungen der Kleinstaaterei, der
durch Kontrollen und genehmigungsbedilrftige Devisen behinderten Reise
freiheit, sind Vergangenheit. Zweitens flUit Europa durch die Wahmehmungs-
Siehe Peler GIOlz, Die falsche Normalisierung. Die unmerkliche Verwandlung der Deut
schen 1989 bis 1994. Essays, Frankfurt 1994, S. 190; Ulrich Beck, "Hochmodern und erz
reaktionar" (Interview), in: WirtschaftsWoche Nr. 17 vom 20. April 1995, S. 51 bzw. Jür
gen Habermas, Die Normalität einer Berliner Republik, FrankfurtlM. 1995, S. 173.
2 Merkwürdigerweise geht Annette Maurer davon aus, daß die jahrelange Eurosklerose bzw.
der Europessimismus einer "wahren Euroeuphorie" gewichen sei, allerdings ohne die Spur
einer Begründung zu liefern. Siehe Annette Maurer, Die europäische Antwort auf die so
ziale Frage. Eine Analyse zur europäischen Binnenmarktdynamik und ihrer sozialpoliti
schen Implikationen, Marburg 1993, S. 2, 13,74.
11