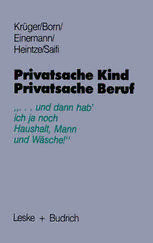Table Of ContentKrüger/Born/Einemann/Heintze/Saifi
Privatsache Kind - Privatsache Beruf
Helga Krüger/Claudia BornlBeate Einemann
Stine Heintze/Helga Saifi
Privatsache Kind -
Privatsache Beruf
" . . . und dann hab' ich ja
noch Haushalt, Mann und Wäsche"
Zur Lebenssituation von Frauen mit
kleinen Kindem in unserer Gesellschaft
+
Leske Budrich, Opladen 1987
Helga Krüger, Dr. phil., Professorin fur Farniliensoziologie,farniliale und berufli
che Sozialisation im Studiengang Berufliche Bildung der Universität Bremen;
Ausbildung von Lehrkräften fur die berufliche Fachrichtung Sozialwissen
schaft/Sozialpädagogik. Mitglied der Sachverständigenkommission zur Erstel
lung des 6. Jugendberichts (Verbesserung der Chancengleichheit von Mädchen in
der Bundesrepublik Deutschland, Bundestagsdrucksache 10/1007, Bonn 1984).
Mitorganisatorin der " Hochschultage Berufliche Bildung" (1980 in Bremen, 1982
in Hannover, 1984 in Berlin, 1986 in Essen). Mitherausgeberin der Reihe "Quali
fikationen fur Erzieherarbeit", München (DH).
Claudia Bom, DipI.Psych., wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Bre
men. Zusammen mit Christine Vollmer Verfasserin der Studie, , Familienfreundli
che Gestaltung des Arbeitslebens", Bd. 135 Schriftenreihe des BMJFG, Stuttgart
1983.
Beate Einemann, Studentin der Sozialpädagogik an der Bremer Universität. Als
Kinderpflegerin/Erzieherin langjährige Mitarbeit in der Universitäts
Kinderkrippe. Mutter eines unter dreijährigen Kindes.
Christine Heintze, Dipl.-Soz. päd., vor und während des Studiums Mitarbeiterin
in privaten Kleinkindgruppen.
Helga Saifi, Soz. grad., Stud. Ass. Berufliche Fachrichtung Sozialwissen
schaft/Sozialpädagogik. Als Sozialpädagogin langjährige Mitarbeit in einem städ
tischen Kindergarten. Mutter eines unter dreijährigen Kindes.
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Privatsache Kind - Privatsache Beruf: ". . . und
dann hab' ich ja noch Haushalt, Mann u. Wäsche";
zur Lebenssituation von Frauen mit kleinen Kindern
in unserer GeselIschaft / Helga Krüger . . . -
Opladen: Leske und Budrich, 1987.
ISBN 978-3-8100-0571-7 ISBN 978-3-322-97174-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-97174-6
NE: Krüger, Helga [Mitverf.]
© 1987 by Leske Verlag + Budrich GmbH, Leverkusen
Gesamtherstellung: Presse-Druck und Verlags-GmbH, Augsburg
Vorwort
Das vorliegende Buch ist Ergebnis eines Forschungsprojektes, in des
sen Mittelpunkt die Fragen nach der Bewältigung jener Phase im Leben
von Frauen steht, in der sie durch Kinder, die noch nicht das
Kindergarten-oder Schulalter erreicht haben, mit hohen Farnilienaufga
ben konfrontiert sind. Viele Frauen scheiden während dieser Phase aus
dem Erwerbsleben aus und widmen sich ganz dem Kind. Für die übrigen
wird die Erwerbsarbeit schwieriger. "Da mu6 man schon mal ein biB
chen flexibel sein", setzt die ganztagsberufstätige Kontoristin ihre Aus
sage fort, die wir als Titel flir dieses Buch gewählt haben. Frauen, die Ra
stellis der Nation? Welche Rolle spielen sie auf dem Arbeitsrnarkt, in der
Sozialpolitik, in der Familie? Wir haben uns auf der Basis qualitativer In
terviews in langen Gesprächen mit der Sichtweise und Interpretation der
Frauen über ihre Lage auseinandergesetzt, mit erwerbstätigen und nicht
erwerbstätigen Müttem unter dreijähriger Kinder. Diese Interviews bil
den die Grundlage dieses Buches.
Die Auswertung der Interviews gruppiert sich urn die von den Frauen
am meisten diskutierten Probleme, die der Bedeutung der Erwerbsarbeit,
der Motive und Chancen, sie beizubehalten oder aufzugeben (Kap. 11),
den Kontroversen urn den ,Nothilfecharakter' angebotener Betreuungs
möglichkeiten flir ihre Kinder (Kap. 111), der zunehmenden Tendenz zur
gewollten oder erzwungenen Selbstorganisation von Betreuungsformen,
die dem einen als gute Lösung erscheinen, dem anderen als Notbehelf an
gesichts staatlicher Reprivatisierungsversuche schon erreichter öffentli
cher Unterstützungen (Kap. IV). Uns selbst erschien bei Durchsicht der
Interviews ein Problem besonders bedeutsam, das Mütter offensichtlich
von sich aus kaum diskutieren: Die Frage nach den eigenen Interessen,
den Differenzen zwischen erwerbstätigen und nicht-erwerbstätigen Müt
tem, der Ähnlichkeiten in der Lage der sich vorrangig Haus und Kind
widmenden Mütter. Mütter scheinen in Widersprüchen verhaftet, ihr
Selbstkonzept verschwindet je nach den eingenommenen Perspektiven
hinter den Personen, die Frauen als von sich abhängig erleben. Diesen
verborgenen, z.T. erst in längeren Gesprächen bewu6t werdenden Ambi
valenzen ist unser flinftes Kapital gewidmet.
5
Bei der vergleichenden Auswertung der Interviews nach Themenkom
plexen geht die unmittelbare Verbindung von Lebenslage und ProbIem
interpretation dennoch Ieicht verloren. Deshalb schlieBen wir dieses
Buch mit zwei Interviews von Frauen, die nach den Daten ihrer Familien
existenz vergleichbar sind - beides Hausfrauen, beide die Kinder seibst
betreuend. Hier zeigt sich, daB die gleiche Aussage, etwa die, ,ich bin zu
frieden mit dem, was ich habe", Ausdruck der Verarbeitung ganz unter
schiedlicher Realitäten sein und völlig Unterschiedliches heiBen kann.
Urn sich als Leser in die Lage der Frauen zu versetzen, ist es notwen
dig, sich die normativen Veränderungen im Selbstbild von Frauen heute
zu vergegenwärtigen (Kap. I), aber auch die bestehenden Rahmenbedin
gungen zu kennen, die den Frauen beim Gespräch stets gegenwärtig sind.
Die Lösungsversuche der Mütter, ihre subjektive Probiemsicht, wird erst
unter Kenntnis dieser Bedingungen nachvollziehbar. Deshalb sind kurze
Rekapitulationen der Ergebnisse unserer Strukturanalyse zum Arbeits
markt für Frauen einerseits, zu den staatlichen Versorgungsleistungen an
dererseits vor denjeweiligen KapiteIn notwendig gewesen. Wir verbinden
sie im folgenden Buch mit einer Diskussion der empirischen Anlage des
Projektes und der Auswahl der interviewten Mütter mit dem Ziel, die
Aussagen der Frauen auf der Basis auch statistischer Daten zu ihrer Si
tuation verständlich zu machen. Durch die Verbindung von normativen
Vorgaben, Strukturdaten zu den Lebensbedingungen und subjektiver
Aussage auf dem Hintergrund einer komplexen Biografie scheint es uns
möglich, dem Recht auf Authentizität der Aussagen den Interviewten ge
genüber und dem Interesse der Leserinnen und Leser auf notwendige
Transparenz des Bedeutungsgehalts dieser Aussagen genügen zu können.
Versorgungsleistungen andererseits vor den jeweiligen KapiteIn notwen
dig gewesen. Wir verbinden sie im folgenden Buch mit einer Diskussion
der empirischen Anlage des Projektes und der Auswahl der interviewten
Mütter mit dem Ziel, die Aussagen der Frauen auf der Basis auch statisti
scher Daten zu ihrer Situation verständlich zu machen. Durch die Verbin
dung von normativen Vorgaben, Strukturdaten zu den Lebensbedingun
gen und subjektiver Aussage auf dem Hintergrund einer komplexen Bio
grafie scheint es uns mögIich, dem Recht auf Authentizität der Aussagen
den Interviewten gegenüber und dem Interesse der Leserinnen und Leser
auf notwendige Transparenz des Bedeutungsgehalts dieser Aussagen ge
nügen zu können.
Wir danken den Frauen, mit denen wir diese Gespräche führen konn
ten, aber auch denjenigen, die sich zu Gesprächen bereit gefunden haben,
ohne daB wir sie wegen der begrenzten Zeit-und Finanzmittel in einem
solchen Forschungsvorhaben berücksichtigen konnten. Das Interesse an
6
der über-individuell-gemeinsamen Diskussion über eine Lebensphase,
die in der öffentlichen Meinung als privat-persönlich gilt, ist gewachsen.
Es kann die gro6e Gesprächsbereitschaft dafür als Indiz genommen wer
den, daB die zwei Seiten der Existenz von Frauen, die Suche nach Eigen
ständigkeit in der Gesellschaft und Identität mit der Familie, vor allem
den Kindem, die als zwei Seiten der weiblichen Arbeit diskutiert werden,
zu Veränderungen im Lebenszusammenhang von Frauen führen, die
gleichsam aus dem Privaten überborden. Die Verheimlichung der Heim
Probleme von Mütlem kleiner Kinder scheint nicht mehr im Interesse
dieser Frauen zu sein. Sie setzen dem traditionellen, stillen Rückzug ihre
Problemsicht entgegen. Diesem Interesse hoffen wir, durch das vorlie
gende Buch zu entsprechen.
7
Inhalt
~rwort ............................................................. 5
J. "Es kommt ja nicht vom Himmel gefallen, daB ich wie
der mehr an mich denke". - Ungleichzeitigkeiten und
Widerspruche im Lebenszusammenhang von Frauen .... 13
1. Das ,neue' Leitbild von der weiblichen Eigenständigkeit ... 13
2. Die Angst der Frauen vor der ,Ehe' - eine neue Phase im
Familienzyklus ..................................................... 16
3. Die Bedeutung der Kinder fiir die weibliche Selbsterfiil-
lung .................................................................. 18
4. Das Leben mit kleinen Kindem als Phase der Zuspitzung
von Widersprüchen ................................................ 21
5. Zur Anlage der Untersuchung - welche Mütter haben wir
befragt? .............................................................. 23
11. "Ou muSt auch noch was anderes haben." Berufs-oder
Hausfrau - eine falsche Alternative ......................... 28
1. Berufs-oder Hausfrau: sozialwissenschaftliches Konstrukt
und Realität ......................................................... 30
2. Frauenberufe sind selten Mütterberufe ......................... 34
3. "Nur Kind und Haushalt, das konnte ich mir nicht vorstel
len" - warum Mütter von kleinen Kindem berufstätig sind
oder sein wollen ................................................... 37
3.1 Finanzielle Gründe ................................................ 38
3.2 "Mensch, bist morgens froh, wenn Du zur Arbeit gehen
kannst" - die eigene Zufriedenheit ............................ 41
3.3 "Ich wei13, daB ich eine schlechtere Mutter wäre, wenn ich
nur zuhause wäre." - Pädagogische Gründe ................. 43
3.4 Geschlechtsspezifisches: Der weibliche und der männliche
Blick auf die Erwerbstätigkeit ................................... 44
3.5 Schichtspezifisches: Tendenz zur Angleichung der Motiv
struktur zwischen Arbeiterinnen, Angestellten und Akade-
mikerinnen .......................................................... 47
9
4. "Wieviel schwieriger ist es doch rur uns Frauen, einfach nur
arbeiten und Kinder haben zu wollen!" Konflikte mit der Be-
rufstätigkeit ......................................................... 50
4.1 Erfahrungen mit gesetzlichen Rege1ungen .... ..... ............ 50
4.2 Flexibilisierung des Arbeitseinsatzes ........................... 55
4.3 Wechsel der Tätigkeit und Arbeit in ungeschützten Beschäfti-
gungsverhältnissen ................................................. 60
4.4 "Da muB man sich schon zusammenreiBen und sagen: es
muB laufen." - Konflikte im Berufsalltag ..................... 64
4.5 Der Zwang zur Verheimlichung: eine gute Mutter hat keinen
Beruf - eine vollwertige Arbeitskraft kein Kind - "und die
Männer haben diese Situation sowieso nicht. Gediegen,
nicht?" ............................................................... 69
5. Was es bedeutet, Hausfrau zu sein - und we1che Mutter ist
keine Hausfrau . ......... ......... .... ...... .... ..... .... ........... 74
5.1 "Wir müBten mal die Fliesen abwischen" - veränderte Zu-
ständigkeiten in der Hausarbeit .................................. 75
5.2 "Man macht die Hausarbeit, und es ist irgendwo nie ein
Ende" ................................................................ 78
5.3 "Also Hausarbeit liegt bei mir erstmal ganz hinten dran". 81
5.4 "Zuhause ist man irgendwie abgeschnitten von der Welt". 83
5.5 " ... Da war ich richtig schockiert, daB sie zu mir nicht
,Mama' gesagt hat ..." - Berufstätig: abgeschnitten vom
Kind? ................................................................ 86
6. Z~kunftsperspektiv~~: vom Hausfrauendasein auf Lebens-
zelt zur Ubergangslosung ......................................... 87
111. "Ich wei8 auch nicht, ich sehe, daS er geme mit anderen
Kindem zusammen ist." ÖfIentliche Betreuung versus
Kind zuhause: Vom Nothilfecharakter und den Ideallö-
sungen für kleine Kinder ....................................... 93
1. Die ersten drei LebensjalIre - zur Kontroverse urn die Klein-
kinderziehung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
1.1 Pädagogische Dimensionen ...................................... 95
1.1 Im Stadtstaat Bremen: öffentliche Kleinkindbetreuung aus
sozialpolitischer Sicht ............................................. 97
2. " ... und da wuBte ich nicht, wohin mit ihr. .." Auswahl, was
heiJ3t das? ......... .......... .......... .............................. 101
2.1 Informationsbasis und Entscheidungskriterien bei der Wahl
öffentlicher Betreuungsformen ................................... 101
2.2 " ...d aB meine Kinder mich allein haben" - die Entschei-
dung, zuhause zu bleiben ......................................... 108
10
3. " ...d aB das Kleine eben gut aufgehoben ist ..." Erfahrungen
mit den aufgebauten Betreuungsformen und ihre Bewertung 112
3.1 Das Beste gerade gut genug? - zur Qualität der Krippener-
ziehung .............................................................. 112
3.2 "Das gibt bei uns immer ein Gefühl von Verlassen-Werden".
Unsicherheiten in der Tagespflege .............................. 114
3.3 Zuhause bleiben: Qualität genug? ............................... 116
4. " ...w eil ich der Meinung bin, daB ich dem Kind allein gar
nicht so viel bieten könnte ..." - Veränderungen im Bild der
optimalen Betreuung .............................................. 120
IV "Man kann ja heutzutage entweder nur selbst initüeren
oder man bleibt daheim" - Zur Tragfähigkeit des sozialen
Netzes ............................................................... 125
1. Selbstorganisation als sozialstaatliche Alternative ............ 125
2. Handlungschancen bei der Gestaltung von Betreuungsformen
im sozialen Netz ................................................... 129
2.1 "Manchmal hab' ich das Gefühl, daB es ein Privileg ist, Kin-
der zu kriegen - für Leute die wirklich Geld haben." ..... 129
2.2 Familienorientierung versus AuBenorientierung. Über die
Interdependenz normativer und faktischer Vorgaben ........ 132
2.3 Prioritätensetzung .................................................. 134
3. Eigeninitiative und Organisationsvermögen ................... 136
3.1 Ideallösungen: was für die eine Realität, ist flir die andere
Wunschdenken ..................................................... 136
3.2 "Zu Anfang waren wir zu zweit ..." - Kontakte als Basis flir
den Autbau eines sozialen Netzes ............................... 139
4. Die Pädagogik im sozialen Netz: Verhandlungsgegenstand
oder Nebensache? ........ : ........................................ 143
4.1 "Aber was ich nicht wollte, war so'n verhätscheltes und ver
wöhntes Einzelkind." - Mitsprache und Einflu6mög-
lichkeiten ............................................................ 143
4.2 "Wenn's irgendwie sein muB, dann geht alles." Die Situation
von Kindem in Wechselschicht-Betreuungs-Verhältnissen .. 149
5. Das Unsoziale am sozialen Netz: Verschärfung schichtspezi-
fischer Ungleichheiten ....................................... ..... 152
V. "Hier eine Welt und da eine Welt - und dazwischen
pendie ich immer flei6ig hin und her." - Zum Erleben der
Mutter-Kind-Beziehung ......................................... 155
1. Mütter haben sich verändert - ihre Lebensbedingungen hin-
ken hinterher .................................... .............. ..... 155
11
2. Bestimmungsstücke des Selbstbildes: ein Puzzle aus Versatz-
stücken .............................................................. 157
3. leh find' es besser, wenn man zuhause ist. Auf der anderen
Seite, ich arbeite gem, könnte nicht gut zuhause bleiben." -
Ambivalenzen durch Perspektivewechsel ...................... 158
4. "leh muBte irgendwas fur mich tun, darum ging's letztend
lich." - Eigeninteresse und ihre Verhaltensrelevanz ........ 163
5. "Manchmal hab' ich gedacht, ich werd' ramdösig." - "Und
sie geben einem auch viel." - Die Kinder: Auslöser von Wi-
dersprüchen und Trost zugleich? ................................ 166
6. Kann man etwas richtig machen - wenn man es keinem recht
machen kann? ...................................................... 171
VI. Die Sicht von der Welt hat einen realen Hintergrund .... 175
1. "Interesse an uns Müttem, das kannste vergessen ..." ...... 177
2. "leh hab' viel Zeit fur mich und viel Zeit fur mein Kind". 184
3. Gemeinsame Perspektiven? Von den faktischen und ideologi-
schen Grenzziehungen ............................................ 188
Literaturverzeichnis ....................................................... 193
12