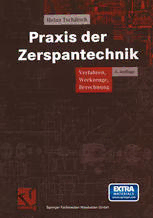Table Of Content(wlKUS)
Praz/s/on an der SchnlHstelle
Prazisions-Sagebander nach ailen
Regeln Innovativer Ingenieurskunst
zu entwickeln und zu lertigen, ist seit
Jahrzehnten WIKUS-Tradition.
Unsere fOhrende Marktslellung ver
danken wir unserer konsequenten
Qualitats- und Marktorientierung.
Slchtbares Zeichen dieser Philo-
sophie 1st die Zertifizierung nach
DIN EN ISO 9001.
Durch unsere Werkserweite
rung in Spangenberg kennen
wlr unseren Kunden noch
rnehr Elfizienz bel der Urn
setzung priiziser Losungen
bieten, die exakt auf das
jeweilige Aufgabenleld zu
geschnilten sind.
WIKUS 1st Prazislon
an der Schnlttslelle.
WIKUS-Sagenlabrik
Wilhelm H. Kullmann
GmbH & Co. KG
Melsunger Sir. 30
0-34286 Spangenberg
Tel.: 05663/500-0
Fax: 05663/500-27
Fax Export: 05663/500-57
www.wikus.de
[email protected]
Heinz Tschatsch
Praxisder
Zerspantechnik
Aus dem Programm ____________- --...
Fertigungstechnik
Arbeitshilfen und Formeln
fur das technische Studium Band 3: Fertigung
von W. Boge und H. Wittig
Das Techniker Handbuch
vonA. Boge
Span lose Fertigung: Stanzen
von W. Hellwig
Fertigungsautomatisierung
von S. Hesse
Werkzeugmaschinen Grundlagen
von A. Hirsch
Praxis der Zerspantechnik
von H. Tschatsch
Praxis der Umformtechnik
von H. Tschatsch
Praktische Oberflichentechnik
von K.-P. Muller
Zerspantechnik
von E. Paucksch
Industrielle Pulverbeschichtung
von J. Pietschmann
vieweg ________________
~
Heinz
Tschătsch
Praxis der
Zerspantechnik
Verfahren, Werkzeuge, Berechnung
6., aktualisierte und erweiterte Auflage
Unter Mitarbeit von Jochen Dietrich
al
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH vleweg
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet liber <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Prof. Dr.-Ing. E. h. Heinz Tschătsch, Bad Reichenhall, war lange Jahre in leitenden Stellungen der
Industrie als Betriebs-und Werkleiter und danach Professor fUr Werkzeugmaschinen und Ferti
gungstechnik an der FH Coburg und FH Konstanz.
Diese Auflage entstand unter Mitarbeit von Prof. Dr.-Ing. Prof. E.h. Jochen Dietrich, Dozent fUr
Fertigungs-und CNC-Technik an der Hochschule fUr Technik und Wirtschaft, Dresden.
Bis zur 3. Auflage erschien das Buch unter dem TiteI Handbuch spanende Formgebung im
Hoppenstădt Verlag, Darmstadt.
In der 4. Auflage erschien das Buch unter dem TiteI Praxiswissen Zerspantechnik im Vieweg
Verlag.
4., liberarbeitete Auflage 1997
5., liberarbeitete Auflage 1999
6., aktualisierte und erweiterte Auflage Oktober 2002
Alle Rechte vorbehalten
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2002
Urspriinglich erschienen bei Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, BraunschweiyWiesbaden, 2002
Softcover reprint ofthe hardcover 6th edition 2002
Der Vieweg Verlag ist ein Unternehmen der Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer.
www.vieweg.de
Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtIich geschlitzt.
Jede Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts
gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulăssig und strafbar. Das
gilt insbesondere flir Vervielfăltigungen, Ubersetzungen, Mikrover
filmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
UmschlaggestaItung: U1rike Weigel, www.CorporateDesignGroup.de
Gedruckt auf săurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.
Additional material to this book an be downloaded from http://extra.springer.com.
ISBN978-3-322-94281-4 ISBN 978-3-322-94280-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-94280-7
Vorwort
Die Zerspanungsverfahren bilden einen der Schwerpunkte in der industriellen Fertigungs
technik.
Bei dem gegenwartigen Entwicklungsstand der spangebenden Formung ist es jedoch nicht
m6glich in einem Buch, weil es den Umfang eines Buches sprengen wtirde, aile Verfahren
zu behandeln. Deshalb wird in diesem Buch auf die Verzahnungsverfahren verzichtet.
Nach einer gerafften Einftihrung in die Grundlagen der spangebenden Formung, werden
aIle Verfahren nach dem gleichen Prinzip geordnet und mit einem Minimum an Text darge
stellt.
Die Richtwerttabellen sollen erm6glichen, mit diesem Buch in Lehre und Praxis zu arbei
ten. Die zusammengestellten Richtwerte sind als Anhaltswerte, die eine erste Orientierung
erm6glichen sollen, zu betrachten. Genauere Werte erhlilt man von den Zerspanungswerk
zeugherstellern. Verbindlich sind nur diese Werte, weil sie auf die jeweiligen Erzeugnisse,
die verwendeten Werkzeugwerkstoffe, Schneidengeometrie und die speziellen Besonderhei
ten der Herstellerfirmen abgestimmt sind.
Als Leser sollen mit diesem Buch Studenten aller technischen Hochschulen und die Prakti
ker in der Industrie angesprochen werden.
Wegen seiner tibersichtlichen Darstellung ist es aber auch ftir Fachoberschulen und Berufs
schulen geeignet.
Ftir den Praktiker soIl es ein Nachschlagewerk sein, in dem er sich schnell informieren
kann.
Der Student hat in diesem Buch zugleich ein Vorlesungsskriptum, das ihm viel Schreibar
beit erspart und daftir ein aufmerksames Zuh6ren im H6rsaal erm6glicht.
In die Neuauflage dieses Buches wurden die neuen Werkstoffbezeichnungen nach Euro
Norm aufgenommen und als Anhang in das Buch eingefUgt.
Damit hat jeder Benutzer des Buches die Moglichkeit, die alte Bezeichnung nach DIN mit
den neuen Werkstoffbezeichnungen nach Euro-Norm zu vergleichen.
Es ist ihm freigestellt, ob er in seinem Wirkungsbereich die alten (noch gtiltigen), oder die
neuen Bezeicltnungen verwendet.
AuBerdem wurden
- die Hochgeschwindigkeitszerspanung HSC (high speed cutting) die in der industriellen
Fertigung immer mehr an Bedeutung gewinnt und und zwei typische Hochgeschwindig
keitsbearbeitungszentren
- moderne Kiihl-und Schmiermittel fur die Zerspanung
- und moderne Methoden der Kraftmessung und die dazugehOrigen MeBgerlite beim Dre-
hen und Bohren
zuslitzlich in das Buch aufgenommen.
Besonderen Dank fUr die Mitgestaltung der 6. Auflage als Co-Autor sage ich meinem Kol
legen, Prof. Dr.-Ing.; Prof. eh. lochen Dietrich, Dozent fUr Fertigungsverfahren und CNC
Technik, an der Hochschule fUr Technik und Wirtschaft (FH), Dresden.
Bad ReichenhalllDresden, Oktober 2002 Heinz Tschlitsch
Inhaltsverzeichnis
Begriffe, Formelzeichen und Einheiten .................................... XI
1. Einleitung ......................................................... .
1.1. Die Verfahren der spangebenden Formung .................................. 1
1.2. Kennzeichen der spanenden Formung ..................................... 1
1.3. Ausbildung der Schneiden ....................................... ~ . . . . . 2
1.4. Schnittbedingungen (Schnitttiefe a, Vorschubfund Schnittgeschwindigkeit v) ....... 2
1.5. Schnittkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.6. Spane ................................ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.7. Spanformen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.8. Werkzeugwerkstoffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Grundlagen der Zerspanung am Beispiel Drehen .......................... 4
2.1. Aachen, Schneiden und Ecken am Schneidkeil ............................. . 4
2.2. Bezugsebenen ...................................................... . 5
2.3. Winkel am Schneidkeil ............................................... . 6
2.4. EinfluB der Winkel auf den Zerspanvorgang ................................ 8
2.5. SpanungsgroBen ...................................................... 14
2.6. Zerspankrafte und ihre Entstehung ........................................ IS
2.7. Leistungsberechnung .................................................. 20
3. Standzeit ............................................................. 22
3.1. Definition .......................................................... 22
3.2. Merkmale flir die Abstumpfung .......................................... 22
3.3. Einfliisse auf die Standzeit .............................................. 24
3.4. Berechnung und Darstellung der Standzeit .................................. 25
3.5. GroBe der Standzeit und Zuordnung der Schnittgeschwindigkeit ................. 27
3.6. Kostengiinstigste Standzeit .............................................. 27
4. Werkzeug-und Maschinen-Gerade ....................................... 29
4.1. Werkzeug-Gerade ..................................................... 29
4.2. Maschinen-Gerade .................................................... 30
4.3. Optimaler Arbeitsbereich ............................................... 32
5. Spanvolumen und Spanraumzahl ........................................ 34
5.1. Spanvolumen ........................................................ 34
5.2. Spanformen ......................................................... 34
5.3. Spanraumzahlen ...................................................... 35
6. SchneidstotTe ........................................................ 36
6.1. Unlegierte Werkzeugstiihle .............................................. 36
6.2. Schnellarbeitsstiihle ................................................... 36
6.3. Hartrnetalle ......................................................... 38
6.4. Schneidkeramik 40
6.5. Schneiddiamanten ................................................... . 41
VIII Inhaltsverzeichnis
7. Drehen ............................................................. 44
7.1. Definition .......................................................... 44
7.2. Drehverfahren ....................................................... 44
7.3. Erreichbare Genauigkeiten beim Drehen ................................... 52
704. Spanne\emente ...................................................... 53
7.5. Kraft-und Leistungsberechnung .......................................... 61
7.6. Bestimmung der Hauptzeit .............................................. 62
7.7. Bestimmung der Zykluszeit ............................................. 65
7.8. Drehwerkzeuge ...................................................... 66
7.9. Fehler beim Drehen ................................................... 77
7.10. Richtwerttabellen ..................................................... 79
7.11. Berechnungsbeispiele .................................................. 87
8. Hobeln und Stonen .................................................... 90
8.1. Definition .......................................................... 90
8.2. Hobel-und StoBverfahren .............................................. 90
8.3. Anwendung der Verfahren ............................................. . 91
804. Erreichbare Genauigkeiten beim Hobeln .................................. . 92
8.5. Kraft-und Leistungsberechnung ......................................... . 92
8.6. Bestimmung der Hauptzeit ............................................. . 94
8.7. Richtwerttabelle ..................................................... . 97
8.8. Berechnungsbeispiel 97
9. Bohren ............................................................. 99
9.1. Definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99
9.2. Bohrverfahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99
9.3. Erzeugung und Aufgaben der Bohrungen .................................. 101
904. Erreichbare Genauigkeiten beim Bohren .................................. 103
9.5. Kraft-Drehmoment und Leistungsberechnung ............................... 103
9.6. Bestimmung der Hauptzeit ............................................ 109
9.7. Bohrwerkzeuge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 113
9.8. Fehler beim Bohren .................................................. 133
9.9. Richtwerttabellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 134
9.10. Berechnungsbeispiele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 138
10. Sagen 142
10.1. Definition ......................................................... . 142
10.2. Sageverfahren ..................................................... . 142
10.3. Aufgaben der Sageverfahren .......................................... . 143
lOA. Erreichbare Genauigkeiten beim Sagen .................................. . 144
10.5. Kraft-und Leistungsberechnung ........................................ . 144
10.6. Bestimmung der Hauptzeit ............................................ . 148
10.7. Sagewerkzeuge .................................................... . 150
10.8. Fehler beim Sagen .................................................. . 160
10.9. Richtwerttabellen ................................................... . 163
10.10. Berechnungsbeispiele ................................................ . 166
11. Frasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 169
11.1. Definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 169
11.2. Frasverfahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 169
Inhaltsverzeichnis IX
11.3. Anwendung der Frasverfahren ......................................... . 174
11.4. Erreichbare Genauigkeiten beim Frasverfahren ............................ . 175
11.5. Kraft-und Leistungsberechnung ........................................ . 175
11.6. Bestimmung der Hauptzeit ............................................ . 184
11.7. Fraswerkzeuge ..................................................... . 188
11.8. Fehler beim Frasen .................................................. . 210
11.9. Richtwerttabellen ................................................... . 212
11.10. Berechnungsbeispie1e ................................................ . 215
12. Raumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 220
12.1. Definition ......................................................... . 220
12.2. Raumverfahren ..................................................... . 220
12.3. Anwendung der Raumverfahren ........................................ . 220
12.4. Erreichbare Genauigkeiten beim Raumen ................................. . 222
12.5. Kraft-und Leistungsberechnung ........................................ . 223
12.6. Bestimmung der Hauptzeit ............................................ . 227
12.7. Raumwerkzeuge .................................................... . 229
12.8. Fehler beim Raumen ................................................ . 238
12.9. Richtwerttabellen ................................................... . 239
12.10. Berechnungsbeispiele ................................................ . 240
13. Schleife n ........................................................... 243
13.1. Definition ......................................................... . 243
13.2. Schleifverfahren .................................................... . 243
13.3. Anwendung der Schleifverfahren ....................................... . 256
13.4. Erreichbare Genauigkeiten beim Schleifen ................................ . 259
13.5. Kraft-und Leistungsberechnung ........................................ . 259
13.6. Bestimmung der Hauptzeit ............................................ . 264
13.7. Schleifwerkzeuge ................................................... . 268
13.8. Fehler beim Schleifen ............................................... . 280
13.9. Richtwerttabellen ................................................... . 282
13.10. Berechnungsbeispiele ................................................ . 287
14. Trennschleifen ...................................................... 292
15. Kontaktschleifen mit Schleitbandern ................................... 293
15.1. Anwendung des Kontaktschleifens mit Schleitbandem ........................ 294
16. Honen (Ziehschleifen) ................................................ 296
16.1. Anwendung des Honens ............................................... 302
16.2. Erreichbare Genauigkeiten und BearbeitungsaufmaBe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 302
17. Superf"mish (Kurzhubhonen) .......................................... 303
17.1. Anwendung des Superfinish ............................................ 303
18. Lappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 304
18.1. Anwendung des Llippens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 305
19. Weiterentwicklung der SchneidstotTe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 307
19.1. Schnellarbeitsstlihle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 307
19.2. Hartmetalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 307
19.3. Schneidkeramik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 312
X Inhaltsverzeichnis
19.4. Polykristalline Schneidstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 313
19.5. Kennzeichnung der (harten) Schneidstoffe ................................. 313
20. Hochgeschwindigkeitszerspanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 315
20.1. Definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 315
20.2. Einfiihrung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 315
20.3. Anwendung der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 317
21. Kiihl-und Schmiermittel ............................................. 339
21.1. Einfiihrung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 339
21.2. NaBbearbeitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 339
21.3. Minimalmengen-Kiihlschmierung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 340
21.4. Trockenschmierung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 342
22. Kraftmessung beim Zerspanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 343
20.1. Einfiihrung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 343
20.2. Kraftmessung beim Drehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 344
22.3. Kraftmessung beim Bohren und Friisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 345
22.4. Kraftmessung beim Riiumen ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 348
23. Allgemeine Tabellen ................................................. 350
24. Anhang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 365
24.1. Testfragen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 365
24.2. Gegeniiberstellung von alter Werkstoftbezeichnung nach DIN
und neuer nach Euro-Norm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 373
24.3. Firmenanschriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 382
25. Literaturverzeichnis 385
26. Sachwortverzeichnis 401