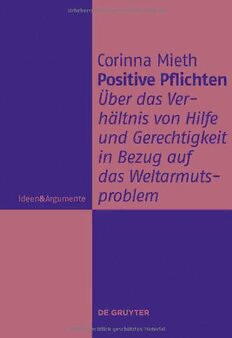Table Of ContentCorinnaMieth
PositivePflichten
Ideen & Argumente
Herausgegeben von
Wilfried Hinsch und Lutz Wingert
Corinna Mieth
fl
Positive P ichten
Über das Verhältnis von Hilfe und Gerechtigkeit in
Bezug auf das Weltarmutsproblem
isbn978-3-11-025564-5
e-isbn978-3-11-025565-2
LibraryofCongressCataloging-in-PublicationData
ACIPcatalogrecordforthisbookhasbeenappliedforattheLibraryofCongress.
BibliografischeInformationderDeutschenNationalbibliothek
DieDeutscheNationalbibliothekverzeichnetdiesePublikationinderDeutschen
Nationalbibliografie;detailliertebibliografischeDatensindimInternet
überhttp://dnb.d-nb.deabrufbar.
©2012WalterdeGruyterGmbH,Berlin/Boston
Satz:jürgenullrichtyposatz,Nördlingen
DruckundBindung:Hubert&Co.GmbH&Co.KG,Göttingen
♾Printedonacid-freepaper
PrintedinGermany
www.degruyter.com
Inhalt
Vorwort IX
Einleitung 1
DieSupererogationsthese 3
DiePrioritätsthese 4
ProblememitderAnalogiethese 5
ErsterTeil:DieWohltätigkeitsthese:
EinigeSchwierigkeitenmitpositivenPflichten 9
1 DieSupererogationsthese 11
1.1 Supererogation:DernegativeAspekt 11
1.2 DreiGruppenvonGegenbeispielen 15
1.3 Supererogation:DerpositiveAspekt 22
1.4 HandlungssupererogationundAkteurssupererogation 29
1.5 DiegütertheoretischeBestimmungderzwei
Supererogationsgrenzen 34
1.6 DieSamaritersituationalsModellfürHilfspflichten 47
1.7 FünfKriterienfürHilfspflichten 50
1.8 Erwartungssupererogationsgrenzenundobjektive
Supererogationsgrenzen 53
1.9 SupererogatorischeHandlungenundPflichten 56
1.10 FazitdeserstenKapitels 60
2 DiePrioritätsthese 62
2.1 ZunehmendeHeteronomiealsGrundfürdie
normativeSchwächeallgemeinerWohltätigkeitspflichten 62
2.2 KantischeTugendpflichtenalsAlternative
zurSupererogation 69
2.3 VollkommeneundunvollkommenePflichten
imKantischenModell 73
2.4 RechtspflichtenundTugendpflichten
imKantischenModell 81
2.5 ZurUnterscheidungvonNothilfeundallgemeiner
BeförderungfremderGlückseligkeit 89
2.6 VierUnterscheidungsmöglichkeitenvonpositivenund
negativenPflichten 95
2.6.1 DiehandlungstheoretischeUnterscheidung 95
VI Inhaltsverzeichnis
2.6.2 DiekonsequentialistischeUnterscheidung 99
2.6.3 DienormativeUnterscheidung 101
2.6.3.1 KannmandurchUnterlassenwohltun? 105
2.6.3.2 KannmandurchUnterlassenschädigen? 106
2.6.4 DiegütertheoretischeUnterscheidung 110
2.7 GerechtigkeitspflichtenundWohltätigkeitspflichten 113
2.7.1 DreiArtenvonpositivenPflichten 115
2.7.2 NothilfealspositiveGerechtigkeitspflicht? 120
2.8 EinwändegegeneinRechtaufNothilfe 128
2.8.1 DerEinwandderManifest-Rechte1:Unterbestimmtheit 130
2.8.2 DerEinwandderManifest-Rechte2:Überforderung 136
2.8.3 DerBedürftigkeitseinwand 141
2.9 FormulierungdesHilfsprinzips 148
2.9.1 DieAchtungvordemanderenalsmoralfähigemWesenals
GrundlagepositiverundnegativerPflichten 148
2.9.2 DasHilfsprinzip 151
2.10 FazitdeszweitenKapitels 157
ZweiterTeil:PositivePflichteninBezugaufdasWeltarmutsproblem 161
3 EinwändegegendieAnalogiethese 165
3.1 DerZuständigkeitseinwand 168
3.1.1 MitbürgerundFremde 174
3.1.2 NäheundDistanz 183
3.1.3 BestimmtheitundUnbestimmtheit 189
3.2 DieZurechenbarkeitderunterlassenenHilfeleistung 192
3.3 DerZumutbarkeitseinwand 195
3.4 DieZulässigkeitderHilfeleistung 205
3.4.1 NegativeEffektederHilfe 206
3.4.1.1 Demütigung 206
3.4.1.2 DieWohltätigkeitsgesellschaft 209
3.4.1.3 DieWohlfahrtsgesellschaft 210
3.4.2 EinwändegegendasRobin-Hood-Prinzip
(negativeRechteDritter) 211
3.5 ZurAussichtaufErfolg 219
3.5.1 DasVergeblichkeitsargument 219
3.5.2 IneffizienzderHilfe 220
3.6 DerEinwandderVerschiedenheitder
ArtderNotlage 222
3.6.1 VerschiedeneUrsachenderNotlagen 224
Inhaltsverzeichnis VII
3.6.2 Unvermeidbarkeitvs.Vermeidbarkeit 231
3.6.2.1 VermeidbarkeitundUnvermeidbarkeitbeimZustandekommen
derNotlage 233
3.6.2.2 VermeidbarkeitundUnvermeidbarkeitbeiderBehebung
derNotlage 234
3.7 VierHilfsmodelle:Fürsorge,Nothilfe,Wohltätigkeit,Solidarität 235
3.8 FazitdesdrittenKapitels 239
4 Schlussbemerkung 243
Literatur 247
Begriffsregister 257
Vorwort
Die Ideen zu diesem Buch haben sich in meiner Bonner Assistentenzeit bei
Christoph Horn seit 2001 herauskristallisiert. Ich hatte mich zuvor in Tübingen
mitglobalerGerechtigkeitauseinandergesetztundwolltezunächstdarüberarbei-
ten.MeineAusgangsfragewar,wieeinegerechteWeltwirtschaftsordnunginstitu-
tionellorganisiertwäreundwiesieimplementiertwerdenkönnte.DieAnschluss-
frage, ob es sozialen Menschenrechten entsprechende starke positive Pflichten
gibt,brachte mich aufdie Beschäftigung mitdem generellen normativenStatus
positiver Pflichten. Die Forschungsdiskussion, ob zwischen der Hilfspflicht ge-
genübereinemertrinkendenKindundgegenüberdenvonArmutBetroffeneneine
Analogie besteht, wurde schließlich zum Ausgangspunkt dieses Buches. Dabei
bin ich besonders Jacob Rosenthal, Nadine Köhne, Magda Hoffmann, Simon
WeberundSusanneSchmetkampsehrdankbarfürdiezahlreichenDiskussionen,
die meine Arbeit jahrelang begleitet haben. Die Idee, zwischen verschiedenen
ArtenvonpositivenPflichtenzuunterscheiden,habeicherstmalsaufdemKon-
gress der GAP in Bielefeld 2004 vorgestellt. Daran schloss die Idee an, positive
Pflichten,ihreStrukturundihrennormativenStatus,ihre„Stärke“oder„Schwä-
che“ zum zentralen Thema meiner Habilitationsschrift zu machen. Dazu, insbe-
sondere zu klassischen Konzeptionen von positiven Pflichten bei Aristoteles,
ThomasvonAquin,AdamSmith,HumeundKant,habeichLehrveranstaltungen
in Bonn, Hildesheim, Darmstadt, Zürich und Bochum abgehalten und meine
ThesenaufVortragsreisenundbeiWorkshopszurDiskussiongestellt.2006habe
ich in Oxford auf dem Kongress der Societas Ethica einen ersten Systematisie-
rungsversuch positiver und negativer Pflichten entwickelt. Ein Teil dieser Idee
findet sich in dem Aufsatz „World Poverty as a Problem of Justice? A Critical
Comparison of Three Approaches“, in Ethical Theory and Moral Practice 11/1
(2008),15–37.
Von2007bis2008hatteicheinResearch-FellowshipamForschungsinstitut
für Philosophie in Hannover. Unter idealen Arbeitsbedingungen habe ich dort
großeTeilediesesBuchesgeschrieben.IchdankeGerhardKruip,DetlefHorster,
Paul Hoyingen-Hüne und Kirsten Meyer, die mir in dieser Zeit verlässliche Ge-
sprächspartnerwaren.DabeigabesdieGelegenheit,meineForschungsergebnis-
seaufzweiinternationalenWorkshopszudiskutieren.ImAnschlussdaranhabe
ichinDarmstadtimRahmendesExzellenzclusters„normativeorders“eineFor-
schungsprofessur vertreten. Ich danke insbesondere Gabriel Wollner, Regina
Kreide und Peter Niesen für ihre Unterstützung in dieser Phase meiner Ent-
wicklung.ImFrühsommer2009hatteicheinCorti-FellowshipamEthik-Zentrum
der Universität Zürich. Dort konnte ich meine Thesen abermals zur Diskussion
stellen und das Manuskript anschließend an der Universität Bonn als Habilita-