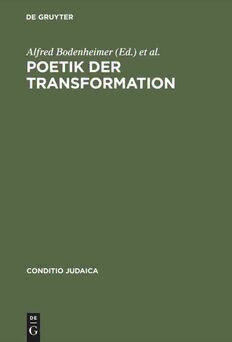Table Of ContentConditio Judaica 28
Studien und Quellen zur deutsch-jüdischen Literatur- und Kulturgeschichte
Herausgegeben von Hans Otto Horch
in Verbindung mit Alfred Bodenheimer, Mark H. Gelber und Jakob Hessing
Poetik der Transformation
« «
Faul Celan - Ubersetzer und übersetzt
Im Auftrag des Franz Rosenzweig-Forschungszentrums
für deutsch-jüdische Literatur und Kulturgeschichte
der Hebräischen Universität Jerusalem
herausgegeben von
Alfred Bodenheimer und Shimon Sandbank
Max Niemeyer Verlag
Tübingen 1999
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Poetik der Transformation : Paul Celan - Übersetzer und übersetzt / im Auftr. des Franz-
Rosenzweig-Forschungszentrums für Deutsch-Jüdische Literatur und Kulturgeschichte der
Hebräischen Universität Jerusalem hrsg. von Alfred Bodenheimer und Shimon Sandbank. -
Tübingen : Niemeyer, 1999
(Conditio Judaica ; 28)
ISBN 3-484-65128-8 ISSN 0941-5866
© Max Niemeyer Verlag GmbH, Tübingen 1999
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Libersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten
Einband: Industriebuchbinderei Hugo Nadele, Nehren
Inhalt
Vorwort 1
I. Celan als Übersetzer
Axel Gellhaus
Das Übersetzen und die Unübersetzbarkeit -
Notizen zu Paul Celan als Übersetzer 7
Jürgen Lütz
»Der Schmerz schläft bei den Worten«
Freigesetzte Worte, freigesetzte Zeit. Paul Celan als Übersetzer 21
Ute Harbusch
Etwas die Tropen Durchkreuzendes:
Paul Celans »Trunkenes Schiff« 55
John Felstiner
»Here we go round the prickly pear« or »Your song, what does
it know?«
Celan vis-à-vis Mallarmé 79
Stéphane Mosès
Guillaume Apollinaire: »L'Adieu« / Paul Celan: »Der Abschied« 87
Larissa Naiditch
Paul Celan als Übersetzer von Osip Mandel'ätams
»Bahnhofskonzert« 99
Timothy Bahti
Dickinson, Celan, and Some Translations of Inversion 117
Alfred Bodenheimer
Das Wiedererkennen des Unbekannten
Zu Paul Celans Übersetzung des Gedichts »Banechar«
von David Rokeah 129
VI Inhalt
II. Celan übersetzt
Martine Broda
Traduit du silence: les langues de Paul Celan 139
Shira Wolosky
On (Mis-)Translating Paul Celan 145
Pierre Joris
Celan/Heidegger: Translation at the Mountain of Death 155
José Luis Reina Palazon
Zur Übersetzung von Celans Todesfuge ins Spanische 167
Shimon Sandbank
Being and Indeterminancy: Celan in Hebrew 175
Personenregister 183
Vorwort
Seit den achtziger Jahren, als im Rahmen der fünfbändigen Werkausgabe Paul
Celans die letzten beiden Bände ausschließlich seinem übersetzerischen Werk
gewidmet wurden, spätestens aber seit Leonard Moore Olschners umfassender
Studie Der feste Buchstab über Celan als Übersetzer ist die Wichtigkeit dieses
Aspekts seines Schaffens für das Gesamtwerk des Dichters erkannt. Celans
Übersetzungen gelten als exemplarisch für das Nach- und Mitgestalten von
Dichtung im Prozeß der Übertragung in eine andere Sprache sowie in eine
andere Zeit und Erfahrungswelt.
War Celan ein vieler Sprachen mächtiger, aber selbst konstant in der deut-
schen Sprache schreibender Dichter und Übersetzer, so wurden auch seine
eigenen Gedichte (teilweise noch zu seinen Lebzeiten, vor allem aber seit
seinem Tod) in zahlreiche andere Sprachen übertragen. Paul Celan - Überset-
zer und übersetzt, diese kombinierte Betrachtung versprach einen Einblick in
seinen rezeptiven und produktiven Umgang mit Sprache, in die Aufgaben, die
er sich selbst gegenüber dem Werk anderer Dichter wie den Lesern seines
Werkes stellte. Im Juni 1996 veranstaltete das Franz Rosenzweig Forschungs-
zentrum für deutsch-jüdische Literatur und Kulturgeschichte an der Hebräi-
schen Universität in Jerusalem ein Kolloquium israelischer Literaturwissen-
schaftler und Übersetzer, in welchem diese zweifache Fragestellung zum Werk
Paul Celans behandelt wurde. Aus den Beiträgen und anschließenden Diskus-
sionen wurde ersichtlich, daß hier ein Thema aufgegriffen worden war, bei
dem noch viel zu erschließen blieb, für die Teilnehmer des Kolloquiums eben-
so wie für die Öffentlichkeit. Es wurde deshalb beschlossen, auch ausländische
Celan-Experten um Beiträge zu bitten und aus der Gesamtheit der Beiträge
einen Band zusammenzustellen. Erfreulicherweise war das Echo auf die An-
fragen sehr positiv, so daß die zur Veröffentlichung überarbeiteten fünf Kollo-
quiumsvorträge durch acht weitere Artikel aus den USA, Deutschland und
Frankreich ergänzt werden konnten.
Entstanden ist somit eine Sammlung, die mehr als nur oberflächlichen
Panorama-Charakter anstrebt, indem sie Celans übersetzerisches Werk und das
übersetzerische Arbeiten an Celan von vielen Seiten her ausleuchtet und die
Dialektik von Treue zur Vorgabe einerseits und eigenem Verstehen dieser
Vorgabe innerhalb der Texttreue andererseits an verschiedensten Beispielen
2 Vorwort
freilegt. Die Poetik der Transformation konstituiert sich gerade im Wissen um
das Eingebundensein und die Anlehnung alles Sprechens an kulturelle Vor-
und Kontexte, die Differenz zur anderen läßt erst ein Bewußtsein der eigenen,
der persönlichen Sprache wachsen.
Der vorliegende Band ist in drei Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt
soll Paul Celan als Übersetzer aus einer umfassenderen Perspektive visualisiert
und damit eine Annäherung an die Besonderheiten seines übersetzerischen
Werks geleistet werden. Axel Gellhaus verdeutlicht Celans Verständnis des
Übersetzens als eines »Fergendienstes«, also - einer Heideggerschen Metapher
gemäß - im Sinne des Übersetzens eines Fährmanns über einen Strom. Der
Beitrag von Jürgen Lütz entwickelt eine Poetologie der Übersetzung bei Paul
Celan aus der Büchner-Preisrede »Der Meridian« und der Beziehung zu Ossip
Mandelstamm, dessen Dichtung und Schicksal als Opfer eines totalitären Sy-
stems (wobei Celan zunächst die Nationalsozialisten für die möglichen Mörder
hält) einen der entscheidenden Anstösse zu intensiver Übersetzungsarbeit
bilden.
Der zweite Abschnitt enthält Einzelinterpretationen zu Übersetzungen Celans.
Seinen zahlreichen Übersetzungen französischer Dichter sind drei Artikel
gewidmet. Stéphane Mosès verweist bei Celans Übersetzung von Guillaume
Appolinaires Gedicht »L'Adieu« (»Der Abschied«) auf die Spannung zwischen
einer möglichst vollkommenen Treue zum Original und der gleichzeitigen
Schaffung eines neuen, in sich geschlossenen Gedichts, wie es etwa in Celans
Aktualisierung und Dramatisierung des Moments der Trennung gegenüber
Appolinaires eher auf die zukünftige Sehnsucht fokussiertem Schmerz zum
Ausdruck kommt. Ute Harbuschs Interpretation von Celans »Trunkenem
Schiff«, der Übersetzung von Arthur Rimbauds »Bateau ivre«, setzt sich mit
Celans Verständnis und Anwendung der Metapher Ende der fünfziger und
Anfang der sechziger Jahre auseinander, welche gegenüber der zuvor als »ab-
solut« bezeichneten Metaphorik Rimbauds eine Radikalisierung, ein finales
Kappen aller Rückübersetzbarkeiten der Figuren bedeutete. Celans einziger
Übersetzung eines eher kurzen Gedichts von Stéphane Mallarmé, mit dem er
in einer Besprechung der Todesfuge einst verglichen worden war, nimmt sich
John Felstiner an, wobei er über diese Übersetzung hinaus zur zentralen Ce-
lanschen Frage nach der Stummheit im Sprechen gelangt. Celans Übersetzun-
gen aus dem Russischen, Englischen und Hebräischen sind die drei weiteren
Einzelinterpretationen gewidmet. Larissa Naiditch analysiert die Übersetzung
von Ossip Mandelstamms »Bahnhofskonzert« und weist dabei vor allem auf
die semantischen Verschiebungen, die neuen an Wörter geknüpfte Assoziatio-
nen und ihnen anhaftende Konnotationen hin, welche durch die zeitliche und
vor allem zeitgeschichtliche Differenz zwischen der Entstehung des Gedichts
und der von Celans Übersetzung entstanden sind. Timothy Bahti zeigt anhand
der 1959 erschienenen Übersetzung von Emily Dickinsons Gedicht »Because I
could not stop for death«, daß Celan, der als »Dichter der Inversion« in seinen
Übersetzungen oft eine umgekehrte, sprachglättende und parallelisierende
Vorwort 3
Praxis verfolgt, gerade einem mit Parallelismen und Inversionen operierenden
Vorlage wie Dickinsons Text mit derselben Technik antwortet. Daß er Paralle-
lismen und Inversionen nicht linear der Vorlage nachbildet, sondern teilweise
gerade ihr entgegen benützt, macht die Autonomie der Übersetzung gegenüber
der Vorlage aus. Celans wenige Monate vor seinem Tod entstandene Überset-
zung eines hebräischen Gedichts von David Rokeah schließlich wird von Al-
fred Bodenheimer mit Bezug auf den Israel-Besuch vom Oktober 1969 und die
daraus erwachsenden ambivalenten, zwischen Begeisterung und Irritation sich
bewegenden Gefühle des Dichters gesehen.
Die Reflexion der Übersetzungsarbeit an Celan bildet die Grundlage des
dritten Abschnitts. Martine Brodas Beitrag (der einzige französische des Ban-
des) betont aus der Sicht jener Sprache, die in den letzten Jahrzehnten Celans
tägliche Umgangssprache war, die Implikationen, die der Gebrauch gerade der
deutschen Sprache als poetischer Sprache für seine Dichtung hatten: Die
Schaffung eines eigenen, Celanschen Idioms, das ins Französische zu übertra-
gen das Ziel der Übersetzerin sein muß. Shimon Sandbank exemplifiziert als
Übersetzer Celans ins Hebräische anhand ausgewählter Textstellen die unver-
meidbaren Unzulänglichkeiten jeder Sprache bei der Wiedergabe von Beson-
derheiten der anderen, insbesondere bei einem Autoren wie Celan, der gerne
mit sprachlichen Variationsmöglichkeiten und Ambiguitäten spielt. Shira Wo-
losky nähert sich demselben Problem in ihrer kommentierten englischen Über-
setzung von Celans Gedicht »Deine Augen im Arm«. Die Leitlinie ihrer Un-
tersuchung stellt das Benjaminsche Postulat dar, mit der Übersetzung ein
»Echo« des Originals zu liefern. In seiner (ebenfalls englischen) Übersetzung
des Gedichts »Todtnauberg« entwickelt Pierre Joris eine vor allem der Gada-
merschen Interpretation entgegengesetzte Deutung des Gedichts (die sich in
dessen Übersetzung durch Gadamers englischen Übersetzer spiegelt) und da-
mit von Celans Verarbeitung des Besuchs bei Martin Heidegger. Die kom-
mentierte spanische Übersetzung der »Todesfuge«, die José Luis Reina Pala-
zon vorlegt, verweist auf eine zusätzliche Problematik, die besonders das
Übersetzen von Lyrik betrifft: Wie nämlich läßt sich ein Gedicht überhaupt in
einer Sprache mit völlig anderer Syntax-, Reim- und Metrenstruktur wiederge-
ben?
Paul Celan ist ein eminent europäischer ebenso wie jüdischer Autor. Seine
Existenz in der Vielsprachigkeit wie seine Bedeutung für andere Sprach- und
Kulturgebiete, sein Einbringen jüdischer Denk- und Sprachtradition in die
deutsche Sprache wie die Auseinandersetzung in Israel mit einer auf deut-
schem Idiom beruhenden poetischen Reflexion jüdischen Schicksals, seine
innovative Sprachschöpfung, die das Deutsch der Nachkriegszeit ebenso mit-
gestaltet hat wie es Anderssprachigen neuen Umgang mit der deutschen Spra-
che abverlangte, dies alles kann wohl nur in der Auseinandersetzung mit sei-
nem übersetzerischen und übersetzten Werk gelingen.
Dieser Band verdankt sein Erscheinen der Initiative und Hilfe verschiedener
Personen, deren Namen hier genannt zu werden verdienen: Besonderer Dank
4 Vorwort
gilt den Damen llana Schmueli und Edith Obermann, Israel, die sowohl die
Tagung als auch den Druck dieses Bandes finanziert haben. Vom Franz Ro-
senzweig Forschungszentrum sei Stéphane Mosès genannt, der als GrUndungs-
direktor die vorausgehende Tagung kurz vor seiner Emeritierung initiierte und
organisierte, des weiteren sein Nachfolger Gabriel Motzkin, der das Publikati-
onsprojekt nach Kräften mitgefördert hat und die administrative Leiterin
Chantal Assuline, die das ganze Projekt hindurch immer wieder wertvolle
Ratschläge und Impulse gab, sowie Jens Mattem, der die Endredaktion und
Tamar Dreyfuss, die die damit verbundene Texterfassung und Korrekturarbeit
übernommen hat. Hans Otto Horch und sein Aachener Team haben die Vorbe-
reitung zum Druck speditiv und zuverlässig besorgt.
Luzern und Jerusalem, im Sommer 1998 Die Herausgeber