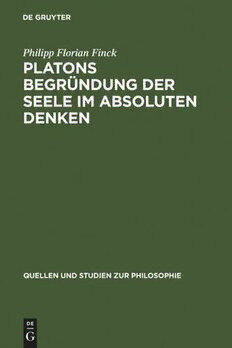Table Of ContentFlorian Finck
Platons Begründung der Seele im absoluten Denken
≥
Quellen und Studien
zur Philosophie
Herausgegeben von
Jens Halfwassen, Jürgen Mittelstraß,
Dominik Perler
Band 76
Walter de Gruyter · Berlin · New York
Platons Begründung der Seele
im absoluten Denken
von
Florian Finck
Walter de Gruyter · Berlin · New York
(cid:2)(cid:2) GedrucktaufsäurefreiemPapier,
dasdieUS-ANSI-NormüberHaltbarkeiterfüllt.
ISBN 978-3-11-019563-7
ISSN 0344-8142
BibliografischeInformationderDeutschenNationalbibliothek
DieDeutscheNationalbibliothekverzeichnetdiesePublikationinderDeutschen
Nationalbibliografie;detailliertebibliografischeDatensindimInternet
überhttp://dnb.d-nb.deabrufbar.
(cid:2)Copyright2007byWalterdeGruyterGmbH&Co.KG,D-10785Berlin
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro-
verfilmungenunddieEinspeicherungundVerarbeitunginelektronischenSystemen.
PrintedinGermany
Einbandgestaltung:ChristopherSchneider,Berlin
DruckundbuchbinderischeVerarbeitung:Hubert&Co.,Göttingen
Ursula Finck
Wolfgang Finck
Vorwort
Das vorliegende Buch wurde im Wintersemester 2005/06 unter dem Titel
Das absolute Denken als Prinzip des Menschen: Platons Konzeption der
”
Seele“ bei der Philosophischen Fakult¨at der Universit¨at Freiburg als Dis-
sertation eingereicht. Das Buch w¨are nicht entstanden ohne die vielfache
Unterstu¨tzung,dieichw¨ahrenddesSchreibenserfahrenhabe.MeinDank
giltallenTeilnehmerndesColloquiumPlatonicum anderUniversit¨atFrei-
burg. Viele der im Folgenden behandelten Themen haben wir im Laufe
der Zeit gemeinsam diskutiert. Mehrfach hatte ich Gelegenheit, Teile der
Arbeit indiesem Rahmen vorzustellen.Fu¨r dieHilfe bei den Korrekturen
danke ich Hannah Grosse-Wiesmann, Sandra Hesse, Katja Huber, Ulrich
Keiser, Edwin Johannes de Sterke und Ansgar Vaut. Natalia Pedrique
hat schwierige Textstellen mit mir diskutiert. Michael Spieker danke ich
fu¨r Zuspruch und Kritik – beides war eines guten Freundes wu¨rdig.
Fu¨rdieWissensvermittlunginnerhalbundaußerhalbcurricularerVer-
anstaltungen m¨ochte ich Bernhard Uhde und Bruno Haas danken. Hans-
Helmuth Gander und Bernhard Zimmermann danke ich fu¨r ihre gutach-
terlicheT¨atigkeit.MeinbesondererDankgiltFriedrichA.Uehlein.Unter
seiner Anleitung habe ich in langen Jahren enger Zusammenarbeit die
antike Philosophie und besonders Platon studiert. In seinem Unterricht
sind die antiken Texte lebendig geworden. Es w¨are mir eine große Freu-
de, wenn man diese Lebendigkeit auch in dem vorliegenden Buche noch
spu¨ren k¨onnte.
DerLandesgraduiertenf¨orderungdesLandesBaden-Wu¨rttembergdan-
keichfu¨rdiefinanzielleUnterstu¨tzung.Ju¨rgenMittelstraß,DominikPer-
ler und Jens Halfwassen gilt mein Dank fu¨r die Aufnahme des Buches in
die Reihe Quellen und Studien zur Philosophie“.
”
Mai 2007 Florian Finck
Inhaltsverzeichnis
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 Die Einfu¨hrung der Ideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1 Aporien der Nicht-Unterscheidung von Bestimmtheit und
Bestimmtem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 L¨osung der Aporien durch Unterscheidung von Bestimmt-
heit und Bestimmtem in der Zweiten Fahrt. . . . . . . . . 11
2 Die Charakterisierung der Ideen . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1 Sein als Bestimmt-Sein: Politeia 476e-477a . . . . . . . . . 32
2.2 Die Unver¨anderlichkeit der Ideen . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3 Die Denkbarkeit der Ideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3 Die Charakterisierung der Instanzen . . . . . . . . . . . . 47
3.1 Instanzen zwischen Sein und Nicht-Sein. . . . . . . . . . . 47
3.2 Das Werden der Instanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.3 Die Sch¨onheit der Instanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.4 Die Mitursache des Werdens . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4 Die Verflechtung der Ideen im Sophistes . . . . . . . . . . 67
4.1 Das Problem der vielfachen Benennung . . . . . . . . . . . 67
4.2 Die Dialektik als Wissenschaft von den Relationen der Be-
stimmtheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.3 Die Bedeutungsverschiebung der Schlu¨sselbegriffe . . . . . 75
4.4 Die Bestimmung der Bewegung“ . . . . . . . . . . . . . . 78
”
4.5 Die Funktion der gr¨oßten Gattungen . . . . . . . . . . . . 89
4.6 Die Bedeutung der Ideenverflechtung fu¨r die Instanzen . . 93
5 Die Abwehr von Missverst¨andnissen: Parmenides . . . . 99
5.1 Zum Status der Kritik an der Ideenlehre im Parmenides . 99
5.2 Sokrates’ Einfu¨hrung der Ideen im Parmenides . . . . . . 101
5.3 Parmenides 130b-130d: Wovon gibt es Ideen? . . . . . . . 104
5.4 Parmenides 130e-131e: Idee als Segeltuch“ . . . . . . . . 106
”
5.5 Parmenides 131e-132b: der Dritte Mensch“ (1) . . . . . . 111
”
5.6 Parmenides 132b-132c: Idee als Gedachtes“ . . . . . . . . 114
”
5.7 Parmenides 132c-133a: der Dritte Mensch“ (2) . . . . . . 117
”
x Inhaltsverzeichnis
5.8 Parmenides 133a-134e: die Trennung“ . . . . . . . . . . . 119
”
6 Die Erkenntnis der Ideen: Siebter Brief . . . . . . . . . . 123
6.1 Zur Echtheit des Briefes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.2 Zum Kontext des philosophischen Exkurses: Siebter Brief
341a-342a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
6.3 Die Erkenntnismittel: Siebter Brief 342a-342d . . . . . . . 137
6.4 Die Defizienz der Erkenntnismittel: Siebter Brief 342e-343d 144
6.5 Die philosophische Erkenntnis: Siebter Brief 343e-344b . . 157
7 Die Wiedererinnerungslehre im Phaidon: 72e-77a . . . . 169
7.1 Die Wiedererinnerung als Subsumtion: Phaidon 73c1-74a1 169
7.2 Das vorgeburtliche Ideenwissen: Phaidon 74a1-75d3 . . . . 174
7.3 Die Formen des Ideenwissens: Phaidon 75d3-77a5 . . . . . 181
8 Zum Zusammenhang zwischen Tugend und Wissen . . . 185
8.1 Wahrnehmen, Meinen und Wissen. . . . . . . . . . . . . . 186
8.2 Begehrendes, eifriges und denkendes Seelenverm¨ogen . . . 193
8.3 Die menschliche Tugend nach Politeia IV 427d-434c, 441c-
442d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
8.4 ExkurszurEinheitvonTheorieundPraxisimsokratischen
Dialog: Laches 187e-189a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
9 Zur Platonischen Angleichung an Gott . . . . . . . . . . . 243
9.1 Theaitetos 176af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
9.2 Symposion 207e-209e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
9.3 Phaidros 252d-253c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
9.4 Politeia 383c, 500cf., 613af. . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
9.5 Timaios 90b-d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
9.6 Nomoi 716c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
9.7 Zum Gottesbegriff der Angleichung an Gott“ . . . . . . . 262
”
10 Die Seele als Abbild eines absoluten Denkens . . . . . . . 265
10.1 Welches Problem soll die Annahme von Seele l¨osen?. . . . 265
10.2 Die Lehre der Atheisten: Nomoi 888d-892d . . . . . . . . . 269
10.3 Die Seele als Selbstbewegung: Nomoi 893b-896d . . . . . . 276
10.4 Die Seele als vernu¨nftige Selbstbewegung: Nomoi 896d-898d280
10.5 Das Denken der g¨ottlichen Vernunft. . . . . . . . . . . . . 284
10.6 Die Seele als Abbild der g¨ottlichen Vernunft . . . . . . . . 288
10.7 Die menschliche Seele als Abbild der g¨ottlichen Vernunft . 295
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305