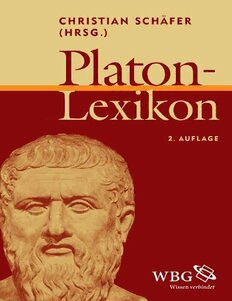Table Of ContentPlaton-Lexikon
Begriffswörterbuch zu Platon
und der platonischen Tradition
Herausgegeben von Christian Schäfer
2. Auflage
Impressum
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in
und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
2., durchgesehene und bibliografisch aktualisierte Auflage 2013
© 2013 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
Die Herausgabe des Werkes wurde durch
die Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht.
Einbandgestaltung: Peter Lohse, Heppenheim
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-darmstadt.de
ISBN 978-3-534-25795-9
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): 978-3-534-73593-8
eBook (epub): 978-3-534-73594-5
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor/Herausgeber
Impressum
Inhalt
Einleitung des Herausgebers
Autorinnen und Autoren
Abkürzungsverzeichnis (Werke Platons)
Alphabetisches Verzeichnis der Begriffe
Genannte Autoren der platonischen Tradition
Index
Begriffe
Artikel
Angeführte/zitierte Platonstellen
Bibliographie
Einleitung des Herausgebers
Platoni imputes, non mihi,
hanc rerum difficultatem;
nulla est autem sine
difficultate subtilitas …
(Seneca, Ep. 58)
„Ein Buch, das nicht durch sich und für sich selbst spricht, ist schlecht und
die beste Vorrede nützt ihm nichts; so könnte denn nach meinem Ermessen
allen Büchern, die bestimmt sind, von Anfang bis zum Schluß gelesen zu
werden, die Vorrede fehlen. Anders freilich steht es mit einem
Wörterbuch.“ – Mit dieser lapidaren Feststellung eröffnet Wilhelm Gemoll
sein mittlerweile in Ehren altgedientes Griechisches Wörterbuch. Für ein
Wörterbuch zu Platon gilt das Gesagte in besonderer Weise, denn Platon
ist ein gesucht unterminologisch schreibender Autor. Von den vielen
Kolleginnen und Kollegen der verschiedensten Fachrichtungen, die zur
Mitarbeit an diesem Lexikon eingeladen waren, hat daher ein stattliches
Kontingent nicht zusagen wollen. Denn wer Platon wirklich schätzt, der ist
ganz dem Zusammenhang und der inneren Entwicklung der Dialogtexte
und der auch inhaltlich vielsagenden Stimmungen, die sie kreieren,
ergeben, der scheut sich, Platon in Begriffe zu zerlegen und ihn sprachlich
auf etwas „festzunageln“, und das mit gutem Grund. Diesen guten Grund zu
erläutern und gleichzeitig eine sinnvolle Apologie dafür zu liefern, dass hier
dennoch und gegen alle Unwahrscheinlichkeiten ein Lexikon zu Platon
vorzulegen gewagt wird, bedarf es einer Bevorwortung, die über den
Rahmen und die Form einer intellektuellen Biographie des behandelten
Autors, einer Sondierung des status quaestionis der Forschung und einige
Handhaberegeln ein wenig hinausgreift. Denn ein Autor, der nicht aus sich
selbst und für sich selbst spricht, taugt nichts, und auch die beste
Einleitung in ein Wörterbuch zu seinen Schriften wird daran nichts ändern.
Anders freilich steht es mit Platon.
1. Platons Leben: „Platon aus Athen war der Sohn des Ariston und der
Periktione oder Potone, die ihr Geschlecht auf Solon zurückführte. Des
Solon Bruder nämlich war Dropides; dessen Sohn war Kritias, dessen Sohn
Kallaischros, dessen Sohn Kritias, das Haupt der Dreißig, und Glaukon.
Des letzteren Kinder waren Charmides und Periktione, von der Platon
stammte aus ihrer Ehe mit Ariston, als sechster von Solon abwärts. Solon
aber führte sein Geschlecht auf Neleus und Poseidon zurück. Auch Platons
Vater soll sein Geschlecht auf Kodros, des Melanthos Sohn, zurückgeführt
haben, die nach Thrasyllos gleichfalls als Nachkommen des Poseidon
gelten.“ Mit diesen Worten leitet Diogenes Laertios (3, 1) seine
Lebensbeschreibung Platons ein. Dieser wurde also in eine der
angesehensten Familien Athens hineingeboren. Seine Eltern gründeten
ihre Ahnenreihe einerseits auf Solon, den großen Gesetzgeber der Stadt,
und andererseits durch Kodros auf deren halbmythisches Königsgeschlecht
(und damit schließlich auf göttlichen Samen). Viele von Platons näheren
Verwandten spielten eine führende Rolle in den Leitungsangelegenheiten
der Polis, Kritias als Vertreter der „Herrschaft der Dreißig“ (404/03
v. Chr.) wird von Diogenes Laertios eigens erwähnt. Dagegen scheinen
weder das Jahr noch der Ort von Platons Geburt noch eindeutig zu
ermitteln zu sein: Die konstruktionsfreudigen Testimonien der Alten und
ihre modernen Ausdeuter schwanken in ihren Angaben zwischen Athen und
Ägina sowie den Jahren zwischen 430/29 und 423 v. Chr. Platons
Geburtsname soll gemäß allerdings oft angezweifelter Überlieferung
Aristokles, nach seinem Großvater, gewesen sein, den „Spitznamen“
Platôn, „der Breite“, habe er später erhalten, sei es der Breite seines
Körperbaus, seines Stils oder seiner Gedanken wegen.
Anders als ihr Autor selbst, tauchen Mitglieder seiner Familie in den
Platonischen Dialogen häufig als mitunter titelgebende Protagonisten auf,
sein Onkel Charmides etwa, oder sein Halbbruder Antiphon als Erzähler
im Parmenides, Kritias im Charmides und Protagoras, seine älteren
Brüder Glaukon und Adeimantos im Parmenides und in der Politeia,
daneben außerdem Persönlichkeiten des öffentlichen und intellektuellen
Lebens Griechenlands: der Komödienschreiber Aristophanes, die Sophisten
Protagoras, Thrasymachos und Gorgias, die maßlosen politischen
Wunderknaben Phaidros und Alkibiades, Pythagoreer und Eleaten als
Repräsentanten bedeutender auswärtiger Philosophenschulen – all das legt
Zeugnis ab von Platons familiärer und pädagogischer Beheimatung in den
„besten Kreisen“, die vielleicht allerdings auch damals gleichzeitig die
verkommensten gewesen sein mochten. Bald jedoch stand Platon im Bann
eines anderen Kreises, nämlich dessen um Sokrates, dem Platon um die
zehn Jahre lang angehört haben mag. Aus einer versprengten Notiz bei
Xenophon (Memorabilia 3, 6,1), der anderweitig kein großer Freund
Platons war, ist zu ersehen, dass Sokrates den Platon äußerst geschätzt
haben soll. Sokrates ist auch die Hauptfigur fast aller Dialoge Platons, in
denen bezeichnenderweise sein eigener Name nur in der von ihm
nachverfassten Verteidigungsrede des Sokrates (Apologie 34a) und ganz
am Rande in der Erzählung vom Todestag des Sokrates im Phaidon
auftaucht. Vielleicht auch das nicht von ungefähr: Der herkömmlichen
Doxographie zufolge markiert der Prozess und das Todesurteil gegen
Sokrates durch die athenische Bürgerschaft den richtungsändernden
Einschnitt in Platons Leben. Mag sein, dass schon der Phaidon diese
populäre Sicht der Dinge vorbereitet hat: Am Todestag des Sokrates findet
man weder Glaukon noch Adeimantos noch sonst ein Familienmitglied
Platons bei seinem alten Lehr- und Lebemeister. Platons eigene rätselhafte
Aussage, er selbst sei, so wurde angenommen, damals krank gewesen
(Phaidon 59b), mag eine fiebrige Krise zwischen familiärem
Loyalitätsdruck und innerer Überzeugung, zwischen politischer Räson und
geschuldetem Freundschaftsdienst andeuten, die erst in der Nachfolge
eine dann allerdings gänzliche Parteinahme für die Sache und die Person
des Sokrates zeitigte. Der Virus des Sokrates hatte indes schon früher
Wirkung gezeigt: Traut man unbehelligt von allen Echtheitsfragen mit den
antiken Gewährsmännern der autobiographischen Passage von Platons
„Siebtem Brief“ (Ep 7, 324b–326b), so hätte Platon gemäß den eingangs
geschilderten Vorzügen seines Elternhauses eine politische Karriere
ergreifen können und auch wollen, sobald er mit dem dafür nötigen Alter
„sein eigener Herr geworden wäre“. Es kam aber ganz anders. Vom
politischen Treiben Athens wandte er sich mit Abscheu weg, die
ungerechte Hinrichtung des Sokrates besiegelte Platons „Absage an die
Welt“ (so Wilamowitz-Moellendorff) und ließ ihn seine Zuflucht in der
Philosophie finden, „die allein erkennen lässt, was im Staatswesen wie
auch im Leben jedes Einzelnen gerecht ist“. So will es die Rückschau des
alten Platon in dem unter seinem Namen überlieferten
Rechtfertigungsbrief (Ep 7, 326a) und so wollte es dann auch die Tradition
sehen: Erst die Philosophie ließ Platon aus der Krise hervortretend
wirklich und im tieferen Sinn „sein eigener Herr werden“, und erst das
sollte es dann ermöglichen, dass er später übrigens doch noch zu aktiver
Teilnahme an öffentlichen Geschäften zurückfand (was vielleicht ein wenig
allzu auffällig an den idealen Werdegang des Philosophenherrschers in der
Politeia erinnert).
Letzteres ist mit seiner ersten Sizilienreise bezeugt, die er antrat, als er
„ungefähr vierzig Jahre“ zählte (Ep 7, 324a). Zwischen diesem Alter und
dem Tod des Sokrates 399 war ein gutes Dutzend Jahre vergangen, Platons
„dark years“, und wie die meisten sogenannten dunklen Jahre offenbar von
ernster Vorbereitung, tiefer innerer Verarbeitung und äußerer
Erarbeitung großer Gedanken geprägt. Er soll in dieser fraglichen Zeit
ausgedehnte Reisen unternommen haben, nach Kyrene und Tarent,
angeblich auch nach Ägypten, von Kontakten mit den herausragenden
Köpfen der Epoche ist in der Überlieferungsfolklore die Rede, außerdem
von längeren Aufenthalten in Megara und Unteritalien. (Das alles mag man
cum grano salis nehmen, denn die geographischen Angaben scheinen doch
stark den philosophischen Interessensthemen von Platons Dialogen
angeformt: Kyrene mit Theodoros der Mathematik, Megara mit der
dortigen Philosophenschule der Logik, Syrakus der Politik und Ägypten der
Weisheit alter Mythen.) Vor allem aber muss Platon während dieser Jahre
als Philosoph aufgetreten und als solcher auch bekannt geworden sein (die
Philologen weisen seine „Frühdialoge“ dieser Zeitspanne zu), sonst wäre
das Folgende nicht so recht erklärlich.
Auf seiner Sizilienreise nämlich wurde er mit Dion, dem Schwager des
Tyrannen Dionysius I. von Syrakus, bekannt und fand dort somit Einlass in
politisch maßgebliche Kreise; nach anderen Quellen hatte Dionysius selbst
Platon als bekannten Philosophen an seinen Hof eingeladen. Dieser mochte
berechtigte Hoffnungen gehegt haben, was seine Rolle und
Einflussmöglichkeiten betraf: Es gibt historische Zeugnisse davon, dass,
anders als im Mutterland, in den griechischen Pflanzstädten (nicht nur) des
Westens Philosophen erfolgreich und mit allgemeiner Zustimmung an die
Grundfesten der politischen Konstitution Hand anlegen konnten. Platons
Einschätzungen führten allerdings schon bald zu einem tiefen Zerwürfnis
mit Dionysius, das sich in der Erzählung widerspiegelt, der Tyrann habe
den athenischen Philosophen festnehmen und als Sklaven verkaufen lassen,
so dass er schließlich von Freunden auf dem Markt von Ägina ausgelöst
werden musste – all das würde geradezu symbolisch zu dem passen, was
oben über den Zusammenhang von politischer Betätigung und „sein
eigener Herr sein“ erzählt wurde.
„Nach seiner Rückkehr nach Athen wählte er zu seiner Wohn- und
Lehrstätte die ‚Akademie‘, ein baumreiches Gymnasium vor der Stadt, das
seinen Namen von einem Heros namens Hekademos hat“, so wieder
Diogenes Laertios (3, 7). In die ungemein erfolgreiche Lehr- und
Schreibtätigkeit der anschließenden Zeit hinein ereilte ihn wiederum der
Ruf aus Syrakus, wo inzwischen Dion unter Dionysius II. weiter politisch
aufgestiegen war. Trotz anfänglicher Bedenken, die bald herbe
Bestätigung finden sollten, beschloss Platon, auf sein Glück zu trotzen und
schiffte nochmals, ja später noch zu einem dritten Versuch nach Sizilien
ein, indem er für die Dauer seiner Abwesenheit die Führung seiner Schule
dem Knidier Eudoxos überließ, bezeichnenderweise einem Mathematiker
also (zur Zeit von dessen Interimsleitung soll Aristoteles der Akademie als
Schüler beigetreten sein). Platon scheiterte abermals und auch mit seiner
noch weit bedenklicheren dritten Syrakusreise. Die in ihrer Art so
interessante Autobiographie des Briefwerks (Ep 7, 324b; 352a) steht im
Dienste der Erklärung von Platons Rolle in den Angelegenheiten von
Syrakus, einer Erklärung, der sich die antiken Lebensbeschreibungen
anschließen und damit auch deren charakteristisches an spätere
Generationen weitergegebenes Bild vorzeichnen. Es ist dies ein Bild, das
aus diesem Grund vordringlich den äußeren Lebensverlauf bietet und den
politisch aktiven Platon in den Vordergrund stellt. Die inneren
Entwicklungen, so sie denn für eine Philosophenbiographie und wohl
anders als die äußeren wirklich von Aussagekraft sind, liegen andererseits
ziemlich im Dunkeln und es bleibt vielleicht letztlich der Datierung und
Deutung der Dialoge überlassen, ob sie Auskunft darüber zu geben
imstande sind. Dazu gleich mehr.
Platon soll „im dreizehnten Jahr der Königsherrschaft des Philipp von
Makedonien“ gestorben sein, oder nur unwesentlich später (und zwar
angeblich an seinem Geburtstag und bei einem Hochzeitsgelage, nach
anderen mitten im Schreiben). „Bestattet wurde er in der Akademie, wo er
die meiste Zeit mit philosophischer Arbeit zubrachte. Daher wurde seine
Schulrichtung auch die akademische genannt, wie denn auch die gesamte
Bevölkerung dieses (athenischen) Bezirks ihm das Grabgeleit gab“
(Diogenes Laertios 3, 40–41). Die Akademie selbst hatte – wenn auch mit
tiefgreifenden doktrinalen Umschwüngen und Richtungswechseln – nach
Platons Tod noch Jahrhunderte Bestand, ja die „Platonische Schule“ in
Athen wurde erst 529 n. Chr. vom Oströmischen Kaiser Justinian
geschlossen. Bis dahin wurde dort Jahr für Jahr Platons Gedenktag kultisch
begangen. Spätestens seit Poseidonios im frühen ersten Jahrhundert v. Chr.
sprechen die Doxographen vom theios Platôn, dem „göttlichen Platon“,
oder, wie Cicero, vom divus auctor Plato.
2. Platons Schriften: Was aber lässt Platon als Autor so „göttlich“
erscheinen? Eine antike Anekdote erzählt, man habe nach Platons Tod
unter seinen Notizen eine Anzahl verschiedener Variationen der
Anfangspassage der Politeia aufgefunden. Das mutet eigentümlich an, denn
nichts philosophisch Tiefschürfendes scheint diesem Beginn innezuwohnen,
und die Version, auf die Platon schließlich die Wahl fallen ließ, lautet:
„(Sokrates:) Gestern stieg ich mit Glaukon, dem Sohn des Ariston, zum
Piräus hinab, um die Göttin anzubeten und weil ich mir zugleich anschauen
wollte, auf welche Weise man denn dort das Fest feiern würde, weil es da
nämlich gerade zum ersten Mal gefeiert wurde, und der Festzug der
Einheimischen schien mir auch sehr schön zu sein, gewiss jedoch scheint
der, den die Thraker veranstalten, nicht weniger glanzvoll – nachdem wir
also gebetet und uns umgeschaut hatten, gingen wir wieder zur Stadt
hinauf“ (327a). Platon hat mit Bedacht größten Wert auf die äußere
Gestalt seiner philosophischen Schriften gelegt, und diese von den
Doxographen keineswegs zufällig weitergegebene Episode spiegelt das
wider: Der Anfangssatz der Politeia ist eine Vorwegnahme der gesamten