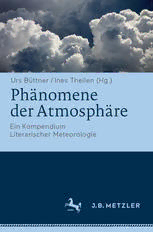Table Of ContentUrs Büttner / Ines Theilen (Hg.)
Phänomene
der Atmosphäre
Ein Kompendium
Literarischer Meteorologie
Urs Büttner / Ines Theilen (Hg.)
Phänomene der Atmosphäre
Ein Kompendium Literarischer Meteorologie
Mit 19 Abbildungen
J. B. Metzler Verlag
Gedruckt mit Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung
Die Herausgeber
Urs Büttner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Peter Szondi-Institut für Allgemeine und
Vergleichende Literaturwissenschaft der Freien Universität Berlin (DFG-Projekt »Literarische
Meteorologie«).
Ines Theilen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Seminar der Universität
Hannover (DFG-Projekt »Die Poïesis der Atmosphäre um 1800«).
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-476-04491-4
ISBN 978-3-476-04492-1 (eBook)
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
J.B. Metzler ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer-Verlag GmbH Deutschland
www.metzlerverlag.de
[email protected]
Einbandgestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart (Foto: iStock, Skyhobo)
Satz: Dörlemann Satz, Lemförde
J. B. Metzler, Stuttgart
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, 2017
Inhalt
Phänomene der Atmosphäre. Zur Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I Wissensformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Paul Dobryden
1 Architektur: Paul Scheerbarts künstliche Atmosphären . . . . . . . . . . . . . . . 29
Isabell Schrickel
2 Simulation und Vorhersage: Zur Adaption epistemischer Verfahren
der Meteorologie in Alexander Kluges Vierzehn Arten, den Regen zu
beschreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Anders Engberg-Pedersen
3 Krieg und Militär: Kriegsatmosphären. Stendhals La Chartreuse de
Parme im Kontext von Clausewitz’ Kriegstheorie und Minards
thematischer Karthographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Solvejg Nitzke
4 Magie und Technik: Die Produktion und Manipulation der
Atmosphäre bei Stanisław Lem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Christiane Heibach
5 Medien: Toxische Atmosphären in Roman Ehrlichs Das kalte Jahr . . . . . 83
Burkhard Meyer-Sickendiek
6 Phänomenologie: »Nachts war Regen«. Friederike Mayröckers
Hermetisierung des Atmosphärischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Simone Schröder
7 Politik: Die neuen Ufer der Themse – J. G. Ballards The Drowned World
als Climate Fiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Sylvia Brockstieger
8 Theologie: Heilloser Himmel? Albrecht von Hallers Unvollkommnes
Gedicht über die Ewigkeit (ca. 1736) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
VI Inhalt
II Phänomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
A Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Olaf Briese
9 Blitze: Klopstocks Ode Die Frühlingsfeyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Magdalena Gronau
10 Fata Morgana: Phantasmen der Wissenschaft bei Friedrich de la Motte
Fouqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Michael Neumann
11 Firmament: Autorisierungsmuster und Wahrnehmungsdirektiven in
Jacob Böhmes Morgen-Roͤte im Aufgangk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Norman Kasper
12 Himmelsfarben: Tiecks bunte Himmel im Kontext
naturwissenschaftlicher, ästhetischer und metaphysischer Diskurse . . . . 166
Timothy Attanucci
13 Kometen: Einmal ist keinmal – Ernst Jüngers Kometenlogik . . . . . . . . . . 177
Stephan Gregory
14 Leuchtende Luft: Mimesis des Atmosphärischen bei Aretino
und Tizian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Jakob Christoph Heller
15 Mond: Neumond, Vollmond, Mondphasen – Selenographie als
politische Reflexion bei Jean Paul (und zuvor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Dörte Linke
16 Nacht: Überlegungen zu Cora Sandels Alberte-Trilogie . . . . . . . . . . . . . . . 210
Marie-Theres Federhofer
17 Nordlicht: Tellurische Deutung und ästhetische Darstellung bei
Alexander von Humboldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Sergej Rickenbacher
18 Regenbogen: Zur Poetisierung und Ökonomisierung eines Streits um
Wissen bei Gottfried Keller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Claudia Olk
19 Sonnenfinsternis: Virginia Woolf und die Sonnenfinsternis von 1927 . . 247
Michael Bies
20 Sonnenuntergang: Der Anfang des Romans und das Verschwinden
des Menschen bei Claude Lévi-Strauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Ines Theilen
21 Zwielicht: Joseph von Eichendorffs Gedicht im Widerschein
ästhetischer und naturwissenschaftlicher Diskurse um 1800 . . . . . . . . . . 270
Inhalt VII
B Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Karin Becker
22 Nebel: Ästhetik des Unbestimmten im Werk Guy de Maupassants ..... 281
Oliver Grill
23 Regen: Wetterzauberei, Meteorologie und Ökonomie in
Theodor Storms Märchen von der Regentrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Urs Büttner
24 Schnee: Eine ästhetische Expedition – Alfred Anderschs Reise an die
Packeisgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Claus-Michael Schlesinger
25 Wolken: Zur Funktion und Geschichte diagrammatischer Darstellung
in einer meteorologischen Skizze Goethes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
C Luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Hania Siebenpfeiffer
26 Äther: Kosmische Atmosphäre – Francis Godwins The Man in the
Moone or a Discourse of a Voyage thither (1638) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Michael Auer
27 Donner: Nachhallzeit – (post-)souveräne Temporalität bei Malherbe . . 339
Alexander Košenina
28 Dunst: Seume und seine Zeitgenossen im vulkanischen Qualm,
Rauch und Ruß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Georg Braungart
29 Luftdruck: »Ein großer Seufzer die Natur« – Die Poetik des
Atmosphärischen bei Annette von Droste-Hülshoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Evi Zemanek
30 Ozon: Das Ozon als Pharmakon in Fontanes literarischen,
epistolarischen und autobiographischen Werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Christoph Weber
31 Sturm: Barthold Heinrich Brockes’ Gedicht »Die auf ein starckes
Ungewitter erfolgte Stille« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Margareta Ingrid Christian
32 Wind: Turbulenzen der Zeit – Klimatographie in Robert Musils
Der Mann ohne Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
D Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Hanna Hamel
33 Gemäßigte Temperatur: J. G. Herders Klimatologie der Mitte ......... 421
VIII Inhalt
Achim Küpper
34 Hitze: Johann Peter Hebels Kalendergeschichten im Kontext der Wissens-
und Literaturgeschichte eines atmosphärischen Phänomens von der
Antike bis zur Gegenwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Phänomene der Atmosphäre. Zur Einleitung
In Johann Wolfgang Goethes 1822 in der Zeitschrift Zur Naturwissenschaft über-
haupt veröffentlichtem Gedicht Atmosphäre beklagt ein nicht näher bestimmtes Du
die Unübersichtlichkeit seiner Erkenntnislage:
Die Welt, sie ist so groß und breit,
Der Himmel auch so her und weit;
Ich muß das Alles mit Augen fassen,
Will sich aber nicht recht denken lassen.1
Tatsächlich beschreiben Goethes Verse jedoch nicht nur eine individuelle Erkennt-
niskrise, sondern ein grundsätzliches Problem der sinnlichen Wahrnehmung von
Atmosphäre: ihre schiere Größe und Unübersichtlichkeit. Timothy Morton hat
solche überdimensionierten und komplexen Objekte daher jüngst als Hyperobjects
bezeichnet.2 Die Atmosphäre umgibt den Menschen und wirkt in vielfältiger Weise
physiologisch auf den menschlichen Körper und die Messgeräte ein, so dass die In-
stanz, welche sie beobachten soll, immer schon nachhaltig durch sie affiziert ist. Es
ist daher kaum möglich, Distanz zu schaffen, um die Atmosphäre in Gänze in den
Blick zu bekommen. Zwar verfügt jeder und jede Interessierte lokal begrenzt über
konkrete Anschauungen von einzelnen atmosphärischen Phänomenen, doch bleibt
die Vorstellung, dass all diese Phänomene in einem Zusammenhang stehen, abstrakt
und überkomplex. Diverse Naturerscheinungen stehen innerhalb der Atmosphäre in
Wechselwirkung zueinander oder durchdringen einander. Auch wandeln sich viele
Phänomene sehr rasch, sind flüchtig oder verändern sich in kaum wahrnehmbarer
Weise. Hinzu kommt noch, dass sich eine Reihe von atmosphärischen Prozessen
ganz oder teilweise außerhalb des sinnlich wahrnehmbaren Bereichs abspielt. Selbst
meteorologische Modelle müssen sich aufgrund dieser Komplexität in ihrer Dar-
stellung der Atmosphäre starker Vereinfachungen bedienen.
Goethes lyrisches Ich rät dem klagenden Du angesichts der genannten Erkennt-
nisprobleme: »Dich im Unendlichen zu finden, / mußt unterscheiden und dann ver-
binden.«3 Dieser Ratschlag ist in der Goetheforschung als Vorschlag zur ›Arbeits-
teilung‹ zwischen der analysierenden Wissenschaft und der in Goethes Verständnis
1 Johann Wolfgang von Goethe: Atmosphäre, in: ders.: Sämtliche Werke nach Epochen sei-
nes Schaffens. Münchner Ausgabe, hrsg. von Karl Richter u. a., München 2006, Bd. 12, o. S.
[611]. – Der Titel wurde erst in der Ausgabe letzter Hand hinzugefügt.
2 Timothy Morton: Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World, Min-
neapolis, London 2013.
3 Goethe (Anm. 1).
2 Phänomene der Atmosphäre
synthetisierenden Dichtung gelesen worden.4 Goethe macht mit seinem Gedicht den
Vorschlag, zwei bereits in der Zeit um 1800 getrennt wahrgenommene Bereiche als
sich ergänzende Modi der Weltaneignung zu verstehen. Dabei geht es keineswegs
darum, den einen Bereich in den anderen zu überführen, denn ihr produktiver
Dialog ergibt sich erst aus dem Bewusstsein der Eigengesetzlichkeit beider Seiten.5
Schon bald nach Goethe geht der Glauben an die Möglichkeit einer solchen ergän-
zenden Zusammenschau von Kunst und Wissenschaft jedoch verloren. Die Vor-
stellung eines von beiden Wissensdomänen geteilten Naturbildes wird obsolet. Die
Gründe dafür liegen in Bestrebungen zur Objektivierung des Naturwissens in einer
Reihe von Wissensfeldern und komplementär in der Kultivierung von Subjektivität
oder eines anderen Erkenntnisideals in der Literatur, die mit der Zeit ihr Eigenrecht
immer vehementer einklagen. Beide Wissensdomänen entwickeln sich eigenständig.
Daraus resultiert eine Spaltung und in der Folge eine Verdoppelung des Konzepts
der ›Atmosphäre‹. Um zu zeigen, mit welchen Mitteln diese Trennung vollzogen und
aufrechterhalten wurde und wird, muss man sich zunächst hypothetisch auf den
Standpunkt des ›Unendlichen‹ stellen, den der Atmosphäre.6
Zwei ›Atmosphären‹? Wissenschaft vs. Ästhetik Einleitung
›Atmosphären‹ kennt die deutsche Sprache erst seit dem späten 17. Jahrhundert. Der
Ausdruck bezeichnete dabei in physikalisch-astronomischen Kontexten die Gas-
hülle oder den Dunst (gr. atmós), der eine Planetenkugel (gr. sphaīra) wie etwa die
Erde einhüllt. Spätestens Mitte des 18. Jahrhunderts lassen sich auch Begriffsverwen-
dungen nachweisen, die sich auf den ›Dunstkreis‹, der einen Ort oder eine Person
umgibt, beziehen. ›Atmosphäre‹ konnte ganz wörtlich im Sinne von Atem oder Duft
gebraucht werden, aber auch weiter gefasst als Bezeichnung einer Stimmung oder
Aura und auf abstrakterer Ebene als Lebenskreis mit einem bestimmten geistigen
oder sozialen Klima. Daraus leiten sich Verwendungsweisen ab, die zum einen von
der Landschaftsästhetik ausgehend ästhetische Wirkungsweisen überhaupt kenn-
zeichnen, zum anderen das Zwischenmenschliche als Atmosphäre charakterisieren.7
Im heutigen Sprachgebrauch konstatiert der Anthropologe Tim Ingold eine Spaltung
und daraus resultierende Verdopplung des Atmosphärenbegriffs:
4 Vgl. Christian Begemann: Wolken. Sprache. Goethe, Howard, die Wissenschaft und die
Poesie, in: Gerhard Neumann, David E. Wellbery (Hrsg.): Die Gabe des Gedichts. Goethes
Lyrik im Wechsel der Töne, Freiburg, Wien, Berlin 2008, 225–242, hier: 234. Begemann
sieht den Vorschlag zur Arbeitsteilung zwischen Kunst und Wissenschaft in Atmosphäre in
der Forderung, dass die von der Wissenschaft getroffenen Unterscheidungen von der Kunst
ergänzt und gewissermaßen wieder lebendig gemacht werden müssten.
5 Vgl. hierzu auch Karl Richter: Poesie und Naturwissenschaft in Goethes Altersgedichten,
Göttingen 2016, 33.
6 Vgl. dazu Bruno Latour: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen An-
thropologie, Frankfurt a. M. 2008. – Die Umschreibung als ›Unendliches‹ meint hier die
Einheit der Differenz vor ihrer Differenzierung.
7 Vgl. Art. »Atmosphäre«, in: Gerhard Strauß u. a. (Hrsg.): Deutsches Fremdwörterbuch.
Berlin, New York 1996, Bd. 2, 454–460.