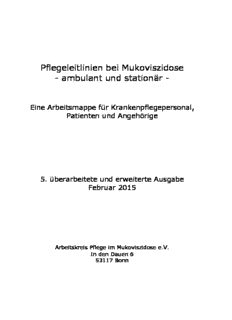Table Of ContentPflegeleitlinien bei Mukoviszidose
- ambulant und stationär -
Eine Arbeitsmappe für Krankenpflegepersonal,
Patienten und Angehörige
5. überarbeitete und erweiterte Ausgabe
Februar 2015
Arbeitskreis Pflege im Mukoviszidose e.V.
In den Dauen 6
53117 Bonn
Stellvertretend für alle Mitglieder des Arbeitskreises:
Dr. rer. med. Brigitte Roos-Liegmann (Kinderkrankenschwester, Dipl. Pädagogin)
Nicole Albrecht (Kinderkrankenschwester)
Monika Brandert (Kinderkrankenschwester)
Petra Fischer (Kinderkrankenschwester)
Susanne Fischer (Kinderkrankenschwester)
Stephanie Eckhardt (Kinderkrankenschwester)
Ulrike Erdmann (Kinderkrankenschwester)
Gabi Hertel (Kinderkrankenschwester)
Melanie Köller (Kinderkrankenschwester, Dipl. Pflegepädagogin)
Mareen Meseke (Kinderkrankenschwester)
Cornelia Meyer (Kinderkrankenschwester)
Mirjam Ohngemach (Kinderkrankenschwester)
Ulrike Rassow-Schlanke (Kinderkrankenschwester)
Christina Schmidt (Kinderkrankenschwester)
Sandra Schmidt (Kinderkrankenschwester)
Kristina Sinning (Kinderkrankenschwester)
Jana Streller (Kinderkrankenschwester)
Klaudia Unorji-Frank (Kinderkrankenschwester)
Sabine Walther (Kinderkrankenschwester)
Kleif Geib (Kinderkrankenpfleger)
Dr. med. Hans-Georg Posselt (Ärztlicher Beirat 1997-2009)
Dr. med. Carsten Schwarz (Ärztlicher Beirat seit 2010)
Dr. med. Andreas Hector
Dr. med. Ute Gräpler-Mainka
Prof. Dr. med. Ralf-Peter Vonberg
Arbeitskreis Pflege
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
vor Ihnen liegt die fünfte Ausgabe der Arbeitsmappe
Pflegeleitlinien bei Mukoviszidose - ambulant und stationär
in Form einer Loseblattsammlung. Die Leitlinien wurden von 1998 bis 2014 von
dem Arbeitskreis Pflege im Mukoviszidose e.V. erstellt und fortlaufend aktuali-
siert. Weitere müssen noch erarbeitet werden.
Die VerfasserInnen haben mit größter Sorgfalt Mukoviszidose-spezifische Pfle-
gemaßnahmen zusammengestellt und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
unter dem Gesichtspunkt der Qualitätssicherung umfassend und dennoch knapp
und präzise dargestellt.
Um dem dynamischen Fluss neuer Erkenntnisse gerecht zu werden, ist eine lau-
fende Überarbeitung der Leitlinien notwendig.
Bei der Arbeitsmappe wurde bewusst auf eine numerische Gliederung und Sei-
tenzählung verzichtet. Die einzelnen Themenbereiche sind farbig gegliedert. Dies
erlaubt uns, Ergänzungen und Veränderungen problemlos in die Mappe zu integ-
rieren.
Für Hinweise, die zur Optimierung der Leitlinien führen, sind die AutorInnen
dankbar.
Wenn Sie in Zukunft weitere und aktualisierte Versionen dieser Pflegeleitlinien
erhalten möchten, füllen Sie bitte den unteren Abschnitt dieses Papiers aus und
senden ihn an:
________________________________________________________________
Vorsitzende des Arbeitskreises Pflege
Mukoviszidose e.V.
In den Dauen 6
53117 Bonn
□ Ja, ich möchte die Arbeitsmappe
Pflegeleitlinien bei Mukoviszidose - ambulant und stationär
vervollständigen und bitte um Zusendung an folgende Adresse:
Name_____________________________________________________________________
Anschrift___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Telefon:__________________Fax:______________________eMail:___________________
Beruf ____________________________________________________________________
Arbeitskreis Pflege
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Krankheitsbild der Mukoviszidose
Register Pflegeleitlinien
Kapitel 1: Allgemeine Verhaltenshinweise, Hygiene
o Händehygiene und Händedesinfektion
o Generelle Hygienemaßnahmen bei Mukoviszidose-Patienten
o Hygienemaßnahmen bei Problemkeimen
o Hygienemaßnahmen bei Pseudomonas aeruginosa
o Hygienemaßnahmen bei Burkholderia cepacia
o Hygienemaßnahmen bei MRSA
o Rauchen und Passivrauchen gefährden die Gesundheit
o Literatur
Kapitel 2: Ernährung
o Aufgaben und mögliche Einflussnahme des Pflegepersonals im Bereich der
Ernährung bei Mukoviszidose
o Allgemeine Tipps rund um den Esstisch und Anregungen für die Entwick-
lung von vorteilhaften Essgewohnheiten
o Ambulante enterale Ernährungstherapie, Checkliste für Pflegepersonal, Pa-
tienten und Angehörige
o Pflegeleitlinie: Legen einer nasogastralen Sonde zur Sondenernährung
o Pflegeleitlinie: Aufbauplan für die pumpengesteuerte Sondenernährung
o Pflegeleitlinie: Verbandswechsel bei PEG (perkutane endoskopische Gast-
rostomie)
o Schematische Darstellung Anlage Freka®PEG gastral
o Pflegeleitlinie: Funktionsprüfung des Buttonballons
o Pflegeleitlinie: Wechsel eines Button
o Literatur
Kapitel 3: Inhalationstherapie
o Pflegeleitlinie: Stationäre Inhalationstherapie unter Anwendung eines Ae-
rosolapparats/Wandentnahmearmatur
o Pflegeleitlinie: Häusliche Inhalationstherapie unter Anwendung eines Aero-
solapparats
o Mischbarkeit von Inhalationslösungen im Vernebler
o Pflegeleitlinie: Inhalationstherapie unter Anwendung eines Dosieraerosols
o Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Pulverinhalation
o Literatur
Inhalt
Kapitel 4: Ambulante intravenöse Antibiotikatherapie
o Ambulante intravenöse Antibiotikatherapie für Venenverweilkanüle und
Port, Checkliste für das Pflegepersonal
o Allergische Reaktionen während intravenöser Antibiotikatherapie
o Pflegeleitlinie: Ambulante intravenöse Antibiotikatherapie unter Anwen-
dung eines Infusionssystems bei Venenverweilkanüle
o Pflegeleitlinie: Ambulante intravenöse Antibiotikatherapie unter Anwen-
dung eines Infusionssystems bei implantiertem PORT-Katheter
o Pflegeleitlinie: Heparinblock bei implantiertem Portkatheter in der Thera-
piepause
o Schematischer Aufbau eines Portkatheters
Kapitel 5: Stationäre intravenöse Antibiotikatherapie
o Pflegeleitlinie: Vorbereitung von Antibiotika-Kurzinfusion ohne Laminar-
Air-Flow
o Pflegeleitlinie: Vorbereitung von Antibiotika-Kurzinfusion im Laminar-Air-
Flow
o Pflegeleitlinie: Legen einer Venenverweilkanüle
o Pflegeleitlinie: Stationäre intravenöse Antibiotikatherapie unter Anwendung
eines Infusionssystems bei Venenverweilkanüle
o Pflegeleitlinie: Zentraler Venenkatheter (ZVK) bei stationärer intravenöser
Antibiotikatherapie
o Pflegeleitlinie: Legen eines zentralen Venenkatheters
o Pflegeleitlinie: Verbandswechsel bei zentralem Venenkatheter
o Pflegeleitlinie: Infusionen bei zentralem Venenkatheter
o Pflegeleitlinie: PICC-Line bei stationärer intravenöser Antibiotikatherapie
o Pflegeleitlinie: Legen einer PICC-Line
o Pflegeleitlinie: Verbandswechsel bei einer PICC-Line
o Literatur
Kapitel 6: Sauerstofflangzeittherapie
o Pflegeleitlinie: Stationäre Sauerstofftherapie bei Mukoviszidose
o Pflegeleitlinie: Ambulante Sauerstofflangzeittherapie bei Mukoviszidose
o Sauerstofflangzeittherapie: Checkliste für Patienten, Angehörige und Pfle-
gepersonal
o Literatur
Kapitel 7: Nicht-invasive Beatmung
o Pflegeleitlinie: Stationäre nicht-invasive Beatmung
o Pflegeleitlinie: Ambulante nicht-invasive Beatmung
o Beatmungsprotokoll bei nicht-invasiver Beatmung
o Literatur
Allgemeine Literatur:
o www.awmf.org (Leitlinien)
o www.ecfs.eu
o www.mukoviszidose-log.de
o www.muko.info
Inhalt
Vorwort
_______________________________________________________
Carsten Schwarz, ärztlicher Beirat (2014)
Die Lebenserwartung von Patienten mit CF ist in den letzten 20 Jahren deutlich
gestiegen und liegt in den meisten Industrieländern bei ca. 40 Jahren. In
Deutschland gibt es erstmals mehr erwachsene Patienten mit CF als Kinder. Dies
ist ein großer Erfolg, der einerseits zurückführen ist auf neu entwickelte Thera-
pien, aber andererseits auch auf die multidisziplinäre Behandlung durch das hoch
spezialisierte Fachpersonal. In diesem Zusammenhang hat vor allem die Pflege
durch den großen zeitlichen und inhaltlichen Anteil an der Betreuung und Versor-
gung der Patienten mit CF wichtige Aufgaben zu übernehmen wie zum Beispiel
die ausführliche patientenorientierte Kommunikation mit den Patienten und den
Eltern, die Einhaltung und Umsetzung von Hygienemaßnahmen zur Prävention
von Infektionen (neue Hygienerichtlinien: KRINKO), Patientenschulungen (z.B.: )
Inhalationsschulungen und psychische Unterstützung und Begleitung.
Zusätzlich muss sich die Pflege immer mehr Herausforderungen stellen, durch
glücklicherweise immer älter werdende Patienten, die dadurch aber auch hoch-
komplexe Patienten sind. Diese können zunehmende weitere Komplikationen
entwickeln wie Osteoporose, Bluthochdruck, Depressionen, Schmerzen, Diabetes
mellitus und viele mehr, mit denen die Pflege umgehen lernen muss. Auf diese
neuartige Situation muss sich auch die Pflege einstellen und dementsprechend
spezialisierter geschult werden.
Eine weitere Herausforderung für die Pflege sind auch die neuartigen Therapie-
möglichkeiten wie zum Beispiel der zunehmende Einsatz von nicht-invasiven Be-
atmungsmöglichkeiten wie Highflow CPAP und BiPAP. Auch hierfür sind Schulun-
gen und Ausbildungen Voraussetzung um den Versorgungsauftrag gerecht zu
werden und dem Patienten die bestmögliche Unterstützung bieten zu können.
Qualitätsstandards sind in einer immer komplexer werdenden Medizin und Pflege
im stationären wie ambulanten Bereich für Behandler und Patienten eine unver-
zichtbare Unterstützung. Um diese Qualitätsstandards in den CF-Zentren flä-
chendeckend in Deutschland zu ermöglichen und zu garantieren, werden CF-
Pflegeschulungen in Deutschland angeboten. Die Einhaltungen der Qualitätsstan-
dards und die Ausstattung mit genügend Personal und vor allem Pflegepersonal,
wird durch eine Gutachterkommission und ein Zertifizierungsboard - bestehend
aus den Vertretern der Fachgesellschaften GPP und DGP sowie dem Mukoviszido-
se e.V., Mukoviszidose Institut gGmbH und Patientenvertretern – überprüft.
Im Rahmen dieser Zertifizierungen soll der hohe Bedarf an Versorgungsunter-
stützung der Patienten mit CF durch die Pflege sicher gestellt.
In den Pflegeleitlinien und vor allem mit dieser Novellierung sind die aktuellen
Pflegestandards nach aktueller Literaturrecherche aufgeführt und sollen der ver-
besserten Patientenversorgung und Anleitung des Pflegepersonals dienen. Diese
Pflegeleitlinien sind zusätzlich ein sehr starker Ausdruck des zunehmenden Ge-
wichtes dieses Fachbereichs in der Versorgung von Patienten mit CF.
Aus meiner ganz persönlichen Sicht ist die Pflege aufgrund ihrer vielschichtigen
Aufgaben die „Seele“ bei der Betreuung der Patientenbetreuung.
Vorwort
Die Prognose der Mukoviszidose-Patienten ist in entscheidendem Maße von einer
hochspezialisierten, konsequenten ambulanten und klinischen Betreuung durch
ein multidisziplinäres Team abhängig.
Aufgrund der Multimorbidität der Patienten und der vielschichtigen medizinisch-
technischen Therapieinhalte nehmen qualifizierte Pflegekräfte im Behandlungs-
team eine zentrale und bedeutsame Rolle in der Organisation und der Realisie-
rung der Therapie ein. Neben den ureigenen Pflegeinhalten umfasst das Aufga-
bengebiet des Pflegedienstes Betreuungsfunktionen bei Diagnostik, sowie Infor-
mation und Schulung zu verschiedenen Therapien. Des Weiteren übernehmen
die Pflegenden eine Bindegliedfunktion zwischen ambulanter und stationärer Ver-
sorgung.
Der Mukoviszidose e.V. ist weiterhin im Rahmen der Qualitätssicherung der Mu-
koviszidose-Versorgung bemüht, ein flächendeckendes Netz zertifizierter Be-
handlungs-Zentren zu installieren. Zu den Qualitätsmerkmalen zertifizierter Zen-
tren gehört der Nachweis spezialisierter Pflegekräfte.
Mit den vorliegenden Pflegeleitlinien sollen die spezifischen Pflegemaßnahmen in
der Versorgung von CF-Patienten zur pflegerischen Qualitätssicherung beitragen.
Sie verdeutlichen zudem die Professionalität der Pflege und die Eigenständigkeit
der Pflegenden innerhalb des multidisziplinären Teams.
Wissenschaftlich fundierte Pflege bietet den Patienten Qualität und Sicherheit in
der lebenslangen Therapie. Sie ist ein einklagbares Anrecht der Patienten und
ihrer Familien.
Für das Behandlerteam sind die Pflegeleitlinien eine wichtige Orientierungshilfe.
Vorwort
Einleitung
_____________________________________________________
B. Roos-Liegmann (1998), Revision M. Köller (2014)
Der Arbeitskreis Pflege im Mukoviszidose e.V. wurde 1997 auf der 1. Deutschen
Mukoviszidose-Tagung in Lahnstein gegründet. Erstmals wurde hier das Pflege-
personal innerhalb des multidisziplinären Behandlerteams bei Mukoviszidose (CF)
in das Fortbildungsprogramm mit einbezogen.
Seit dieser Zeit treffen sich Kinderkrankenschwestern und -pfleger, sowie Kran-
kenschwestern und -pfleger aus verschiedenen Regionen Deutschlands zweimal
jährlich zum Erfahrungsaustausch und zur Weiterbildung.
Der Arbeitskreis Pflege hat sich folgende Aufgaben gestellt:
die Betreuung der CF-Patienten und ihrer Angehörigen zu verbessern
CF-spezifische Pflege unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten weiterzuent-
wickeln und zu professionalisieren
Pflegeleitlinien mit dem Ziel einheitlicher Pflegemaßnahmen zu erstellen
einen interdisziplinären fachlichen Austausch zu ermöglichen
multidisziplinäre Zusammenarbeit, d.h. Kooperation mit allen Interessierten
anderen Berufsgruppen und Institutionen zu pflegen
Teilnahme an nationalen und internationalen Kongressen zu ermöglichen
öffentliche Stellungnahme zu Pflegemaßnahmen zu erbringen
beratende Tätigkeit innerhalb des Mukoviszidose e.V. zu leisten
Unser Pflegeziel ist es, den an Mukoviszidose erkrankten Patienten die größtmög-
liche Sicherheit im Umgang mit den verschiedenen Therapieformen zu geben,
ihren Gesundheitszustand zu erhalten und zu sichern und eine Verbesserung des
Gesundheitszustandes zu erreichen.
Im Zusammenhang mit steigender Lebenserwartung gewinnt die Förderung der
Selbstständigkeit des Patienten an hoher Bedeutung. Die Förderung der Selbst-
ständigkeit sollte in der Pflege-, Anleitungs- und Beratungssituationen einen
hohen Stellenwert haben. Zur Vorbereitung auf ein langes Leben mit chronischer
Erkrankung bekommen Ressourcen des Patienten und seiner Familie, Motivation
und Motivationsförderung sowie die Handhabung und Verstehbarkeit im Umgang
mit der eigenen Gesundheit (Gesundheitskonzept der Salutogenese nach
A. Antonovsky) einen immer größeren Stellenwert. Gesundheitsfördernde Kon-
zepte werden innerhalb einem immer komplexer werdenden Krankheitsbild der
Mukoviszidose unabdingbar.
Die Arbeitsmappe soll dazu beitragen, effektive, qualitativ gute und sinnvolle
Pflege sowohl im ambulanten, wie auch im stationären Bereich zu erbringen. Die
uns anvertrauten Patienten mit Mukoviszidose haben einen Anspruch darauf.
Die darin enthaltenen Leitlinien sollen dem Pflegepersonal ein einheitliches Arbei-
ten ermöglichen, neuen Mitarbeitern eine Orientierungshilfe sein und letztlich
eine rechtliche Sicherheit bieten.
Darüber hinaus stellen die Pflegeleitlinien im ambulanten Bereich für den Patien-
ten und/oder die Angehörigen ein begleitendes Lehrmaterial innerhalb einer um-
fassenden Schulung durch qualifiziertes Pflegepersonal dar.
Einleitung
Krankheitsbild der Mukoviszidose
______________________________________________________
B. Roos-Liegmann (1998), Revision A. Hector (2014)
Definition, Genetik und Diagnose
Das Krankheitsbild der Cystischen Fibrose (CF), im deutschen Sprachraum auch
Mukoviszidose, wurde erstmals 1936 von Fanconi beschrieben. Mukoviszidose ist
die häufigste angeborene Stoffwechselerkrankung der weißen Rasse mit verkürz-
ter Lebenserwartung. Im Vordergrund der Erkrankung steht die chronische Ent-
zündung der Lunge, gefolgt von exokriner und endokriner Pankreasinsuffizienz.
Leber und Gallenwege, Darm und Geschlechtsorgane sind ebenfalls betroffene
Organe. Die Inzidenz wird auf 1 - 2000 bis 1 - 3000 geschätzt. Derzeit werden in
der Bundesrepublik Deutschland ca. 8000 Patienten vermutet.
Mukoviszidose wird autosomal rezessiv vererbt. Zur klinischen Erkrankung
kommt es bei Homozygotie oder der sogenannten Compound-Heterozygotie.
Idiopathische chronische Pankreatitis ist bei Heterozytogie möglich und wurde
bei verschiedenen CFTR-Mutationen gefunden (5). 1989 wurde der genetische
Defekt am langen Arm des Chromosom 7 entdeckt (12, 14). Die häufigste Muta-
tion, delta F508, wird bei über 70% der mitteleuropäischen Patienten identifiziert
(12). Mehr als 1900 Mutationen werden derzeit beschrieben.
Die Sicherung der Diagnose erfolgt durch Pilocarpin-Iontophorese nach Gibson
und Cooke. Im gewonnenen Schweiß lassen sich erhöhte Werte von Natrium und
Chlorid nachweisen. Der Nachweis von mehr als 60 mmol/l Chlorid im Schweiß
ist für Mukoviszidose nahezu spezifisch. Ein pathologisches Schweißtestergebnis
bedarf einer zweifachen Kontrolle. Bei indifferenten Ergebnissen und nicht identi-
fizierbarem Genotyp besteht durch die transepitheliale Potentialdifferenzierung
am respiratorischen Epithel der Nase die Möglichkeit, die Diagnose zu sichern (2,
6, 9). Eine weitere, der transepithelialen Potentialdifferenzierung überlegene Me-
thode scheint das Verfahren der Kurzschluss-Strommessung an Rektumbiopsien
zu sein (15).
Ätiologie und Pathophysiologie
Der Gendefekt bewirkt eine Veränderung des Glykophosphoproteins. Das Gen-
produkt ist ein Membranprotein, das den Chloridtransport durch die Zellwand
hauptverantwortlich regelt und wird CFTR-Protein (cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator) genannt (12). Es handelt sich um einen Chloridkanal,
durch den die Chloridionen-Leitfähigkeit der Zellmembran mitbestimmt wird. Die
Störung des CFTR bewirkt, dass die Chloridionenströme durch die Epithelzell-
membran verändert oder blockiert sind. In den betroffenen Organen kommt es
zu einer Chlorid-Anreicherung in den Epithelzellen. Konsekutiv kommt es zu ei-
nem erhöhten Einstrom von Natrium und Wasser in die Zellen und somit zu ei-
nem Natrium- und Wassermangel im Drüsenlumen (3, 13, 14). Die Folge ist eine
Zunahme der Viskosität des Sekrets exokriner Organe. Im Schweiß hingegen
kommt es zu der charakteristischen Erhöhung des Natriumchlorids, da der CFTR-
Kanal hier den Transport vom Schweiß in das Zellinnere vermittelt. Die Erkran-
kung führt zu charakteristischen Veränderungen an multiplen Organen.
Krankheitsbild
Der Defekt in der Epithelzelle verursacht im Respirationstrakt die Bildung viskö-
sen Schleims, die mukoziliäre Clearance ist eingeschränkt. Dadurch werden vira-
le und bakterielle Infektionen der Lunge begünstigt und führen zu einer Schädi-
gung der Bronchialschleimhäute (11, 16). Die chronische Entzündung der Lunge
führt zu einer fortschreitenden Zerstörung des Organs. Atelektasen, Emphysem,
Pneumothorax, Hämoptoe und Rechtsherzinsuffizienz sind Spätkomplikationen
der Erkrankung. In den oberen Luftwegen wird bei nahezu 100% der Patienten
eine Pansinusitis beobachtet, sie kann beschwerdefrei verlaufen. Der
Pathomechanismus der Entstehung von Nasenpolypen ist noch unklar. Nasenpo-
lypen können zu starker Behinderung der Nasenatmung führen.
Mit einer partiellen oder kompletten Obstruktion der Pankreasdrüsengänge im-
ponieren 85-90% der Erkrankten (1). Es resultiert eine Pankreasinsuffizienz mit
dem klinischen Bild einer Steatorrhoe. Maldigestion und Malabsorption mit
Gedeihstörung, abdominale Beschwerden wie Schmerzen und exzessive Flatulenz
prägen das Krankheitsbild des nicht behandelten Patienten. Infolge der progre-
dienten Parenchymzerstörung steigt mit zunehmendem Alter die Diabetes-
Häufigkeit deutlich an. Jenseits der zweiten Lebensdekade entwickeln fast alle
Patienten eine gestörte Glukosetoleranz. Die Wahrscheinlichkeit, einen manifes-
ten Diabetes zu entwickeln, beträgt mit 30 Jahren knapp 50% (11). Die Form
des Diabetes ist weder dem Typ 1- noch dem Typ 2-Diabetes zuzurechnen. Bis-
her wurde der Diabetes mellitus bei Mukoviszidose als ein Insulinmangeldiabetes
erklärt. Diese Erklärung ist nicht ausreichend. Messungen des Plasma-Insulins
während der oralen Glukosebelastung zeigen eine verzögerte Insulinfreisetzung.
Bei manifestem CF-Diabetes lässt sich eine erhöhte hepatische
Glukoseproduktion nachweisen, die auch nach intravenöser Gabe von Insulin er-
höht bleibt. Die reduzierte Insulinsensitivität spricht für eine periphere Insulinre-
sistenz an der Leber. Bedingt durch die verzögerte Insulinfreisetzung präsentiert
sich der CF-Diabetes in einer nicht ketotischen Form, Blutzuckerwerte von bis zu
1000 mg/dl führen in der Regel nicht zu einer Ketose und Koma (7). Der
Glukosemetabolismus wird beeinflusst durch die für die Mukoviszidose charakte-
ristischen klinischen Faktoren: mangelnde Energiezufuhr, Malabsorption, gestör-
te Leberfunktion und Verlauf der chronischen Infektion der Lunge. Der Energie-
bedarf wird angehoben und die Atemarbeit gesteigert. Unbehandelte Patienten
fallen, wie eine Metaanalyse der Kopenhagener CF-Patienten zeigte, bereits Jah-
re vor der klinischen Manifestation durch eine Verschlechterung der Lungenfunk-
tion und eine negative Gewichtsentwicklung auf (10).
Die Eindickung der intestinalen Sekrete kann bei Neugeborenen zu einem
Mekoniumileus und im späteren Krankheitsverlauf zum distalen intestinalen Ob-
struktions-Syndrom (DIOS) führen (7). Bei unbehandelten Säuglingen ist der
Rektumprolaps eine geläufige intestinale Manifestation. Ein prolongierter Neuge-
borenen-ikterus ist nicht selten.
Die Maldigestion bedingt chronische Gallensäureverluste und führt zu einem
Übergewicht hydrophober Gallensäuren wie der Lithocholsäure. Durch die Unter-
brechung des enterohepatischen Kreislaufs der Gallensäuren kommt es zu einer
Gallepoolverringerung und Beeinträchtigung der Fettverdauung.
Bildung und Fluss der Galle werden entscheidend durch den gestörten CFTR-
Mechanismus mitbestimmt. Die Chlorionenpermeabilitätsstörung bewirkt die Ent-
stehung eines wasserarmen, zähflüssigen Gallensekrets. Das abnorme Gallen-
sekret induziert eine Cholestase. Bei Cholestase werden fetale Wege der
Krankheitsbild
Description:J Clin Invest 1994;93:461-466. (18) Walter S, Posselt H-G, Bender SW. Mosby`s Patient Teaching Guides. Smoking and your lungs. St. Louis