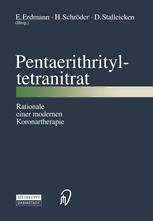Table Of ContentE. Erdmann H. Schröder D. Stalleicken (Hrsg.)
Pentaerithrityl-
•
tetranitrat
Rationale einer modernen Koronartherapie
Mit 42 Abbildungen und 10 Tabellen
Prof Dr. med. E. Erdmann
Klinik für Innere Medizin III
Kardiologie - Angiologie - Pneumologie und internistische Intensivmedizin
Joseph-Stelzmann-Straße 9, 50924 Köln (Lindenthal)
Prof Dr. rer. nato H. Schröder
Institut für Pharmakologie und Toxikologie
für Naturwissenschaftler, Fachbereich Pharmazie
Wolfgang-Langenbeck-Straße 4, 06120 Halle
Dr. med. D. Stalleicken
Medizinischer Direktor, ALPHARMA-ISIS GmbH & Co. KG, Langenfeld
Mitglied der Arbeitsgruppe Pharmakologie,
Hochschule für Technik und Wirtschaft (FH) Albstadt-Sigmaringen
Wissenschaftliche Betreuung der Reihe
Prof Dr. med. H. T. Schneider
Arbeitsgruppe Pharmakologie (Leiter)
Hochschule für Technik und Wirtschaft (FH) Albstadt-Sigmaringen
Anton-Günther-Straße 51, 72488 Sigmaringen
ISBN 978-3-7985-1315-0 ISBN 978-3-642-87802-2 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-642-87802-2
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Überset
zung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der
Mikroverfilmung oder der VervielfaItigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsan
lagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine VervielfaItigung dieses Werkes oder
von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urhe
berrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung
zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen
des Urheberrechtsgesetzes.
http://www.steinkopff.springer.de
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001
Ursprünglich erschienin bei Steinkopff Verlag Darmstadt 2001
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt
auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen
und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürf
ten.
Prodnkthaftung: Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine
Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand an
derer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.
Satz: K+V Fotosatz GmbH, Beerfelden
Gedruckt auf säurefreiem Papier
Vorwort
In den letzten 2 Jahrzehnten ist es gelungen, die einzigartige Bedeutung des
Stickstoffmonoxid (NO) für eine Vielzahl von biologischen Funktionen he
rauszuarbeiten. Die Ergebnisse der molekularbiologischen Forschung der
letzten Jahre machen es verständlich, warum organische Nitrate seit Genera
tionen erfolgreich in der Akutbehandlung und Langzeitprophylaxe der Angi
na pectoris eingesetzt werden und ein unverzichtbarer Bestandteil der phar
makologischen Therapiemöglichkeiten bei der Behandlung der koronaren
Herzkrankheit sind. NO-Donoren aus der Gruppe der Salpetersäureester sind
Pro Drugs, die eine gestörte endogene, im Wesentlichen endotheliale NO
Produktion substituieren. Ausgangspunkt für die molekularbiologische For
schung über die Wirkungen von NO waren die Ergebnisse der Forschungs
arbeiten von Robert F. Furchgott. Seine Arbeitsgruppe konnte auf Grund ex
perimenteller Untersuchungen die Existenz eines "endothelium-derived relax
ing factor" (EDRF) postulieren. Die Gruppen von Salvator Moncada und Lou
Ignarro konnten die Identität des EDRF mit dem NO-Radikal nachweisen.
Sie erhielten dafür 1998 den Nobelpreis. Dies unterstreicht die hohe klinische
Relevanz der wissenschaftlichen Forschungsarbeiten mit NO.
Die seit mehr als 100 Jahren therapeutisch eingesetzten organischen Nitra
te haben auf Grund der intensiven experimentellen pharmakologischen Ar
beiten das Stadium der Empirie verlassen und repräsentieren heute eine ra
tional begründbare Substitutionstherapie. Für die Wirkmechanismen liegen
experimentell sehr gut abgesicherte Modellvorstellungen vor. Allerdings gibt
es ungeachtet vieler grundsätzlicher Gemeinsamkeiten innerhalb dieser Sub
stanzklasse Unterschiede in Wirkstärke, Wirkdauer sowie zu einem gewissen
Ausmaß auch im Wirkort. Die pharmakokinetischen und pharmakodyna
mischen Unterschiede beruhen auf unterschiedlichen physikochemischen Ei
genschaften. Sie haben erhebliche Konsequenzen für die differenzierte kli
nische Anwendung. Unter den therapeutisch eingesetzten organischen Lang
zeitnitraten nimmt das Pentaerithrityltetranitrat (PETN) eine Sonderstellung
ein. Diese Sonderstellung ist charakterisiert durch raschen Wirkungseintritt
einerseits und Langzeitwirkung andererseits, die durch die Pharmakokinetik
der Hauptmetaboliten erklärt werden kann. Ein weiterer klinisch wichtiger
Unterschied betrifft die vornehmliche Wirkung auf den venösen Schenkel
des Gefäßsystemes. Hierdurch kommt es zu der erwünschten hämodyna-
IV Vorwort
misch wesentlichen Vorlastsenkung. Die geringere Inzidenz von Kopfschmer
zen wirkt sich günstig auf die Compliance der Patienten aus. Diese Stichwor
te alleine wären ausreichend, eine Sonderstellung des PETN zu begründen.
Für die klinische Anwendung hat ein anderer Aspekt über die genannten
Charakteristika hinaus eine einzigartige Bedeutung. Das PETN führt nicht
zu den die Nitrattherapie limitierenden Toleranzphänomenen, wie durch eine
Vielzahl von experimentellen Arbeiten in klinisch relevanten Modellen ge
zeigt werden konnte. Die von Bassenge in Freiburg geleitete Arbeitsgruppe
konnte nicht nur das Fehlen von vaskulären und hämodynamischen Tole
ranzphänomenen nachweisen, sondern darüber hinaus die Molekularbiologie
der Toleranzentstehung aufdecken. Als sich selbst reduzierendes Nitrat
kommt es unter der Gabe von PETN nicht zur Bildung von reaktiven Sauer
stoffspezies (ROS). Eine gesteigerte ROS-Produktion ist Ursache für das
Fortschreiten einer endothelialen Dysfunktion. Da PETN die ROS-Produk
tion nicht steigert, kommt dem PETN auch eine endotheliale Schutzfunktion
zu, die insbesondere durch die Arbeiten von Kojda aus Düsseldorf experi
mentell bestätigt werden konnte. Ein weiterer Mechanismus, über den die
zellprotektive Wirkung von PETN erklärt werden könnte, ist die Stimulation
der Hämoxygenase-l durch PETN. Diese Thematik wurde durch die Arbeits
gruppe von Schröder in Halle aufgearbeitet.
Alle diese vorgenannten Eigenschaften begründen das international hohe
Interesse an PETN. Die PETN-Forschungsgruppen treffen sich traditions
gemäß einmal jährlich zu einem wissenschaftlichen Symposium. Dieser Er
fahrungsaustausch fand im Jahre 2000 in Gotha statt. In dem vorliegenden
Heft der "Blauen Reihe mit dem farbigen Balken" sind die in Gotha vor
gestellten und diskutierten Ergebnisse zusammengefasst. Ein im Rahmen ei
ner Forschungskoorperation zwischen der Universität Halle (Schröder) und
der Stanford University (Dennery) durchgeführtes Projekt belegte erneut den
antioxidativen Endothelschutz durch PETN in Folge der Induktion von Ferri
tin und Hämoxygenase. Bassenge konnte zeigen, dass PETN in einem Hyper
cholesterolämie-Modell eine mit Statinen vergleichbare Wirkung besitzt. Die
selbe Arbeitsgruppe konnte Befunde vorstellen, die den Unterschied zwi
schen GTN und PETN auf die Thrombozytenfunktion belegen. In Folge einer
gesteigerten ROS-Produktion unter GTN-Therapie kommt es auch zu einer
veränderten und gestörten Thrombozytenfunktion. Dies bleibt unter PETN
Therapie aus. Die von Parker (Toronto) vorgestellten Befunde haben erst
malig nachgewiesen, dass die bisherigen tierexperimentellen Befunde einer
fehlenden Toleranzentwicklung auch auf den Menschen übertragbar sind. In
einer humanpharmakologischen Untersuchung wurde nachgewiesen, dass
PETN im Gegensatz zu GTN weder hämodynamische noch vaskuläre Toler
anzphänomene auslöst und dass es unter einer PETN-Therapie nicht zu ei
ner vermehrten Bildung von Markern des oxidativen Stresses kommt.
Die in Gotha vorgestellten Einzelbeiträge belegen nicht nur erneut die be
sonderen pharmakologischen Eigenschaften von PETN, sondern konnten
erstmalig zeigen, dass die in klinisch relevanten experimentellen Unter-
Vorwort V
suchungen erhobenen Befunde auch auf den Menschen übertragbar sind.
Die anwesenden Experten waren sich einig, dass in Zukunft ein stärkeres Ge
wicht auf klinische Untersuchungen mit PETN gelegt werden sollte.
Köln, Halle, Langenfeld, im September 2001 E. Erdmann
H. Schräder
D. Stalleicken
Inhaltsverzeichnis
Die medikamentöse Therapie der stabilen Angina pectoris ..... ...... .... . 1
E. Erdmann
2 Die molekulare Struktur des Pentaerithrityltetranitrats in Kristall und Lösung . . . 11
J. Lehmann, M. Nieger, M. U. Kassack
3 Unterschiedliche Wirkungen von Pentaerithrityltetranitrat
und Glycerol-Trinitrat auf hämodynamische und biochemische Parameter
der Entwicklung von Toleranzphänomenen: Eine humanpharmakologische
In-vivo-Studie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 . . . . . . . . . . . . .
J. D. Parker, T. Gori, U. Jurt
4 Antioxidativer Endothelschutz durch Pentaerithrityltetranitrat:
Funktionelle Konsequenz der Induktion von Ferritin und Hämoxygenase-1 . . . .3.9
Stefanie Oberle-Plümpe, Aida Abate, Phyllis A. Dennery,
D. Stalleicken, H. Schräder
5 Reduktion der Atherogenese im Hypercholesterolämie-Modell
durch Pentaerithrityltetranitrat (PETN) im Vergleich zu Statinen . . . . . . . ... . .4 7
E. Bassenge, D. Stalleicken, M. Schwemm er, B. Fink
6 Plättchenaktivität unter PETN - Fehlen der Toleranzparameter
bei der nicht intermittierenden Gabe . ..... .. . ..... ..... .. .. .. . .. . 59
B. Fink, E. Bassenge
7 Keine Nitrattoleranz nach kontinuierlicher oraler Gabe von PETN ... .. .... . . 71
Senta Müller, J. Müllenheim, Ute Laber, W. Meyer, B. Fink,
v. Thämer, G. Kojda
Autorenverzeichnis
Prof. Dr. med. E. Erdmann Prof. Dr. J. Lehmann
Klinik für Innere Medizin III Dr. M. U. Kassack
Kardiologie - Angiologie - Pharmazeutisches Institut
Pneumologie der Rheinischen
und internistische Intensivmedizin Friedrich-Wilhelms-Universität
Universität zu Köln An der Immenburg 4
Joseph-Stelzmann-Straße 9 53121 Bonn
50924 Köln (Lindenthai)
Priv.-Doz. Dr. med. W. März
Prof. Dr. med. E. Bassenge Dr. med. W. Köster
Dr. B. Fink Dr. med. K. Doerfer
Dr. M. Schwemmer Dr. med. J. Eckes
Institut für an gewandte Physiologie Medizinische Klinik
und Balneologie der Albert -Ludwig-Universität
Albert -Ludwig -Universität Hugstetter Straße 55
Hermann-Herder-Straße 7 79106 Freiburg
79104 Freiburg
Prof. Dr. W. Meyer
Prof. Dr. med. J. C. Frölich Anatomisches Institut
Dr. med. R. Keimer Histologie und Embryologie
Institut für Klinische Pharmakologie Tierärztliche Hochschule
Medizinische Hochschule Hannover Bischofsholer Damm 15
Carl-Neuberg-Straße 1 30173 Hannover
30625 Hannover
Dr. M. Nieger
Priv.-Doz. Dr. G. Kojda Institut für Anorganische Chemie
Senta Müller der Rheinischen
Ute Laber Friedrich-Wilhelms-Universität
Institut für Pharmakologie Gerhard Domagk Straße 1
Heinrich -Heine-Universität 53121 Bonn
Moorenstraße 5
40225 Düsseldorf
X Autorenverzeichnis
Prof. Dr. H. Schröder Prof. Dr. med. P. A. Dennery
S. Oberle-Plümpe Stanford University School
Dr. A. Abate of Medicine
Institut für Pharmakologie und Stanford, California 94305, USA
Toxikologie für Naturwissenschaftler
Fachbereich Pharmazie Dr. med. D. Stalleicken
Martin-Luther-Universität ALPHARMA ISIS GmbH & Co. KG
Wolfgang-Langenbeck-Straße 4 Elisabeth-Selbert-Straße 1
06120 Halle/Saale 40764 Langenfeld
Prof. Dr. med. V. Thämer Wissenschaftliche Koordination:
Dr. med. J. Müllenheim Prof. Dr. med. H. T. Schneider
Klinik für Anästhesiologie Hochschule für Technik
Heinrich -Heine-Universität und Wirtschaft
Moorenstraße 5 Albstadt -Sigmaringen
40225 Düsseldorf Arbeitsgruppe Pharmakologie
Anton -Günther-Straße 51
72488 Sigmaringen
1
Die medikamentöse Therapie
der stabilen Angina pectoris
E. ERDMANN
Auch vermeintlich gesicherte Behandlungskonzepte unterliegen Änderungen,
die durch medikamentöse Neuentwicklungen, aber auch durch neue Erkennt
nisse zu bereits bekannten Pharmaka hervorgerufen werden. Gelegentlich hat
ein Wandel der Therapie auch ökonomische Gründe. Im Folgenden soll ver
sucht werden, den aktuellen Stellenwert der verschiedenen, für die stabile
Angina pectoris geeigneten Medikamente kritisch zu evaluieren und daraus
therapeutische Konsequenzen abzuleiten.
1.1 Definitionen
Die koronare Herzerkrankung manifestiert sich in Form von Angina pectoris,
Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz oder Herzrhythmusstörungen. Wir unter
scheiden das akute Koronarsyndrom (instabile Angina pectoris und Myokard
infarkt) und die stabile Angina pectoris. Aus klinischen und prognostischen
Gründen wird die stabile Angina pectoris dann diagnostiziert, wenn die typi
schen Symptome über einen längeren Zeitraum bei meist gleicher körperlicher
oder psychischer Belastung auftreten [7]. Die Schmerzanfälle sistieren nach
Abbruch der körperlichen Belastungen, bzw. regelhaft nach der Einnahme
von Nitraten. Als Anginaäquivalent werden Belastungsdyspnoe oder auch be
lastungsinduzierte Rhythmusstörungen eingeschätzt. Die stumme Koronar
ischämie (Nachweis durch EKG-Veränderungen während Belastung aber ohne
pektanginöse Schmerzen) ist häufiger als allgemein angenommen und tritt be
sonders bei Diabetikern oder älteren Patienten mit koronarer Herzerkrankung
auf. Wichtig ist für die Definition, dass die stabile Angina pectoris von dem
akuten Koronarsyndrom (Erstangina, Ruheangina ohne körperliche Belastung,
Zunahme von Anfallshäufigkeit oder -intensität) abgegrenzt wird. Gleiches gilt
für die Postinfarktangina (Auftreten innerhalb der ersten Wochen nach Myo
kardinfarkt als Ausdruck fortbestehender Koronarischämie). Das Syndrom X
(small vessel disease) beruht auf einer endothelialen Dysfunktion der Korona
rien, deren zumeist geringe atherosklerotischen Veränderungen sich koronaro
graphisch nicht nachweisen lassen. Die pektanginösen Beschwerden bei ver
meintlich normalen Koronarien werden oft als "psychisch" fehlgedeutet.
2 Die medikamentöse Therapie der stabilen Angina peetoris
1.2 Diagnostik
Die koronare Herzerkrankung wird im Wesentlichen durch die typische
Anamnese erkannt, wobei das Belastungs-EKG bei der stabilen Angina pectoris
eine herausragende Rolle spielt. Dieses erfasst die funktionellen Auswirkungen
der Erkrankung und ist dem morphologischen Korrelat der koronaren Herz
krankheit, dem reinen Kalknachweis der Herzkranzgefäße durch röntgenologi
sche Methoden bzw. MRT deutlich überlegen. Statt eines Belastungs-EKG's
kann natürlich auch ein Stress-Echokardiogramm durchgeführt werden oder
eine Szintigraphie mit und ohne Belastung [7]. In Deutschland werden heute
Patienten mit nicht-invasiv nachgewiesener symptomatischer koronarer Herz
erkrankung zumeist koronarographiert und anschließend einer Revaskularisa
tionstherapie zugeführt (Koronardilatation, Stent-Implantation, Bypassopera
tion), sofern dies möglich ist und vom Patienten gewünscht wird.
1.3 Therapie der stabilen Angina pectoris
1.3.1 Allgemeine Maßnahmen
Zum einen muss versucht werden, die Progredienz der koronaren Herz
erkrankung zu verhindern bzw. zu verlangsamen (Abbau der Risikofaktoren:
Rauchen, Behandlung des erhöhten Blutdrucks, Senkung des LDL-Choleste
rins, Behandlung des Diabetes mellitus). Zum anderen sind Lebensstilände
rungen insofern notwendig, als die Situationen zu vermeiden sind, die pekt
anginöse Beschwerden auslösen können. Ob durch langsam steigende
körperliche Belastungen die anginafreie Leistungsfähigkeit wirklich signifi
kant erhöht werden kann, wird von vielen bezweifelt. Zyniker meinen, dass
während der Zeit der körperlichen Belastung nicht geraucht und gegessen
wird und dass dadurch der positive Effekt bewirkt wird. Große Mahlzeiten
ebenso wie psychisch belastende Situationen müssen allerdings unbedingt
gemieden werden. Es gibt durchaus Patienten, die durch eine radikale Ände
rung ihres Lebensstils (weitgehende oder vollständige Vermeidung tierischer
Fette, regelmäßige moderate körperliche Betätigung und Senkung des LDL
Cholesterins durch Einnahme von Statinen auf Werte weit unter 100 mg/dl
sowie drastische Gewichtsabnahme) praktisch beschwerdefrei werden [10].
1.3.2 Spezielle medikamentöse Therapie der stabilen Angina peetoris
Das Missverhältnis zwischen Oz-Angebot und Oz-Verbrauch soll durch ent
sprechende Pharmaka korrigiert werden, ebenso wie die Bildung von Throm
ben durch regelmäßige Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern
verhindert werden soll. Wahrscheinlich benötigen alle Patienten mit nach-