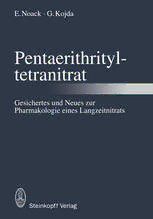Table Of ContentE. Noack G. Kojda
Pentaerithrityl
tetranitrat
Gesichertes und Neues
zur Pharmakologie
eines Langzeitnitrats
11\
i
Steinkopff Verlag Darmstadt
Prof Dr. med. Eike Noack
Dr. rer. nato Georg Kojda
[nstitut für Pharmakologie
Heinrich-Heine-Universität
Moorenstraße 5
40225 Düsseldorf
ISBN-13 :978-3-7985-0978-8 e-ISBN- 13 :978-3-642-72518-0
DOI: 10.1007/978-3-642-72518-0
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten
Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags,
der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der
Mikroverfilmung oder der Vervie1fältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugs
weiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder
von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der
gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepu
blik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung
zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen
unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
© by Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, Darmstadt, 1994
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zur
Annahme, daß solche Namen im Sinn der Warenzeichen- und Marken
schutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann
benutzt werden dürften.
Produkthaftung: Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Appli
kationsformen kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden.
Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall
anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.
Umschlaggestaltung: Struwe & Partner, Heidelberg
Herstellung: PRO EDIT GmbH, Heidelberg
Satz: Datenkonvertierung durch Elsner & Behrens GmbH, Oftersheim
Gedruckt auf säurefreiem Papier
Inhaltsverzeichnis
Pentaerithrithyltetranitrat
Organische Nitrate in der KHK-Therapie 1
Die Bedeutung von NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Differential-therapeutische Aspekte der Koronardilatation . 2
Die Nitratwirkung erfolgt über NO .............. " . . . . . 3
Die Entwicklung von PETN als KHK-Therapeutikum .... 3
Die pharmakologische Besonderheit von PETN .......... 4
Die Pharmakokinetik von PETN ...................... 5
Die Metabolite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Die enterohepatische Zirkulation ...................... 6
NO-Freisetzung aus PETN ............................ 7
Gefäßrelaxation durch PETN ......................... 8
Dosierung und Toleranzentwicklung ................... 9
Indikationsgebiete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
Verträglichkeit durch selektive Vorlastsenkung . . . . . . . . . .. 10
PETN als Vorlast-Senker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
Unterschiedliche Beeinflussung von Vor- und Nachlast. . .. 11
Therapeutische Implikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12
Literatur ........................................... 13
Pentaerithrityltetranitrat
Organische Nitrate in der KHK-Therapie
Organische Nitrate sind nach wie vor die Basistherapeutika bei der Behandlung
der Koronaren Herzkrankheit. Der pharmakologischen Grundlagenforschung
ist es in den letzten Jahren gelungen, die wesentlichen molekularpharmakologi
schen Einzelprozesse bei der Wirkungsvermittlung dieser Substanzklasse aufzu
klären (Überblick siehe Noack, 1991; Noack und Feelisch, 1991). Dabei zeigte
sich, daß sich Organische Nitroverbindungen eines Wirkprinzips bedienen, das
die Natur seit jeher auch selbst zur Gefäßerweiterung bzw. zur Regulation der
regionalen Durchblutung benutzt. Es handelt sich um den in den Endothelzellen
der Gefäßwand gebildeten Faktor EDRF, der chemisch weitgehend oder ganz
mit radikalisehern Stickstoffmonoxid/NO identisch ist. Aus unseren eigenen
Untersuchungen zum molekularen Wirkungsmechanismus organischer Nitro
verbindungen geht hervor, daß alle therapeutisch eingesetzten Nitrovasodila
tatoren ebenfalls radikalisches Stickstoffmonoxid als pharmakologisch aktives
Prinzip freisetzen, das wie EDRF/NO selbst die glatte Muskelzelle der Gefäß
wand zu relaxieren vermag (Noack und Murphy, 1991; Feelisch und Noack,
1991; Feelisch et al., 1993). Damit repräsentieren die therapeutisch bevorzugt bei
der ischämischen Herzkrankheit eingesetzten Nitroverbindungen wie Isosorbid-
5-Mononitrat (IS-5-MN) Prodrugs des auch physiologischen Mediatorstoffs
EDRF/ NO. So gesehen sind die Organischen Nitrate endlich dem Stadium der
Empirie entrückt und repräsentieren aus heutiger Sicht eine rational begründba
re und therapeutisch sinnvolle Substitutionstherapie.
Die Bedeutung von NO
Die Ergebnisse der letzten Jahre sprechen dafür, daß dem Stickstoffmonoxid
eine fundamentale Bedeutung für die Modulation des Gefäßtonus koronarer
Leitungs-und kardialer Widerstands gefäße zukommt (Chu et al., 1990; Pohl und
Busse, 1990). Bei ischämischer oder atherosklerotischer Schädigung oder durch
den gänzlichen Verlust des Gefäßendothels kommt es daher infolge des dann
vorhandenen lokalen Mangels an NO zu einer regionalen Vasokonstriktion
(Rubanyi und Vanhoutte, 1986) und zur Begünstigung zellschädigender Gefäß
wandprozesse, weil NO die unter Ischämie vermehrt gebildeten Sauerstoffradi
kale (Oxygen stress) nicht mehr abfangen und entgiften kann. Nach neuesten
2 Pentaerithrityltetranitrat
Untersuchungen führt jede Abnahme der regionalen NO-Bildung zu einer
entsprechenden Zunahme der Aktivität des Renin-Angiotensin-Systems in der
Gefäßwand. Gefäßareale mit relativem NO-Mangel müßten daher besonders gut
auf exogene NO-Lieferanten, wie es die Organischen Nitrate sind, ansprechen
(Bassenge und Stewart, 1987; Kojda et al. , 1991), weil dadurch eine gezielte NO
Substitution erreicht wird. Eine Gefäßrelaxation wäre dann besonders in jenen
Gefäßgebieten des Koronarbaums zu erwarten, in denen wegen Ischämie und
endothelia1er Dysfunktion die physiologische Regulation des Gefäßtonus, also
insbesondere im Poststenosebereich, gestört ist. Dagegen ist in noch ausreichend
durchbluteten bzw. gut versorgten Gefäßarealen, dort wo die endotheliale
Auskleidung der Koronararterien noch intakt ist, eher mit einem geringeren
vasodilatierenden Effekt Organischer Nitrate zu rechnen. Hierfür sprechen auch
eigene Untersuchungen an isolierten koronaren Gefäßpräparationen. Danach
beträgt die ha1bmaximal wirksame Konzentration von Glyceroltrinitrat am
intakten Präparat einer isolierten Koronararterie vom Schwein 0,4 ± 0,05 J.1M.
Wird das Endothel entfernt oder die endotheliale NO-Produktion gezielt durch
einen Hemmstoff des NO synthetisierenden Enzyms NO-Synthase blockiert,
sinkt diese Konzentration auf 0,05 ± 0,007 J.1M, d. h. es wird etwa 8mal weniger
Glyceroltrinitrat benötigt, um den gleichen Effekt zu erzielen (Kojda et al.,
1992a). Vergleichbare Zusammenhänge wurden an isolierten Venenpräparaten
beobachtet (Kojda et aL, 1992b). Es ist dabei bemerkenswert, daß dieser Effekt
nur für solche Nitrate zutrifft, die, um zur Wirkung zu gelangen, im glatten
Gefäßmuskel oder seiner unmittelbaren Umgebung metabolisiert werden müs
sen. Hierzu zählen neben Glyceroltrinitrat auch IS-5-mononitrat und PETN.
Sellke et al. (1990) konnten an Koronargefäßen von Affen, die cholesterinreich
gefüttert worden waren, zeigen, daß der relaxierende Effekt von Nitroprussid
Natrium trotz erheblicher endothelialer Dysfunktion unverändert erhalten war.
In eigenen Untersuchungen an cholesterinreich gefütterten Kaninchen wurde
dies für IS-5-mononitrat und PETN von unserer Arbeitsgruppe kürzlich
bestätigt (Kojda et al., 1993).
Differential-therapeutische Aspekte der Koronardilatation
Dipyridamol, Carbochromen, Hexobendin, Dilazep und andere heute als
maligne Koronardilatatoren bezeichnete Pharmaka erweitern bevorzugt die
präkapillären Sphinkteren und damit die arterioläre Strombahn (Kinsella et al.,
1962). Im Gegensatz dazu relaxieren Organische Nitrate nur die extramuralen
Koronararterien und die größeren Arterienäste (> 200 J.1m) der intramyokardia
len Leitungsarterien. Ursache für diese vom Gefäßkaliber abhängige Wirkung
könnte darin bestehen, daß sie in den kleineren entweder nicht ausreichend
bioaktiviert werden oder weil dort die für die Vasorelaxation notwendigen
Enzymsysteme fehlen (Harrison, 1993; Sellke et al., 1990). Dadurch kommt es
Die Entwicklung von PETN als KHK-Therapeutikum 3
präarteriolär zu einem Druckanstieg, der die Eröffnung von Kollateralgefaßen
begünstigt und damit bei regionaler Ischämie z. B. infolge einer Koronarstenose
die Randdurchblutung verbessert. Die vasorelaxierende Wirkung der Organi
schen Nitrate ist also vermutlich wegen der regional unterschiedlichen Bioakti
vierungsmöglichkeiten stark vom Gefaßtyp bzw. -kaliber abhängig, woraus
sich nicht zuletzt auch die auffalligen arte rio-venösen Wirkunterschiede
erklären könnten. Grundsätzlich gilt, daß Nitrate schwache Dilatatoren der
kleinen koronaren Widerstandsgefaße sind (Müller-Beckman und Gross, 1986).
Dies gilt allerdings nicht für Nitroverbindungen, die NO direkt, d. h. nichtenzy
matisch liberieren, wie Nitrosothiole oder der Metabolit des Molsidomins SIN-
1. Die durch sie bewirkte Beeinflussung der Koronardurchblutung könnte
daher anders bzw. hämodynamisch weniger vorteilhaft als bei IS-5-Nitrat oder
PETN sein.
Die Nitratwirkung erfolgt über NO
Für die Anwendung organischer Nitroverbindungen ergeben sich auch deshalb
ganz neue pharmakologische und klinische Aspekte, weil diese Pharmaka ein
Wirkprofil haben dürften, das demjenigen von NO entspricht. NO hat aber ein
viel breiteres Wirkspektrum als wir dies den Nitroverbindungen bisher zuge
traut haben. Dies haben die Untersuchungen der vergangenen Jahre sehr
eindrucksvoll belegt (Übersicht bei Noack und Murphy, 1992 und Moncada et
al., 19Q2). Die folgende Tabelle (Tabelle 1) faßt einige wesentliche Eigenschaf
ten zusammen, mit denen NO aufvielfaltige Weise in das Krankheitsgeschehen
der KHK eingreifen kann.
Die Entwicklung von PETN als KHK-Therapeutikum
Pentaerithrityltetranitrat ist eine organische Nitroverbindung, die aufgrund
ihrer mehrstündigen Wirkdauer zu den Langzeitnitraten zu zählen ist. Wegen
nachgewiesener antiischämischer Wirksamkeit wurde es bereits 1943 von
Tabelle 1. Effekte von EDRF /NO, die das KHK-Geschehen positiv beeinflussen
NO wirkt koronardilatatorisch - anti ischämisch
NO verhindert die Adhäsion und Aggregation der Thrombozyten
NO verhindert proliferative Gefäßwand-Prozesse aufgrund von anti-trophogenen
Eigenschaften
NO verhindert die Noradrenalin-Freisetzung aus sympathischen Nervenendigungen
NO wirkt antagonistisch gegenüber vasokonstriktorischen Stimuli (z. B. Serotonin)
NO hat eine Scavenger-Funktion (Bindung von Sauerstoffradikalen, Verhinderung der
Oxidation von LDL)
4 Pentaerithrityltetranitrat
Bjerlöv in die Therapie eingeführt. Auch in den USA erfolgte die Zulassung
bereits Anfang der 50er Jahre (PeritrateR Tabs, Parke-Davis Co.) mit oralen
Einzeldosen von 10, 20 und 40 mg und einer durchschnittlichen Tagesdosis von
4 X tgl. 40 mg PETN. Später wurde die Produktpalette durch weitere galenische
Zubereitungen wie eine 80 mg Retardtablette, ein TTS und Salbenzubereitun
gen ergänzt. Die Zulassung durch die FDA erfolgte seinerzeit mit der Beurtei
lung "safe and widely regarded as useful". Die ersten umfangreichen klinischen
Studien mit PETN wurden 1957/58 veröffentlicht. Kurze Zeit später fand
bereits die Zulassung in der BRD unter dem Namen DilcoranR statt. Der
therapeutische Einsatz hielt sich jedoch in Grenzen, obwohl es anfangs von
klinischer Seite aus auch hier positiv beurteilt wurde (Kaltenbach, 1972).
Pharmakologische Wirksamkeit und therapeutische Brauchbarkeit von PETN
wurden in der Vergangenheit sicherlich unterschätzt, sonst könnte man die
relativ geringe Verordnungshäufigkeit in der BRD nicht erklären. Dies umso
mehr als die Entwicklung in der ehemaligen DDR ganz anders verlief. Hier
wurde PETN bereits im Jahre 1964 in den Handel eingeführt und war bis zum
Fall der Mauer das einzige verfügbare Langzeitnitrat, mit dem aufgrund
umfangreicher klinischer Erfahrungen durch die Jahre hindurch erfolgreich
gearbeitet worden ist (Russek, 1966; Davidson et al., 1970; Amsterdam et al.,
1980; Engelmann und Gottschild, 1981; Hentschel und Haustein, 1985; Haus
tein et al., 1992) . Seit 1964 stand es zur oralen Dauertherapie als PentalongR
zunächst in einer 20 mg und ab 1983 als 50mg Dosierung zur Verfügung, das
noch heute das Standardpräparat darstellt. Neuerdings steht auch eine 80 mg
PETN enthaltende Oblong-Tablette zur Verfügung.
Die pharmakologische Besonderheit von PETN
Die hier erstmals vorgestellten Ergebnisse zum pharmakologischen Wirkprofil
von PETN unterstreichen den Wert der therapeutischen Anwendbarkeit von
PETN, bei Vergleich mit den häufig verordneten Alternativpharmaka wie dem
Isosorbiddinitrat (ISDN) und Isosorbid-5-mononitrat (IS-5-N).
PETN ist ein Langzeitnitrat mit eigenständigen pharmakologischen Eigen
schaften, das man als das omnipotenteste unter den z. Zt. im Handel befindli
chen Nitraten bezeichnen kann. Der Grund liegt darin, daß es sich bei PETN
um ein Mehrkomponentennitrat handelt, aus dem im Organismus durch
enzymatischen Abbau nacheinander drei Metabolite entstehen, die vermutlich
alle an der antiischämischen Wirkung beteiligt sind. Im einzelnen handelt es
sich um die Pentaerithrity1tri-, di- und mononitrat. Wegen ihres unterschiedli
chen Wirkeintritts und einer verschieden langen Wirkdauer ergänzen sie sich
sinnvoll. Unter dem Aspekt des gesamttherapeutischen Effekts ziehen die
Muttersubstanz PETN und ihre drei Metabolite an einem Strang.
Die Metabolite 5
Die Phatmakokinetik von PETN
PETN selbst wird wegen seiner extrem hohen Lipophilie nach oraler Einnah
me entweder gar nicht oder in einem mit den z. Zt. zur Verfügung stehenden
analytischen Techniken nicht meßbarem Umfang aus dem Magen-/Darmtrakt
resorbiert. Durch unspezifische Esterasen im Darmepithel und in den Darm
bakterien erfolgt jedoch rasch die Abspaltung eines Salpetersäurerestes, wobei
das sehr gut resorbierbare Pentaerithrityl-trinitrat (Abk.: PE-Trinitrat) ent
steht. Bei oraler Gabe von 40 mg PETN beträgt der resorbierte Anteil etwa
50% (Davidson et al. , 1971). Offensichtlich bestimmt die Löslichkeit sehr
wesentlich das Ausmaß der Bioverfügbarkeit von PETN, da die relative
Bioverfügbarkeit einer Tablettenzubereitung (PentalongR) bei Vergleich mit
einer PETN-Lösung (50 mg PETN gelöst in Polyenthylenglycol 300; 2,5 mg
PETN/ml Endkonzentration) nur 50% beträgt (Hentschel und Haustein,
1985). Bereits innerhalb von Minuten nach oraler Applikation finden sich
meßbare Konzentrationen von PE-Tri nitrat im Plasma. Die klinische Wirkung
tritt zwischen der 30. und 45. Minute ein (Engelmann und Gottschild, 1981).
Das Maximum der Wirkung wird im Mittel nach 80 Min. erreicht (Abrams,
1983; Hentschel und Haustein, 1985; Engelmann et al., 1989). Nach der oralen
Gabe von 40 mg PETN beobachteten Amsterdam et al. (1980) 20 Min. nach
Einnahme eine signifikante Abnahme des links ventrikulären Füllungsdrucks.
Das Maximum wurde, beurteilt an diesem Parameter, nach 60 Minuten
erreicht. Der erwünschte hämodynamische Effekt hielt während der gesamten
Beobachtungsdauer von 4 Stunden unvermindert an.
Die Metabolite
Bei der Leberpassage und der Bioaktivierung in der Gefäßwand entsteht aus dem
Pentaerithrityltrinitrat als weiterer pharmakodynamisch wirksamer Metabolit
das Pentaerithrityl-dinitrat (Abk.: PE-Dinitrat). Auch dessen Wirkung setzt
beim Menschen rasch ein. Bereits 15 Min. nach Applikation wird im Plasma das
Maximum erreicht, was darauf schließen läßt, daß der Abbau vom Tri- zum
Dinitrat schnell erfolgt.
Aus dem PE-Dinitrat entsteht schließlich durch weitere Abspaltung eines
Salpetersäurerestes das Pentaerithrityl-mononitrat (Abk.: PE-Mononitrat). Hu
manpharmakologische Untersuchungen zeigen, daß dieses, beurteilt am Verlauf
der Plasmaspiegelzeitkurven, sehr lange bzw. am längsten von allen drei PE
Metaboliten im Plasma verweilt. Zwei Gründe sind hierfür verantwortlich.
Einerseits vergeht längere Zeit, bis es aus den Vorstufen gebildet wird,
andererseits erfolgt der enzymatische Abbau, vergleichbar den Verhältnissen bei
ISDN und IS-5-Mononitrat, viel langsamer als derjenige des PE-Trinitrats oder
des PE-Dinitrats. Meßbare Plasmaspiegel findet man daher weit über 15 Stunden
6 Pentaerithrityltetranitrat
nach oraler Applikation. Die Plasma-Eliminations-Halbwertszeit liegt zwischen
6,3 und 8,1 Std. (Neurath und Dünger, 1977). Das Maximum der renalen
Elimination von Pentaerithrity1-mononitrat findet sich nach Untersuchungen
der gleichen Autoren erst zwischen der 8. und 12. Stunde p. Applik. Insgesamt
lassen sich während der ersten 24 Std. ca. 20 % der verabreichten PETN-Dosis in
Form der Metabolite und des Pentaerithrits im Urin wiederauffinden.
Die enterohepatische Zirkulation
Besonders bemerkenswert und für die Kinetik Organischer Nitrate einmalig ist
die Beobachtung, daß sowohl PE-Dinitrat als auch PE-Mononitrat enterohepa
tisch rezirkulieren. Sie werden in Form ihrer Glukuronide biliär eliminiert und
aus dem Darm immer wieder rückresorbiert. Deshalb sind sie deutlich länger
wirksam als alle anderen bekannten Metabolite Organischer Nitrate. Auch
körpereigene Wirkstoffe wie die Geschlechtshormone unterliegen einem derarti
gen enterohepatischen Kreislauf und sind nur deshalb über viele Stunden
wirksam. Aufgrund der z. Zt. zur Verfügung stehenden klinisch-pharmakologi
schen Studien läßt sich keine exakte Aussage darüber machen, welchen
quantitativen Anteil die drei Metabolite des PETN an der Gesamtwitkung des
Pharmakon zu einem bestimmten Zeitpunkt haben. Man kann aber aufgrund
der hohen vasodilatatorischen Wirksamkeit am isolierten Gefäß davon ausge
hen, daß wesentliche Anteile der anti-ischämischen Langzeitwirkung von PE
Trinitrat und PE-Dinitrat ausgehen. Immerhin entspricht aber auch die
hämodynamische Wirksamkeit von PE-Mononitrat noch derjenigen des Isosor
bid-5-Mononitrates (Tabelle 2).
Tabelle 2 faßt die am isolierten Gefäßpräparat der Kaninchenaorta ermittelten
Konzentrationen zusammen, die für eine halbmaximale Relaxation (EC50)
erforderlich sind. Die Wirksamkeit von PETN und seiner Metabolite wurde mit
derjenigen von Glyceroltrinitrat und IS-5-mononitrat verglichen.
Tabelle 2. Vergleich der relaxierenden Wirkung ausgewählter Organischer Nitrate am
isolierten Gefäß
Organ. Nitrat ECso (nM)
PETN 5
PE-Trinitrat 10
Glyceroltrinitrat 11
PE-Dinitrat 300
PE-Mononitrat 10000
IS-5-Mononitrat 13000
NO-Freisetzung aus PETN 7
Danach ist die relative Wirkstärke von PE-Trinitrat am isolierten Gefäßstreifen
präparat mit der des Glyceroltrinitrats direkt vergleichbar. Die Wirkstärke von
PE-Mononitrat entspricht etwa derjenigen von IS-5-Mononitrat und diejenige
von PE-Dinitrat dürfte in etwa der von Isosorbiddinitrat entsprechen.
NO-Freisetzung aus PETN
Entsprechende Ergebnisse erhielten wir für die Geschwindigkeit, mit der PETN
und seine Metabolite unter geeigneten Versuchsbedingungen (in Gegenwart von
Cystein) in vitra Stickstoffmonoxid/NO freisetzt. Abbildung 1 faßt die mit der
Methämoglobin-Methode (Feelisch und Noack, 1987; Murphy und Noack,
1994) erhaltenen Werte zusammen. Dargestellt ist die NO-Bildungsrate in nM
pro Minute aus 100 j.tmolaren Pharmakalösungen. Die NO-Freisetzungsrate aus
PETN entspricht etwa derjenigen von Glyceroltrinitrat (62,8 bzw. 65,5 nM/
Min.). Die Aktivität von PE-Tri nitrat und PE-Dinitrat ist um den Faktor 3 bzw.
9 geringer. Aus zahlreichen Untersuchungen geht hervor, daß die NO-Bildung
direkt mit der Aktivierung des Zielenzyms Guanylatzyklase in der glatten
Muskelzelle korreliert. Dieses im Zytoplasma gelöste Enzym vermittelt die
Bildung von zyklischem GMP (cGMP), das dann als Second Messenger die
eigentliche Gefäßrelaxation vermittelt. Eine entsprechende Korrelation fanden
wir auch für PETN und seine Metabolite. Das Ergebnis ist in Abbildung 2
NO-Freisetzung aus PETN und seinen Metaboliten
80
70
Dohne L-Cystein
...... 60
c 1SS3. mit L-Cystein
150
:.Es
40
CI
§ 30
:2
CD 20
6
z 10
GTN PETN PETriN PEON PEMN
organisches Nitrat (0,1 mM)
Abb. 1. Geschwindigkeit der NO-Freisetzung aus PETN und seinen Metaboliten (jeweils
0,1 mM EK) im Vergleich zu Glyceroltrinitrat in Abwesenheit und Gegenwart von 5 mM
Cystein. Die NO-Bestimmung erfolgte mit der Methämoglobin-Methode (Noack et al.,
1992)