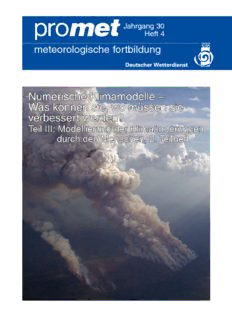Table Of ContentJahrgang 30
Heft 4
meteorologische fortbildung
Meteorologische Fortbildung
30.Jahrgang,Heft 4,2004
Thema des Heftes:
Herausgeber Numerische Klimamodelle - Was können sie,
Deutscher Wetterdienst
wo müssen sie verbessert werden?
Hauptschriftleiter Teil III:Modellierung der Klimaänderungen durch den Menschen,
Dr.H.D.Behr (Hamburg) 2.Teilheft
Fachliche Redaktion:H.Graßl,Hamburg
Redaktionsausschuss
Fachliche Durchsicht:C.-D.Schönwiese,Frankfurt a.M.
Dipl.-Met.U.Gärtner (Offenbach a.M.)
Prof.Dr.G.Adrian (Offenbach a.M.)
Prof.Dr.B.Brümmer (Hamburg) Kapitel Seite
Prof.Dr.J.Egger (München)
H.BARTELS,K.HOFIUS,B.KATZENBERGER,
Prof.Dr.F.Fiedler (Karlsruhe)
P.KRAHE,H.WEBER
Prof.Dr.G.Groß (Hannover)
27 Klima und Wasserwirtschaft 169-180
Dr.J.Neisser (Lindenberg)
Prof.Dr.C.-D.Schönwiese (Frankfurt a.M.) R.SAUSEN
Prof.Dr.P.Speth (Köln) 28 Luftverkehr und Klima 181-187
Prof.Dr.G.Tetzlaff (Leipzig)
L.BENGTSSON
Titelbild:Vegetationsfeuer und Klima 29 Natürliche und anthropogene Antriebe des Klima-
Aufgenommen von M. Welling (Max- systems und die Folgen in Klimamodellrechnungen
Planck-Institut für Chemie,Abt.Biogeo- für Vergangenheit und Zukunft 188-201
chemie,Mainz) im September 2002.
Brandrodung in Rondônia, Brasilien, M.HEIMANN
während der dortigen Trockenzeit. 30 Erste Kopplung von Modellen des Klimas und des
Diese Feuer in vielen Ländern sind Kohlenstoffkreislaufs 202-212
eine wesentliche Störung mehrerer glo-
K.G.HOOSS
baler Kreisläufe,sie sind ebenso wichtig
31 Modelle der globalen Umwelt und Gesellschaft 213-224
für den Klimaeinfluss des Menschen
wie Emissionen aus Ballungsräumen. H.GRAßL
Deutlich erkennbar ist die Verquickung 32 Reaktion der Weltöffentlichkeit auf Klimamodell-
mit dem Wasserkreislauf:Aus gezielten
ergebnisse 225-226
Vegetationsfeuern zur verbesserten
Landwirtschaft entstehen häufig kräfti- Blick nach draußen
ge Haufenwolken,gar Cumulonimben. Das Tschechische Hydrometeorologische Institut CHMI 227-231
Die Niederschlagsbildung wird in die-
sen rauchgeschwängerten Wolken ver- Institute stellen sich vor
zögert und Sonnenlicht erreicht den Das Institut für Meteorologie und Klimaforschung
Boden nur geschwächt. in Karlsruhe 232-235
Die große Herausforderung der Klima-
Ein neues Zentrum stellt sich vor
modellierung ist es,neben den natürli-
Das Zentrum für Marine und Atmosphärische
chen Vorgängen auch alle Facetten
menschlichen Handelns korrekt zu Wissenschaften (ZMAW) in Hamburg 236-237
beschreiben und ihre Wirkung vorher-
G.BUDÉUS
zusagen.
Langlebige Wirbel in der Grönlandsee 238-242
promet erscheint im Selbstverlag des J.JANSEN
Deutschen Wetterdienstes – Kaiserlei- Tropische(?) Zyklone über dem Südatlantik 243-245
straße 29/35,63067 Offenbach am Main.
Bezugspreis pro Jahrgang (4 Hefte) im C.LEFEBVRE
Abonnement 22,50 €,Einzelheft 6,50 €, Die Eisbedeckung in den russischen Gewässern des Nord-
Doppelheft 13,– €,Dreifachheft 19,50 € polarmeeres im Allgemeinen und 2002 zur Zeit der
zuzüglich MwSt.und Versandkosten. Durchsegelung der Nordostpassage von Arved Fuchs 246-253
Für den Inhalt der Arbeiten sind die
Buchbesprechungen 254-256
Autoren verantwortlich. Alle Rechte
bleiben vorbehalten. Habilitationen,Promotionen
und Diplom-Hauptprüfungen im Jahr 2003 257-260
Satz:
Elke Roßkamp Anschriften der Autoren dieses Heftes 261
Deutscher Wetterdienst,Hamburg
Kapitel der bisher erschienenen Ausgaben zum Thema
Druck:
Weppert Print & Media GmbH „Numerische Klimamodelle“ (Teil I-III,1.Teilheft) 262
97424 Schweinfurt
Bisher erschienene Ausgaben von promet 263
Silbersteinstraße 7
ISSN 0340-4552 Redaktionelle Hinweise für Autoren 264
promet, Jahrg.30, Nr.4, 169-180 (November 2004) 169
© Deutscher Wetterdienst 2004
H.BARTELS,K.HOFIUS,B.KATZENBERGER,P.KRAHE,H.WEBER
27
Klima und Wasserwirtschaft
1 Klima und Wasser aus globaler Sicht Durch die Verweilzeiten wird die potenzielle Gefähr-
dung der Wasservorkommen durch ein sich verändern-
Die essentielle Bedeutung des Vorhandenseins von des Klima deutlich.Das Wasser in der Atmosphäre hat
Wasser in allen drei thermodynamischen Phasen für die eine kurze Verweilzeit von Tagen:Jährlich fallen etwa
bisherige Entwicklung des Lebens auf der Erde sowie 600.000 km3 als Niederschlag aus.Eine Klimaverände-
für eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Ent- rung wird diesen Umsatz erhöhen oder die Verweilzeit
wicklung der Menschheit ist unbestritten.Auch in Zir- erniedrigen, vor allem polwärts von 30° Breite. Man
kulationsmodellen spielt Wasser sowohl für die globale nimmt an,dass eine mittlere globale Temperaturerhö-
Umverteilung der ozeanischen Wassermassen, ange- hung von etwa 3 K eine Intensivierung des atmosphäri-
trieben durch die thermohaline Zirkulation (GERDES schen Wasserkreislaufs von etwa 10% bewirkt.
et al.2003),als auch für den Wasserdampftransport in
der Troposphäre (RASCHKE und QUANTE 2002) die Die hohe Bedeutung der mit dem Wasserkreislauf ver-
entscheidende Rolle.Wasser ist die effektivste Energie- bundenen Bedrohung zeigen folgende Zahlen: Zwi-
senke in niederen Breiten,Transportmedium für Ener- schen 1991 und 2000 stieg die Anzahl der jährlich von
gie und Quelle gespeicherter Energie in höheren Brei- so genannten Naturkatastrophen betroffenen Men-
ten. Umfangreiche Messprogramme im Rahmen des schen von rund 150 Millionen auf mehr als 210 Millio-
World Ocean Circulation Experiments (WOCE) und nen.Von diesen Katastrophen waren 90 % wasserbe-
des Global Energy and Water Cycle Experiments dingt. Davon entfielen etwa 50 % auf Hochwasser,
(GEWEX), zweier Komponenten im Weltklimafor- 28 % auf durch Wasser übertragene Krankheiten und
schungsprogramm,haben in den letzten Jahren zur Ver- 11 % auf Dürren.Hochwasser verursachten 15 % und
besserung der Modelle des Wasserkreislaufs geführt. Dürren 42 % aller Todesfälle bei diesen Katastrophen
(UN-WWDR 2003). Maßnahmen zur Schadensredu-
Der Hydrologe wie auch der Wasserwirtschaftler be- zierung bei Hochwasser umfassen technische Bauwer-
fassen sich in der Regel nur mit einem kleinen Aus- ke wie Dämme und Deiche und ergänzend dazu Ana-
schnitt des globalen Wasser-Kreislaufs,nämlich demje- lysen und Vorhersagen des Ablaufs von Hochwasserer-
nigen Teil,der für die Kontinente relevant ist.Dennoch eignissen in Echtzeit,eine angepasste Flächennutzungs-
sind die Ergebnisse der globalen Modellierung als planung und Ausweisung von Flächen zur Wasserrück-
Randbedingungen für eine heute zumeist auf das Ein- haltung. In den letzten Jahrzehnten wurden die Drei-
zugsgebiet von Flüssen beschränkte Modellierung von monats- und Langzeitwettervorhersagen derart verbes-
ausschlaggebender Bedeutung. sert,dass das Wassermanagement und die Speicherbe-
wirtschaftung in den betroffenen Gebieten erleichtert
Wie Tab.27-1 zeigt,hat Süßwasser mit etwa 2,6 % nur worden sind (UN-WWDR 2003;WMO 2003a).Die ge-
einen geringen Anteil am globalen Wasservorkommen. nauen Auswirkungen von Klimaänderungen auf Was-
Das meiste davon, nämlich 2 %, sind im Polar- und servorkommen sind ungewiss. Jüngste Schätzungen
Meereis sowie in den Gletschern gebunden. Das für (UN-WWDR 2003) lassen jedoch darauf schließen,
den Menschen zur Verfügung stehende Wasser beträgt dass Klimaveränderungen trotz insgesamt höherer
somit höchstens 0,6 % der gesamten Wasservorkom- Niederschläge wesentlich für die Ausweitung der welt-
men auf der Erde.0,58% von diesen 0,6% sind Grund- weiten Wasserknappheit verantwortlich sein werden.
wasser und Bodenwasser, nur 0,02 % speichern Seen
und Flüsse und nur 0,001 % enthält die Atmosphäre. Für ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwi-
schen klimatischen und hydrologischen Prozessen tra-
Volumen (km³)Anteil in % Verweilzeit gen die drei Global Observing Systems, nämlich das
Weltmeere 1 348 000 000 97,39 2500Jahre Global Ocean Observing System (GOOS),das Global
Polareis,Meereis,Gletscher 27 820 000 2,01 9000Jahre Climate Observing System (GCOS) sowie das Global
Grundwasser, 8 062 000 0,58 1400Jahre Terrestrial Observing System (GTOS) und ferner das
Bodenfeuchte 1Jahr Global Terrestrial Network-Hydrology (GTN-H),eine
Seen, 225 000 0,02 17Jahre gemeinsame Einrichtung von GCOS und GTOS, we-
Flüsse 16Tage sentlich bei.Das Netzwerk umfasst sieben hydromete-
Atmosphäre 13 000 0,001 8Tage orologische und drei abgeleitete Variable. Auf der
Stauseen 8 000 <0,001 10Jahre jüngsten 19. Sitzung des IPCC wurde entschieden, in
den 4. bewertenden IPCC-Bericht einen Abschnitt
Tab.27-1: Menge und Verweilzeiten der Wasservorkommen.
Werte aus SHIKLOMANOV1997 und UN-WWDR über den Einfluss des Klimas auf die Wasservorkom-
2003. men aufzunehmen (WMO 2003b).
170 H.Bartels et al.:Klima und Wasserwirtschaft promet, Jahrg.30, Nr.4, 2004
Datenerhebung und Datenaustausch sind eine Voraus- • die Siedlungsentwässerung
setzung für die Entwicklung zuverlässiger Modelle. durch Auswirkungen auf die Bemessungskriterien
Die WMO hat durch zwei Resolutionen zu einem bzw.Sicherheiten der Entwässerungsnetze (hydrau-
freien und ungehinderten internationalen Austausch lische Überlastung) für den Fall zukünftiger intensi-
von meteorologischen (1995) und hydrologischen verer konvektiver Starkregen.
(1999) Daten beigetragen.Auch die Arbeiten und Pro-
dukte des Globalen Abflusszentrums [Global Runoff Die aus globalen Klimamodellen abgeleiteten Aussa-
Data Centre (GRDC)] bei der Bundesanstalt für Ge- gen zu künftigen Klimaveränderungen beziehen sich
wässerkunde in Koblenz,des Weltzentrums für Nieder- bisher im Wesentlichen auf großräumige Gebiete wie
schlagsklimatologie [Global Precipitation Climatology z.B.Nordeuropa.Belastbare Angaben über Änderun-
Centre (GPCC)] beim Deutschen Wetterdienst in Of- gen der hydrometeorologischen und hydrologischen
fenbach und des International Groundwater Assess- Größen und des Wasserhaushalts im regionalen Maß-
ment Centre (IGRAC) in Utrecht tragen erheblich zur stab liegen bislang kaum - zumindest noch nicht für
erfolgreichen Arbeit von internationalen Programmen Süddeutschland - vor. Gerade solche Erkenntnisse
und Projekten bei (STRIGEL et al.2004).Wegen der sind jedoch notwendig, um eine zukunftsorientierte,
starken räumlichen und zeitlichen Variabilität des Was- nachhaltige Wasserwirtschaftspolitik betreiben zu kön-
serdargebots und des unzureichenden Wassermanage- nen. Im großräumigen Bereich heben sich die Un-
ments befindet sich die Menschheit zu Beginn des 21. schärfen ein Stück weit auf.Es wird umso komplizier-
Jahrhunderts in einer Weltwasserkrise. Die wasserbe- ter, je räumlich differenziertere Aussagen gefordert
dingte Sterblichkeitsrate beträgt pro Jahr etwa 2 Milli- werden.Dies ist aber erforderlich,um handlungsorien-
onen Menschen.1 Milliarde Menschen sind nicht an ei- tiert vorgehen zu können.Die regionale Betrachtungs-
ne Wasserversorgung angeschlossen und mehr als 2 weise ist somit unumgänglich.
Milliarden leben ohne Abwasserentsorgung. Die vor-
ausgesagten weiteren Änderungen des Klimas werden Der spektakulärste Bereich, in dem die Wasserwirt-
die Wasserkrise zweifellos verschärfen. schaft betroffen sein kann,ist das Thema Hochwasser.
Aber auch das Gegenteil, das Niedrigwasser, ist von
Bedeutung. Es ist für die Binnenschifffahrt, die Nut-
2 Klima und regionale Wasserbewirtschaftung zung der Wasserkraft,die Nutzung als Kühlwasser für
die Wärme-Kraftwerke, oder unter dem Aspekt der
Aufgrund der engen Kopplung zwischen Klima und Wasserversorgung, der Grundwasserneubildung, der
Wasserhaushalt können Klimaveränderungen (z. B. Wasserbeschaffenheit und der Verfügbarkeit des Was-
verändertes Niederschlags- und Verdunstungsregime) sers zu beachten.Auch für den Gewässerschutz unter
erhebliche Auswirkungen auf oberirdische Abflüsse dem Gesichtspunkt des jeweiligen Abflussverhaltens,
und so mit Verzögerung auf das Grundwasser haben. der Temperaturverhältnisse und der Rückwirkung auf
Die Veränderung dieser Wasserhaushaltsgrößen Flora und Fauna und des Stoffhaushalts innerhalb der
wiederum hätte eine unmittelbare Auswirkung auf we- Gewässer, ist es von Bedeutung, sofern sich Wasser-
sentliche Teilbereiche der Wasserwirtschaft,z.B.auf mengen und deren Temperaturen ändern.
• den Hochwasserschutz
durch die Veränderung der Höhe,Dauer und Häu- Wasserwirtschaftliche Maßnahmen, die einer mög-
figkeit extremer Hochwasser und der damit einher- lichen Klimaveränderung begegnen,können erst dann
gehenden Erhöhung des Schadensrisikos, geplant und realisiert werden,wenn regionale und lo-
• die Wasserversorgung kale Daten über die wahrscheinliche zukünftige mete-
durch die Änderung der Grundwasserneubildung orologische und hydrologische Situation und deren
mit Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und Be- Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft (Hochwasser,
schaffenheit der Grundwasservorräte, Niedrigwasser, Stadtentwässerung, Grundwasserbe-
• den Gewässerschutz wirtschaftung, Gewässergüte, Gewässerökologie) vor-
durch die Änderung der jahreszeitlichen Abfluss- liegen.
und Temperaturverhältnisse mit Auswirkung auf
den Stoffhaushalt und die Beschaffenheit der Flüsse Es ist bisher schon eine grundlegende Aufgabe der
und Seen, Wasserwirtschaft, Maßnahmen - bezogen auf das aus
• die Gewässerentwicklung historischen Zeitreihen hydrometeorologischer und
durch die Änderung der Dynamik der Fließgewäs- hydrologischer Größen bekannte bisherige Spektrum
ser und Seen, ihrer morphologischen Verhältnisse, von Klimaschwankungen - zu bemessen und zu reali-
ihres Wärmehaushalts und ihrer Ökosysteme, sieren.Für den Fall der zusätzlichen,anthropogen be-
• die Bewirtschaftung der Gewässer dingten Klimaveränderung muss rechtzeitig geklärt
durch die Änderung insbesondere der Betriebs- werden, ob, wo, wie und wann Auswirkungen einer
weise der Hochwasser- und Trinkwasserspeicher, möglichen Klimaänderung in Bemessungsgrößen mit
der Wasserkraftnutzung, der Schiffbarkeit der Ge- einbezogen und entsprechende wasserwirtschaftliche
wässer und auch der landwirtschaftlichen Bewässe- Planungen erstellt bzw. Maßnahmen umgesetzt wer-
rung, den müssen.
promet, Jahrg.30, Nr.4, 2004 H.Bartels et al.:Klima und Wasserwirtschaft 171
3 Klimaveränderung und Konsequenzen für die Die bisherigen Arbeitsschwerpunkte des Vorhabens
Wasserwirtschaft - KLIWA KLIWA (1999 bis 2003) umfassen vor allem:
- die Ermittlung von Veränderungen in den Messzeit-
3.1 Ziele des Kooperationsvorhabens KLIWA reihen hydrometeorologischer und hydrologischer
Kenngrößen durch Analysen im Langzeitverhalten
Das Vorhaben „Klimaveränderung und Konsequenzen (z.T.mehr als 100 Jahre),
für die Wasserwirtschaft (KLIWA)“ wird in enger Zu- - verschiedene regionale Klimaszenarien zur Ab-
sammenarbeit zwischen dem Deutschen Wetterdienst schätzung möglicher zukünftiger Auswirkungen der
(DWD) und den Wasserwirtschaftsverwaltungen der Klimaveränderung auf den Wasserhaushalt, zum
Länder Baden-Württemberg (BW) und Bayern (BY) Vergleich untereinander und zur Einordnung in Re-
unter fachlicher Beteiligung der Bundesanstalt für Ge- lation zum bisherigen Langzeitverhalten und
wässerkunde (BfG) durchgeführt (Abb.27-1). - Klimaszenarien auf Wasserhaushaltsmodelle anzu-
wenden und zu bewerten.
Die Ziele von KLIWA sind:
- die bisherigen Veränderungen durch Untersuchun-
gen langer Messzeitreihen der Wasserhaushaltsgrö- 3.2 Ergebnisse aus dem Langzeitverhalten hydrome-
ßen in Süddeutschland nunmehr in hoher räum- teorologischer und hydrologischer Größen
licher und zeitlicher Auflösung zu erfassen,
- die Auswirkungen möglicher zukünftiger Klimaver- Im Gegensatz zu den punktförmig ermittelten hydro-
änderungen auf den Wasserhaushalt der Flussgebie- meteorologischen Größen ist die Abflussmessung als
te in Süddeutschland durch Klimaszenarien-Berech- ein Flächenintegral über einem Einzugsgebiet zu be-
nungen zu ermitteln bzw.abzuschätzen, trachten.Somit muss der räumlichen Übertragung der
- Veränderungen im Rahmen eines integrierten hydrometeorologischen Punktmessungen auf die jewei-
hydrometeorologisch-wasserwirtschaftlichen Mess- lige Fläche eine genaue zeitlich-räumliche Datenprü-
netzes zu überwachen und mit den Szenarien-Be- fung vorangehen,um mit Hilfe von Regionalisierungs-
rechnungen zu vergleichen sowie verfahren gebietsbezogene Werte oder Rasterwertver-
- wasserwirtschaftliche Handlungsempfehlungen - so- teilungen ermitteln zu können.Als Gebietswerte für 33
weit erforderlich - abzuleiten. hydrologisch orientierte Untersuchungsgebiete auf der
Basis von Rasterwerten liegen statistische Kennzahlen
Abb.27-1:Übersicht über die Projekt-Teilbereiche des Kooperationsvorhabens KLIWA,Stand:Dezember 2003.
172 H.Bartels et al.:Klima und Wasserwirtschaft promet, Jahrg.30, Nr.4, 2004
und Trendangaben der Lufttemperatur, des Nieder- Schneedeckendauer und eine Änderung in der
schlags und der Verdunstung vor (Abb.27-2).Die Er- Schneeschmelze.Man findet einen Rückgang der mitt-
gebnisse zum Langzeitverhalten der Starkniederschlä- leren Anzahl der Tage mit einer Schneedecke in tiefe-
ge und des Schneedeckenregimes sind als regionali- ren und mittleren Höhenlagen (unterhalb von etwa
sierte Punktverteilungen und als Rasterwerte verfüg- 800 m ü.NN) von bis zu 40%.Gleichzeitig nimmt der
bar.Da noch im Laufe des Jahres 2004 eine Reihe von Niederschlag sowohl im Gebietsmittel als auch in den
Abschlussberichten in der Schriftenreihe KLIWA er- stationsbezogenen Starkniederschlägen regionalspezi-
scheinen wird und zudem einige Kurzberichte bereits fisch im Winterhalbjahr zu.Ursache dafür sind intensi-
im Internet (unter www.kliwa.de) abrufbar sind,kann vere und länger anhaltende Niederschläge. Die Ge-
sich die Ergebniszusammenstellung auf die folgenden bietsniederschläge liefern bei nahezu gleich bleiben-
Aussagen für Süddeutschland beschränken. dem Jahresniederschlag deutliche Zunahmen im mete-
orologischen Winter und Frühjahr und gegenläufig da-
Die Jahresmitteltemperatur 1931 bis 2000 variiert in zu trockenere meteorologische Sommer. Die halb-
den Gebietswerten der 33 Untersuchungsgebiete Süd- jährlichen Höchstwerte der Starkniederschläge zeich-
deutschlands (Abb.27-2) zwischen 6,4 °C (Illergebiet) nen sich durch eine deutliche Zunahme (bis zu 35 %)
und 9,7 °C (Rhein zwischen Murg und Neckar); der und einer wachsenden Anzahl von Stationen mit
mittlere Jahresniederschlag zeigt Unterschiede in den Trendsignifikanz zu höheren Dauerstufen (von 1 bis 10
Gebietswerten von 720 mm/a (Main zwischen Regnitz Tagen) im hydrologischen Winterhalbjahr aus.Es sind
und Fränkische Saale) bis 1740 mm/a (Illergebiet). regionale Schwerpunkte am Schwarzwald und im
Nordosten Baden-Württembergs sowie in Franken
Entsprechend dem allgemeinen Trend für Mitteleuro- und Teilen des Bayerischen Waldes festzustellen. Zu-
pa ist in den Zeitreihen eine flächendeckende Zunah- sammen mit einem häufigeren Auf- und Abbau der
me der Lufttemperatur zu erkennen. Im Anstieg der Schneedecke in tieferen und mittleren Höhenlagen
Monatsmitteltemperatur ragt das hydrologische Win- wächst das Niederschlagsdargebot (Summe aus Regen
terhalbjahr (November bis April) und dort vor allem und Wasserabgabe aus der Schneedecke) an.
der Dezember mit regionsspezifischen Werten zwi-
schen 1,8 und 2,7 K/mon heraus. Die Temperaturzu- Im hydrologischen Sommerhalbjahr (Mai bis Ok-
nahme im Winterhalbjahr bedingt eine Abnahme der tober) dagegen sind nur geringe bis keine Trendände-
Abb.27-2:Untersuchungsgebiete (33) und KLIWA-Regionen (9) in Süddeutschland für die Berechnung von Gebietswerten zum Lang-
zeitverhalten hydrometeorologischer Parameter und für den Vergleich mit Klimaszenarien.
promet, Jahrg.30, Nr.4, 2004 H.Bartels et al.:Klima und Wasserwirtschaft 173
rungen zu beobachten: Tendenziell zeigen sich - mit Niveau einzuschwingen scheint.Diese Veränderungen
Ausnahme des Monats August - trockenere Sommer der Zirkulationstypen spiegeln sich deutlich im Lang-
mit nur einer geringen Zunahme der Lufttemperatur. zeitverhalten der Starkniederschläge wider.
Diese Veränderungen gehen mit einer Umstellung der Die erwähnten Änderungen der hydrometeorologi-
Zirkulationstypen etwa ab Mitte der 60er Jahre einher. schen Größen haben Auswirkungen auf das mittlere
Von besonderem Interesse ist dabei das bevorzugte Verhalten des Gebietswasserhaushalts. Während das
Auftreten von Starkniederschlagsereignissen bei be- Langzeitverhalten der Hochwasserabflüsse bei der
stimmten Zirkulationstypen. In den Abbildungen überwiegenden Anzahl der Pegel noch keine Verände-
27-3a und 27-3b ist daher die relative Häufigkeit von rung der Jahreshöchstabflüsse zeigt,lassen die Abfluss-
Zirkulationstypen bei Starkniederschlagsereignissen zeitreihen in den letzten 30 bis 40 Jahren regional eine
im zeitlichen Verlauf von 1931 bis 2000 aufgetragen.Es Zunahme der Hochwasserabflüsse erkennen.Die mitt-
ist deutlich zu erkennen,dass das Auftreten der jeweils leren monatlichen Hochwasserabflüsse sind im Win-
50 größten Starkniederschlagsereignisse (partielle Se- terhalbjahr ab den 70er Jahren höher als in der Zeit da-
rie) im Vergleich zur Gesamthäufigkeit dieser Wetter- vor (AK KLIWA 2002).Lediglich die Häufigkeit klei-
lagen in Süddeutschland während des hydrologischen nerer Hochwasser hat bevorzugt im Winterhalbjahr
Winterhalbjahrs sehr eng mit dem zonalen Zirkula- gebietsweise zugenommen.
tionstyp - vor allem den zyklonalen Westlagen - ver-
knüpft ist. Das Maximum der Kopplung wird in den Die klimatischen Bedingungen in Süddeutschland mit
60er bis 80er Jahren erreicht und pendelt sich daran Auswirkungen auf den gesamten Wasserhaushalt ha-
anschließend auf einem höheren Niveau ein.Im hydro- ben sich im vergangenen Jahrhundert - insbesondere
logischen Sommerhalbjahr dagegen ist ein Anstieg des während der letzten drei Jahrzehnte - erkennbar ver-
bevorzugten Auftretens von Starkniederschlägen bei ändert. Die Trends überschreiten regionalspezifisch
dem meridionalen Zirkulationstyp - vor allem bei den und interannuell die bisher aus langen Messzeitreihen
Großwetterlagen Trog über Westeuropa und Trog über bekannte natürliche Schwankungsbreite bei einigen
Mitteleuropa - ab den 70er Jahren zu verzeichnen,der Untersuchungsgrößen. Sie legen daher den Einfluss
sich ebenfalls ab den 90er Jahren auf einem höheren des Menschen auf das globale und regionale Klima na-
he, der in der internationalen Klimaforschung grund-
sätzlich nicht mehr in Frage gestellt wird.
(a)
Auch wenn die regionalen Änderungen noch nicht mit
sehr hoher statistischer Sicherheit der menschlich ver-
ursachten globalen Klimaveränderung zugeschrieben
werden können,deuten die Ergebnisse darauf hin,dass
sich das regionale Klima sehr wahrscheinlich auch in
der Zukunft weiter verändern wird.Allerdings beste-
hen in der Bewertung und Beurteilung über das Aus-
maß der zukünftigen regionalen Entwicklung noch er-
hebliche Unsicherheiten.
3.3 Vergleich von regionalen Klimaszenarien
(b)
Um eine Basis für die Ableitung wasserwirtschaftlicher
Handlungsstrategien schaffen zu können, ist es not-
wendig, mit Hilfe geeigneter regionaler Klimaszena-
rien rasch Aussagen über Veränderungen der hydro-
meteorologischen Größen im süddeutschen Raum für
den Planungshorizont der nächsten Jahrzehnte zu er-
halten.
Alle bis heute in Betracht kommenden regionalen Kli-
mamodelle und statistischen Verfahren weisen aus ver-
schiedenen Gründen Unsicherheiten auf und haben
Vor- und Nachteile,so dass eine zu bevorzugende Me-
thode nicht erkennbar ist.Erstes Ziel im Zuge der Er-
mittlung zukünftiger Klimaszenarien für das Vorhaben
Abb.27-3:Relative Häufigkeit von Zirkulationstypen bei Stark-
KLIWA musste daher sein, durch unterschiedliche
niederschlägen für das hydrologische Sommerhalb-
jahr (a) und Winterhalbjahr (b), Zeitraum 1931 bis Modelle und Methoden eine Bandbreite von Ergeb-
2000. nissen zu erhalten. Die jeweiligen Ergebnisse sollten
174 H.Bartels et al.:Klima und Wasserwirtschaft promet, Jahrg.30, Nr.4, 2004
durch entsprechende Vorgaben vergleichbar sein, um sind und relativ geringe Abweichungen bei der
sie vor dem Hintergrund des bisherigen Erkenntnis- Verifikation auftreten (GERSTENGARBE et al.
standes über das Langzeitverhalten hydrometeorologi- 2002).Nachteilig wirkt sich aus,dass die Verände-
scher Größen zu bewerten. Wie in Abschnitt 2 be- rungen von Wasserhaushaltsgrößen auf dem Kli-
schrieben,sind von den Niederschlagsänderungen vor ma der Vergangenheit basieren, so dass keine
allem diejenigen im hydrologischen Winterhalbjahr für neuen Extrema und Änderungen im Andauer-
den Hochwasserschutz besonders wichtig.Die Ergeb- verhalten simuliert werden können;Veränderun-
nisse der Klimaszenarien werden als Eingangsgrößen gen in den Zirkulationsmustern bleiben ebenfalls
für Wasserhaushaltsberechnungen verwendet.Sie um- zum Teil unberücksichtigt.
fassen folgende Größen: Niederschlag, Lufttempera- 2. Es werden die vom ECHAM4 prognostizierten
tur, relative Luftfeuchte, Luftdruck, Globalstrahlung (weniger sicheren) Zirkulationsmuster bzw.Wet-
oder Sonnenscheindauer und Windgeschwindigkeit. terlagen verwendet und über eine objektive Wet-
terlagenklassifikation statistisch mit den bis-
Die Vergleichbarkeit der Szenarien wurde durch fol- herigen Beobachtungen/Messungen verknüpft
gende Vorgaben erreicht: (ENKE 2003).
- Alle regionalen Modelle nutzen Ergebnisse des glo- Dabei können neue Extrema mit veränderter
balen Klimamodells ECHAM4 des Max-Planck-In- Dauer gefunden werden; die Verifikation zeigt
stituts für Meteorologie in Hamburg (MPI) für das geringe Abweichungen. Von Nachteil ist, dass
Emissionsszenario B2,weil letzteres eine eigenstän- großräumige Zirkulationsveränderungen, wie
dige europäische Umweltgesetzgebung und Um- z.B.die ausgeprägte Zunahme der Westwetterla-
weltpolitik zulässt. gen im ECHAM4,auch im regionalen Skalenbe-
- Die Güte der regionalen Simulationen wird durch reich verstärkt auftreten und somit die Nieder-
Vergleich mit und Anpassung an Mess- und Beob- schlagsverteilungen gleichen Wetterlagentyps
achtungsdaten von 1971 bis 2000 überprüft. Da- identisch sind.
durch werden die veränderten Bedingungen der 3. Es werden alle vom ECHAM4 prognostizierten
jüngsten Vergangenheit berücksichtigt. Im parallel und mit Unsicherheiten verbundenen Größen als
durchzuführenden Kontrolllauf wird der Einfluss Antrieb für das doppelt genestete regionale Kli-
des globalen Klimamodells (ECHAM4) für die glei- mamodell REMO (1/6 Grad) eingesetzt (JACOB
che Zeitreihe sichtbar. Mit Hilfe des Kontrolllaufs und BÜLOW 2003).
werden aber auch die Differenzen zum vorgesehe- Die dynamische regionale Klimamodellierung ist
nen Szenarienzeitraum bestimmbar,wodurch syste- das prinzipiell am besten geeignete Instrument
matische Fehler des ECHAM4 zum Teil ausge- zur Ermittlung zukünftigen Klimas,wobei zusätz-
glichen werden können. lich eine höhere zeitliche Auflösung möglich ist.
- Für den Zeitraum 1951 bis 2000 werden geprüfte lü- Die bisherigen Ergebnisse sind jedoch noch un-
ckenlose und homogenisierte Datensätze von rund befriedigend, weil eine Reihe ungelöster Fragen
75 Klimastationen und 450 Niederschlagsstationen weitere Entwicklungsarbeiten erforderlich ma-
bereitgestellt. chen; z. B. bei der verbesserten Simulation des
- Für die Verifikations- und Validierungsläufe werden Wasserkreislaufs sowie dessen Jahresgang und
statistische Kennzahlen zu den Mittel- und Extrem- interannuelle Variabilität in der Atmosphäre
werten sowie zum Andauerverhalten der oben ge- (Wasserdampf, Wolkenwasser) und am Boden
nannten hydrometeorologischen Größen festge- (Schnee,Bodenwasser,Grundwasser,Abfluss).
schrieben.
- Für den Vergleich der Regionalmodelle wird ein Die Punktergebnisse der beiden statistischen Verfahren
einheitlicher, in der näheren Zukunft liegender (PIK und Meteo-Research) zur Ermittlung von Klima-
Zeithorizont von 2021 bis 2050 festgelegt. szenarien für 2021 bis 2050 wurden in regionalisierte
- Die Ergebnisse der Modellrechnungen sind als Ta- Zeitreihen täglicher Werte für Rasterfelder umgerech-
geswerte bereitzustellen.Ausnahme ist die Model- net. Die Ergebnisse des regionalen dynamischen Mo-
lierung des MPI,die Stundenwerte liefern kann. dells (MPI) liegen als Zeitreihen stündlicher Werte in
Form von Rasterwertdateien (etwa 18 km x 18 km) vor.
Die ausgewählten Klimamodelle und statistischen Ver- Um diesen Unterschieden in den Ausgabedatensätzen
fahren unterscheiden sich in den vom Klimamodell der Klimaszenarien-Berechnungen sowie den darin
ECHAM4 benötigten Eingaben auf folgende Weise: enthaltenen Unsicherheiten Rechnung zu tragen,wur-
den einfache und robuste Verfahren zur Regionalisie-
1. Das statistische Downscaling nutzt nur die vom rung der Klimaszenarien gewählt.Zum Vergleich wur-
ECHAM4 prognostizierte (relativ sichere) Tem- den zunächst die in Abb.27-2 dargestellten - aus den 33
peraturverteilung und stellt einen Zusammen- Untersuchungsgebieten abgeleiteten und zusammen-
hang mit den bisherigen Beobachtungen und gefassten - neun KLIWA-Regionen für Süddeutsch-
Messungen her. land definiert und Mittelwerte der Temperatur und des
Der Vorteil besteht darin,dass die systematischen Niederschlags für 2021 bis 2050 von allen drei Model-
Fehler des ECHAM4 auf ein Minimum reduziert lierergruppen eingetragen und gegenübergestellt.
promet, Jahrg.30, Nr.4, 2004 H.Bartels et al.:Klima und Wasserwirtschaft 175
(a)
Wie aus den Untersuchungen zum
Langzeitverhalten der hydrometeo-
rologischen Größen hervorgeht,tre-
ten in den Jahren 1971 bis 2000 ne-
ben den positiven Temperaturver-
änderungen vor allem auch die
Niederschlagszunahmen im hydro-
logischen Winterhalbjahr hervor.
Dieser Trend setzt sich im hydrologi-
schen Winterhalbjahr bei mittleren
Zunahmen der Lufttemperatur zwi-
schen +1,0 und +2,0 K über Süd-
deutschland entsprechend den Mo-
dellberechnungen in der Zukunft in
unterschiedlichem Ausmaß fort.Die
Berechnungen des PIK (nur mit der
Leitgröße Lufttemperatur aus dem
(b)
globalen Modell) weisen gegenüber
dem heutigen Klima (1971 bis 2000)
fast keine Niederschlagsverände-
rungen auf.Sie liefern somit die un-
tere Grenze der Bandbreite (Abb.
27-4a).Mit der Leitgröße „Wetterla-
genklassifikation“ sind nach EN-
KE/Meteo-Research (2003) in Süd-
deutschland kräftige Niederschlags-
zunahmen zu erwarten (Abb.27-4b).
Das dynamische Downscaling des
MPI (mit dem Randantrieb durch
ECHAM4 bzw. REMO 1/2 Grad)
liegt im Mittelfeld (Abb.27-4c).Zu
berücksichtigen ist allerdings, dass
bei den beiden statistischen Verfah-
ren nur geringe Abweichungen im
Verifikationslauf zu beobachten
(c) sind, während beim dynamischen
Modell zwischen Kontrolllauf und
dem heutigem Klima bereits erhebli-
che Überschätzungen der winter-
lichen Niederschläge auftreten
(Abb.27-5).Die Überschätzung der
Winterniederschläge aus ECHAM4
kann demnach nur zum Teil durch
REMO (1/6 Grad) kompensiert
werden.
Im hydrologischen Sommerhalbjahr
erweitert sich die Bandbreite der
drei verschiedenen Modellergeb-
nisse erheblich.Die Ursachen liegen
in der hohen zeitlichen und räum-
lichen Variabilität konvektiver
Niederschläge.Diese führen sowohl
bei der Übertragung der Punktmes-
sungen eines Bodenniederschlags-
Abb.27-4:Vergleich der Ergebnisse aus Szenarien-Berechnungen - Differenz (in %)
messnetzes auf die Fläche zu erhöh-
zwischen Szenarium für 2021 bis 2050 und Messungen oder Kontrolllauf von
1971 bis 2000 für den Niederschlag im hydrologischen Winterhalbjahr von (a) ten Unsicherheiten bei der Erfas-
PIK,(b) Meteo-Research und (c) MPI. sung des heutigen Klimas und erst
176 H.Bartels et al.:Klima und Wasserwirtschaft promet, Jahrg.30, Nr.4, 2004
derungen sind wasserwirtschaftliche
Aufgaben.
4.2 Modelle des Wasserhaushalts
Zur Untersuchung der Folgen des
Klimawandels für Flussgebiete
Bayerns und Baden-Württembergs
sowie für das internationale Ein-
zugsgebiet des Rheins mit den im
Rahmen des Projekts KLIWA er-
stellten regionalen Klimaszenarien
kommen die national und interna-
tional anerkannten und erprobten
Wasserhaushaltsmodelle LARSIM
(BREMICKER 2000; EBEL et al.
2000) und ASGi (SCHULLA
Abb.27-5:Vergleich zwischen Kontrolllauf und gemessenem Niederschlag in den hyd- 1997;KLEEBERG et al.1999) so-
rologischen Winterhalbjahren 1971 bis 2000,MPI. wie das Niederschlag-Abfluss-Mo-
dell HBV-SMHI zum Einsatz
recht bei der Simulation von Klimaszenarien. Davon (BERGSTRÖM 1996).
betroffen sind sowohl statistische Verfahren als auch
die regionale dynamische Klimamodellierung.Bei letz- Für die gesamte Fläche Baden-Württembergs wurden
terer dürfte die bei einer Maschenweite von 1/6 Grad Wasserhaushaltsmodelle auf der Basis des Programm-
noch unzureichende Konvektionsparameterisierung systems LARSIM (Large Area Runoff Simulation Mo-
einen Einfluss haben. del) erstellt.Bei einem Flächenraster von 1 km x 1 km
werden die Prozesse Interzeption, Verdunstung,
Schneedeckenaufbau,-setzung und -schmelze,Boden-
4 Auswirkung der Klimaveränderungen auf den wasserspeicherung, horizontaler Wassertransport so-
Wasserhaushalt/Abfluss - Erste Ergebnisse aus wie Speicherung in Gerinnen und Seen beschrieben.
den KLIWA-Pilotprojekten
Das Modellsystem ASGi (Kontinuierlicher Abfluss-
4.1 Bedeutung der Wasserhaushaltsmodellierung und Stofftransport - integrierte Modellierung unter
Nutzung von GIS) basiert in seinem Modul „Wasser-
Die Modellierung der Wasserhaushaltskomponenten haushalt/Abfluss“ im Wesentlichen auf dem Modell
reale Verdunstung, Grundwasserneubildung, Boden- WASIM-ETH und wird in Bayern genutzt.Das Modell
feuchte, Wasseräquivalent der Schneedecke und HBV (Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning)
schließlich Abfluss hat in der operativen Hydrologie ist eine Entwicklung des SMHI (Swedish Meteorologi-
und Wasserwirtschaft in den letzten Jahren an Bedeu- cal and Hydrological Institute).Die hydrologische Be-
tung gewonnen.Bisher wurden für Bemessungsfragen rechnungseinheit bilden Teileinzugsgebiete, innerhalb
und den Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen die derer über eine Flächen-Höhen-Verteilung in Verbin-
entsprechenden hydrologischen Modelle meist für dung mit einer groben Landnutzungsunterteilung kli-
kleine (<500 km2, untere Mesoskala) bis mittelgroße matologische und landnutzungsbedingte Heteroge-
Einzugsgebiete (<5000 km2,obere Mesoskala) erstellt. nitäten, insbesondere zur Modellierung der Schnee-
Mittlerweile treten Untersuchungen zu den Folgen der prozesse berücksichtigt werden können.Es wurde ur-
großflächigen Veränderungen unserer Landschaft und sprünglich als ein auf Tageswertbasis arbeitendes
zu den Auswirkungen von Klimaveränderungen in den Langzeitsimulationsmodell entwickelt. Die Modell-
Vordergrund.Somit verstärkt sich auch die Forderung konzeption erlaubt aber auch Anwendungen des Mo-
nach der hydrologischen Modellierung großer Fluss- dells für kleinere Zeitschritte.
und Stromgebiete (>10000 km2,Makroskala).
Die hydrologische Modellierung einzelner Flussgebiete
Integriertes Flussgebietsmanagement heißt die Heraus- unter Verwendung der drei im Rahmen von KLIWA
forderung heute. Sie zielt auf die Verbesserung des entwickelten regionalen Klimaszenarien von PIK, von
Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge,aber Meteo-Research und dem MPI (s.Abschnitt 3.3) steht
auch der Sicherung des Wasserdargebots,insbesondere erst am Anfang. Hier soll deshalb nur die Vorgehens-
in Niedrigwasserzeiten, ab.Aber auch die Aufrechter- weise bei der Umsetzung der Ergebnisse regionaler Kli-
haltung der vielfältigen Nutzungen eines Gewässers,wie mamodelle mit hydrologischen Modellen dargestellt
z.B.der Wasser- und Energieversorgung,der Schifffahrt und die damit verbundenen Probleme erläutert werden.
sowie zur Gewährleistung ökologischer Mindestanfor- Die wesentlichen Wasserspeicher- und Wassertrans-
Description:Wissenschaften (ZMAW) in Hamburg. 236-237. G. BUDÉUS WMO, 2003a: Agrometeorology Related to Extreme Events,. WMO-No. 943, Genf, 137