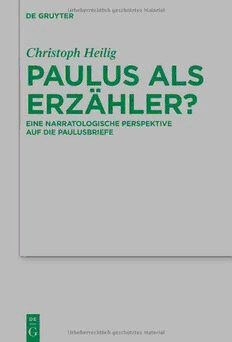Table Of ContentChristoph Heilig
Paulus als Erzähler?
Beihefte zur Zeitschrift
für die neutestamentliche
Wissenschaft
Herausgegeben von
Matthias Konradt, Judith Lieu, Laura Nasrallah,
Jens Schröter und Gregory E. Sterling
Band 237
Christoph Heilig
Paulus als
Erzähler?
Eine narratologische Perspektive auf die Paulusbriefe
Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung.
ISBN 978-3-11-066979-4
e-ISBN (PDF) 978-3-11-067069-1
e-ISBN (EPUB) 978-3-11-067073-8
ISSN 0171-6441
DOI https://doi.org/10.1515/9783110670691
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz. Weitere
Informationen finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Library of Congress Control Number: 2020934496
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio-
grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2020 Christoph Heilig, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Dieses Buch ist als Open-Access-Publikation verfügbar über www.degruyter.com.
Satz: Integra Software Services Pvt. Ltd.
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
www.degruyter.com
Meinen Eltern.
Weil meine Mutter immer am Lesen war und mein Vater so viele Geschichten
erzählte.
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde unter der Betreuung von Prof. Dr. Jörg Frey im
Rahmen eines von ihm geleiteten Forschungsprojekts des Schweizerischen Natio
nalfonds (SNF) erarbeitet und im September 2018 von der Theologischen Fakultät
der Universität Zürich aufgrund der Gutachten der Professoren Dr. Jörg Frey, Dr.
Samuel Vollenweider und Dr. Uta Poplutz (Wuppertal) mit der Bewertung summa
cum laude angenommen. Für die Publikation wurde die Arbeit aufgrund der Gut
achten sowie der Rückmeldung der Herausgeber von BZNW im Hinblick auf Glie
derung und sprachliche Darstellung überarbeitet und aktualisiert.
Dieses Buch ist sehr umfangreich. Eine so umfassende Aufarbeitung drängte
sich schon früh in der Beschäftigung mit dem Thema auf, als klar wurde, dass
die bisherigen Beiträge zum „narrative approach“ wichtige Grundlagen noch
gar nicht besprochen hatten. Das Vorgehen bestätigte sich im Laufe der Arbeit
dadurch, dass die erzielten Resultate ohne die grundsätzlichen Klärungen und
sorgfältigen empirischen Untersuchungen nicht möglich gewesen wären. Es ist
allerdings nicht unbedingt nötig, dass der Leser sich das Buch als Ganzes vor
nimmt. Je nach Interesse, mit welchem er oder sie an die Arbeit herantritt, bietet
sich eine unterschiedliche Auswahl an Kapiteln zur Lektüre an. Im Folgenden soll
der Aufbau kurz skizziert und dann einige Vorschläge für den gewinnbringenden
Umgang mit der Arbeit geboten werden.
Das Kapitel 1 nimmt zunächst die Skepsis gegenüber der Rede von Erzählun
gen in den Paulusbriefen in weiten Teilen der Forschung war und unterzieht diese
Position einer textlinguistisch basierten Kritik. Das Kapitel 2 wendet sich dann
dem „narrative approach“ um Richard B. Hays und N. T. Wright selbst zu und weist
nach, dass auch hier die theoretischen Grundlagen äußerst unbefriedigend sind.
Entgegen dem Eindruck, den diese Arbeiten vermitteln, sollte die Beschäftigung
mit deutlich als Erzählungen erkennbaren Textabschnitten den Ausgangspunkt
der Evaluierung des Ansatzes darstellen. Kapitel 3 (Beginn von Teil II) liefert
daher zunächst eine narratologische Definition des Konzepts der Erzählung.
Kapitel 4 bis 6 führen die Textgrammatik von Heinrich von Siebenthal ein und
explizieren die einzelnen Kriterien der Definition vor diesem Hintergrund. Dabei
wird auch bereits deutlich, von welchen Gestaltungsmitteln des Textes Paulus
beim Erzählen Gebrauch macht. Kapitel 7 konzentriert sich dann spezieller auf
die textgrammatische Ausgestaltung der temporalen Ordnung, eines zentralen
Elements von Narrativität. Kapitel 8 wendet sich dann pragmatischen Faktoren
des paulinischen Erzählens zu, wie sie an der textgrammatisch erhobenen propo
sitionalen Struktur der Erzählung selbst nicht ablesbar sind. Insbesondere
aufgrund von Hinweisen in den Kapitel 7 und 8 wird dann ab Kapitel 9 (Beginn
von Teil III) der Kategorie „impliziter“ Erzählungen nachgegangen. Nach einigen
Open Access. © 2020 Christoph Heilig, publiziert von De Gruyter. Dieses Werk ist lizenziert
unter der Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz.
https://doi.org/10.1515/9783110670691-202
VIII Vorwort
Grundlagen in diesem Kapitel werden in Kapitel 10 und 11 zwei Großkategorien
an Phänomenen des paulinischen Textes besprochen, die Zugang zu diesen „Pro
toerzählungen“ bieten könnten. Die Kapitel 12 bis 14 bieten dann (zusammen als
Teil IV) einen Überblick über die Bandbreite innerhalb dieser beiden Kategorien.
Ab Kapitel 15 (Beginn von Teil V) wird dann der Bogen zurück zu Hays und Wright
geschlagen. Nachdem zunächst die Beiträge der beiden Forscher aufeinander
bezogen und vor dem Hintergrund der Kategorie der „Protoerzählung“ eingeord
net werden, erfolgt in Kapitel 16 eine Evaluation der narrativen Substrukturen
(Hays) und in Kapitel 17 der weltanschaulichen Narrative (Wright).
Wer nun von den Arbeiten von Hays und Wright geprägt ist, sollte zusätzlich auf
jeden Fall die Kritik in Kapitel 2 wahrnehmen. Kapitel 3 und 4 verdeutlichen noch
weiter, was bisher im „narrative approach“ noch an Grundlagen fehlt. Die Kapitel 5
bis 8 führen zwar immer näher an die Position von Hays und Wright heran, enthal
ten zugleich aber zahlreiche Beobachtungen zum Text, die im klassischen „narra
tive approach“ nicht möglich gewesen wären. Für die direkte Bewertung ist dann
vor allem Kapitel 9 und speziell die Kritik in den Kapiteln 15 bis 17 wahrzunehmen.
Die dazwischen geschalteten Kapitel demonstrieren vor allem den grundsätzlichen
heuristischen Wert der Kategorie impliziter Erzählungen, welche für die hier ins
Auge gefasste Leserschaft aber vermutlich ohnehin unstrittig ist.
Wer andersherum dem „narrative approach“ und seinen weitreichenden The
sen bisher mit Skepsis begegnete, wird direkt in Kapitel 1 relevante Informati
onen zur Erwägung finden. Die Analyse der expliziten Erzählungen liefert das
empirische Fundament für die Evaluation der impliziten Erzählungen, muss aber
für das Verständnis nicht als Ganzes gelesen werden. Relevant ist natürlich dann
wieder Kapitel 9, wobei zumindest die auswertenden Abschnitte der Kapitel 7 und
8 auch empfohlen werden, da diese bereits die Verlagerung des Schwerpunktes
motivieren. Die Kapitel 10 und 11 sollten dann vor allem gelesen werden, falls
nach Kapitel 9 noch grundsätzliche Zweifel an der Relevanz der Kategorie der
impliziten Erzählungen bestehen. Ansonsten kann direkt zu Teil V (Kapitel 15 bis
17) der Arbeit und der direkten Auseinandersetzung mit Hays und Wright über
gegangen werden
Zu den restlichen Kapiteln gilt: Kapitel 3 ist nur dann essentiell für das Ver
ständnis, wenn dem Leser die eingeführten narratologischen Kategorien noch
unbekannt sind. Zumindest Abschnitt 3.4 liefert mit der Spezifizierung des in der
Arbeit zugrunde gelegten Konzepts der Erzählung jedoch ein wichtiges Funda
ment, das wahrgenommen werden sollte.
Das Kapitel 4 kann auch unabhängig von der hier verfolgten Fragestellung als
eigenständige Einführung in die Textgrammatik nach Heinrich von Siebenthal
gelesen werden. Es stellt meines Wissens die erste derartige Publikation dar und
Vorwort IX
es ist daher zu wünschen, dass dieses Kapitel auch für sich allein stehend wahr
genommen und genutzt werden wird. Dies gilt umso mehr, als dass die Kapitel 5
und 6 anhand der Großkategorie der Narrativität das Gemeinte explizieren sowie
Kapitel 7 eine ausführliche exemplarische Analyse der temporalen Konnexionen
vornimmt, die zudem in Kapitel 8 mit Erwägungen ergänzt wird, wie sie durch
den Fokus auf die Propositionalstruktur allein nicht möglich sind. Die Kapitel in
Teil II ab Kapitel 4 dürften daher – mit absteigender Relevanz – auch schlicht für
all diejenigen von Interesse sein, die sich mit dem Themenkomplex der Textgram
matik und deren Anwendung auf neutestamentliche Texte be schäftigen wollen.
Zuletzt ist noch auf die Kapitel 12 bis 14 einzugehen. Statt exegetischen Tiefen
bohrungen, wie sie zuvor exemplarisch in den Kapitel 10 und 11 geboten wurden,
wird hier die ganze Bandbreite der sprachlichen Phänomene beleuchtet, mit denen
in den Paulusbriefen „Fragmente“ von nur impliziten Protoerzählungen an die
Textoberfläche treten können. Diese sehr ausführliche Diskussion wird vor allem
denjenigen empfohlen, die nach Teil IV der Arbeit noch unsicher sind, ob die einge
führte Kategorie der Protoerzählung – trotz vielleicht anerkannter grundsätzlicher
Validität – tatsächlich so durchgehend an die Paulusbriefe herangetragen werden
kann. Daneben dürften die zahlreichen Beispiele und die Erläuterung der je unter
schiedlichen erzählerischen Wirkung vor allem für diejenigen von Interesse sein,
die sich für Details des paulinischen Protoerzählens interessieren – weil sie etwa
diese Aspekte in die eigene Arbeit integrieren wollen. Für diese Forscher/innen
bietet Teil V dieser Arbeit ein recht umfassendes Nachschlagewerk, was die pauli
nische Briefliteratur angeht, und zumindest ein recht feinmaschig aufgegliedertes
Raster für die Untersuchung anderer Texte im Neuen Testament.
Ganz grundsätzlich wird bei nur selektiver Lektüre empfohlen, zunächst das
Fazit als Ganzes zu lesen. Dieses deckt in Textfolge sämtliche zentralen Erkennt
nisse und Argumentationsschritte der Arbeit ab. Zudem habe ich versucht, dabei
nach Möglichkeit so zu formulieren, dass der Gedankengang auch ohne vorhe rige
Lektüre in den Grundzügen nachvollziehbar bleibt.
Auch an den Rändern der Kapitel werden immer wieder Verortungen im Hin
blick auf das Vorausgehende und Nachfolgende vorgenommen. Wer das Buch tat
sächlich in Gänze liest, kann diese Redundanzen überspringen und ist gebeten,
auch sonst Dopplungen zu verzeihen, wenn ein Konzept erneut eingeführt und
nicht schlicht auf die Diskussion an einer anderen Stelle im Buch verwiesen wird.
Mit dieser Option wurde allerdings sparsam umgegangen. Ansonsten wurden als
zusätzliche Orientier ungshilfe zahlreiche Querverweise in die Arbeit integriert,
welche das schnelle Auffinden relevanter Diskussionen ohne Rückgriff auf die
Register ermöglichen sollen. Im Stellenregister werden zudem durch Kursivsatz
Seiten hervorgehoben, auf denen die besagten Verse nicht nur (z.B. als Belegstel
X Vorwort
len für einzelne Lexeme) genannt, sondern auch besprochen werden. Teilweise
wurden mehrere Verse zusammen als Einheit angeführt. Verweise auf einzelne
Verse aus diesem Bereich wurden dann in der Regel unterlassen, sodass zusätz
lich zu den Angaben zum gesuchten Einzelvers auch nach den Seiten der grö
ßeren Einheiten zu schauen ist. Exegetische Diskussionen sind primär über das
Stellenregister zu erschließen. Das Sachregister soll demgegenüber vor allem
im Hinblick auf linguistische und narratologische Kategorien eine Hilfe bieten.
Durch die OpenAccessVersion der Arbeit kann diese zudem komplett nach
Stichworten durchsucht werden.
Das Projekt versteht sich dezidiert als inter und transdisziplinär. Natürlich
bleibt die Arbeit aber ganz grundsätzlich – und notgedrungen schon aufgrund
der Ausbildungsbiographie des Autors – eine exegetische. Es wurde aber zumin
dest der Versuch unternommen, nach Vermögen Narratologie und Textlinguistik
nicht als bloße Hilfswissenschaften in Beschlag zu nehmen. Vielmehr liegt dem
Vorgehen die Überzeugung zugrunde, dass der größte bibelwissenschaftliche
Nutzen genau dann erfolgen dürfte, wenn diese Disziplinen in ihrer Eigenstän
digkeit wahrgenommen werden und zu Wort kommen können – so gut dies durch
die Perspektive eines letztlich Fachfremden möglich ist. Andersherum ist Paulus
de facto als einer der „erfolgreichsten“ Erzähler der Geschichte zu betrachten.
Schon deshalb sind seine Texte auch für andere textwissenschaftliche Diszipli
nen von Interesse und es ist zu hoffen, dass die Annäherung aus narratologischer
und text linguistischer Perspektive durch die hier gebotenen Vorarbeiten erleich
tert wird. Um diesen Zugang so gut wie möglich zu gewährleisten, wurden bei
spielsweise auch nahezu alle griechischen Zitate ins Deutsche übersetzt.
Zu den Formalia: Schon da wegen des Themas von einem größeren Interesse
der englischsprachigen Forschung auszugehen ist, richtet sich die Zitierweise über
wiegend nach den international gebräuchlichen (dem Chicago Manual weitestge
hend folgenden) Vorgaben des SBL Handbook of Style in seiner 2. Auflage von 2014.1
Neben dem Verzicht auf die ausführliche Erstnennung wurden ledig lich kleinere
Anpassungen vorgenommen, die im Rahmen der deutschen Rechtschreibung not
wendig erschienen. Für diese wurde die DudenGrammatik in ihrer 9. Auflage von
2016 zugrunde gelegt (zitiert als „Duden“ gefolgt von der ParagraphenN ummer).
Was griechische Grammatiken und weitere Hilfsmittel angeht, die nur in Abkür
zung angeführt werden (und sofern diese nicht im SBL Handbook gelistet sind),
werden diese in der Bibliographie vor den Einträgen angeführt. Etablierte Zitier
weisen (etwa die Verweise auf Seiten und Abschnitte bei Schwyzer Debrunner)
1 Die in diesem Vorwort erwähnten Hilfsmittel sind in der Bibliographie mit weiteren Angaben
zur Publikation gelistet.