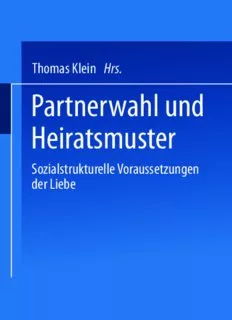Table Of ContentThomas Klein Hrs.
Partnerwahl und
Heiratsmuster
Sozialstrukturelle Voraussetzungen
der Liebe
Partnerwahl und Heiratsmuster
Sozialstrukturelle
Voraussetzungen der Liebe
Thomas Klein (Hrsg.)
Partnerwahl und
Heiratsmuster
Sozialstrukturelle
Voraussetzungen der Liebe
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2001
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier.
Die Deutsche Bibliothek-CJP-Einheitsaufnahme
ISBN 978-3-8100-2874-7 ISBN 978-3-663-11009-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-11009-5
© 2001 Springer Fachmedien Wiesbaden
Ursprünglich erschienen bei Leske + Budrich, Op1aden 2001
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro
verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort .................................................................................................................... 7
THEORETISCHE UND HISTORISCHE PERSPEKTIVEN
· Paul B. Hili, ]ohannes Kopp
Strukturelle Zwänge, partnerschaftliehe Anpassung oder Liebe-
einige Überlegungen zur Entstehung enger affektiver Beziehungen ........... 11
Bernhard Nauck
Generationenbeziehungen und Heiratsregimes - theoretische
Überlegungen zur Struktur von Heiratsmärkten und Partnerwahl-
prozessen am Beispiel der Türkei und Deutschland ....................................... 35
Sylvia Möhle
' Partnerwahl in historischer Perspektive ............................................................ 57
DIMENSIONEN DERPARTNERWAHL
J
os de Haan, Wi(fred Uu nk
Kulturelle Ähnlichkeiten zwischen Ehepaaren. Der Einfluss von
Partnerwahl, Restriktionen und gegenseitiger Beeinflussung ........................ 77
Wo!J:gang Riiffer
Bildungshomogamie im internationalen Vergleich -
die Bedeutung der Bildungsverteilung ............................................................... 99
Andrea Lengerer
Wo die Liebe hinfällt-ein Beitrag zur ,Geographie' der Partnerwahl ..... 133
Thomas Klein, Wo!J:gang Riiffer
Partnerwahl und Rauchgewohnheiten - Analysen zum Einfluss
sozialstrukturunabhängiger Mechanismen der Partnerwahl ....................... 163
5
-Axel Franzen, JosifHartmann
Die Partnerwahl zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Eine
empirische Studie zum Austausch von physischer Attraktivität
und sozialem Status ........................................................................................... 183
S tephanie Vetter
Partnerwahl und Nationalität. Heiratsbeziehungen zwischen
Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland .......................................... 207
Jür;gen Mimkes
Die familiale Integration von Zuwanderern und Konfessionsgruppen -
zur Bedeutung von Toleranz und Heiratsmarkt ........................................... 233
SPEZIELLE FRAGESTELLUNGEN
Thomas Klein, Andrea Lengerer
Gelegenheit macht Liebe-die Wege des Kennenlernens
und ihr Einfluss auf die Muster der Partnerwahl ......................................... 265
· Frank 0. Martin
Marriage Squeeze in Deutschland -
aktuelle Befunde auf Grundlage der amtlichen Statistik ............................. 287
Autorenverzeichnis ............................................................................................ 315
6
Vorwort
Die Partnerwahl ist ein allgegenwärtiges, aber dennoch wissenschaftlich und
vor allem soziologisch kaum untersuchtes Phänomen. Dem vorliegenden
Band sind langjährige soziologische Studien vorausgegangen, die zu dem
Projekt "Partnerwahl und Heiratsmuster" geführt haben, das seit 1999 von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird. Über die
ersten Ergebnisse der eigentlichen Projektarbeit hinaus beinhaltet das Buch
auch die Analysen einiger externer ,Kooperationspartner', die wichtige Bei
träge zur Erklärung des Partnerwahlverhaltens geleistet haben.
Wesentlichen Beitrag zu dem vorliegenden Band haben - nicht nur in
Bezug auf die substanziellen Beiträge, sondern auch in Bezug auf die for
male Gestaltung- die Projektmitarbeiter geleistet: Andrea Lengerer, Frank
0. Martin und Wolfgang Rüffer, die die oft nicht einfachen Typoskripte und
noch schwierigeren Grafiken in die vorliegende Form gebracht haben.
Heidelberg, im September 2000
Thomas Klein
7
THEORETISCHE UND HISTORISCHE
PERSPEKTIVEN
Strukturelle Zwänge, partnerschaftliehe Anpassung oder
Liebe- einige Überlegungen zur Entstehung enger
affektiver Beziehungen
Paul B. Hilf, ]ohannes Kopp
Es gibt wohl nur wenige Lebensbereiche, denen subjektiv eine größere Be
deutung zugeschrieben wird als den affektiven Sozialbindungen, wie sie in
Liebesbeziehungen, nichtehelichen und ehelichen Gemeinschaften gelebt
werden. Die ungeheure Fülle journalistischer Ratgeber, die sich in allen
Medien findet, signalisiert die große Neugierde oder Betroffenheit, auf die
das Thema im Alltag trifft. Undtrotz des großen Angebotes an Beziehungs
weisheiten bleibt die wichtige Frage, wie man die Richtige oder den
Richtigen wählt und wie man dann glücklich wird, im Kern zumeist unbe
antwortet, denn in diesen Angelegenheiten entscheidet nach der Alltags
philosophie etwas rational kaum Fassbares: die Liebe. Sie bringt die Akteure
zusammen und sie gehorcht offensichtlich keinen Regelmäßigkeiten. Wo die
Liebe hinfallt ist jede Konstellation möglich, keine ausgeschlossen.
Betrachtet man hingegen die sozialwissenschaftliche Fachdiskussion,
dann ergibt sich sehr schnell und nachhaltig ein gänzlich anderes Bild. Eine
Fülle von Studien zeigt, dass die Prozesse der Partnerwahl keinesfalls zufillig
sind - ganz im Gegenteil: 1 Gerade die Analyse moderner Heiratsmuster
ergibt, dass sich in den letzten Jahrzehnten kein Rückgang der sozialen
Strukturierung finden lässt, wie es in der Diskussion um die Individualisie
rung moderner Gesellschaften proklamiert wird. So weisen kohortenspe
zifische Analysen nach, dass mehr als zwei Drittel der nach dem zweiten
1 An dieser Stelle soll gar nicht versucht werden, die große Zahl der hier erwähnenswerten Sm
dien vollständig aufzuführen. Als klassischer Beleg sei aber etwa auf die Arbeit von Bossard (1932)
hingewiesen. Neuere Analysen für die Bundesrepublik finden sich bei Teckenberg (2000) oder Wirth
(2000), die jeweils auch eine Fülle an weiterführenden Hinweisen enthalten. Schon bei einem kurzen
Blick in diese Texte wird jedoch ein Grundproblem derartiger Arbeiten klar: Fast immer werden
Ehen oder höchstens langanhaltende Partnerschaften untersucht (vgl. auch Blossfeld/Timm 1997).
Eine Analyse über Partnerschaften generell, also ganz unabhängig von ihrer Dauerhaftigkeit, bieten
diese Untersuchungen jedoch nicht. In diesem Bereich fmden sich zwar verschiedene, eher in der
Psychologie und Sozialpsychologie anzusiedelnde Srudien (vgl. hierzu ausführlicher unter Punkt 1) ,
diese erheben aber nicht den Anspruch, weiterführende und auch deskriptive Aussagen zu erlauben.
Dieses Problem soll jedoch nicht überschätzt werden: Soziologisch bedeutsam sind ja auch vor
allem die Partnerschaften, die eine gewisse Stabilität aufweisen. Aus diesem Grunde wird im Folgen
den auch vor allem über diese Fälle gesprochen und eigentlich müsste im Titel der Begriff "Entste
hung" durch "Entstehung und Aufrechterhalrung" ersetzt werden.
11
Weltkrieg geborenen Frauen eine hinsichtlich des Bildungsniveaus horna
game Ehe eingehen (vgl. Blossfeld/Timm 1997: 445).2
Heiratsmuster und die Strukturiertheit der Partnerwahl stellen aber nicht
nur aufgrund der subjektiven Wichtigkeit ein soziologisch interessantes
Phänomen dar: Schon bei Max Weber (1980: 179) ist die Eheschließung
innerhalb bestimmter Kreise eines der wichtigsten Anzeichen einer ständi
schen Lage und der damit einhergehenden sozialen Schließung. Wenn Ehen
eben nicht unbesehen der sozialen Position, sondern entlang bestimmbarer
und bedeutsamer sozialer Dimensionen geschlossen werden, perpetuieren
sich soziale Ungleichheiten und es verfestigt sich die soziale Struktur einer
Gesellschaft. Eheschließungen über die Grenzen bestimmter Statusgruppen
hinweg sind und waren lange Zeit eine der sichersten Möglichkeiten zur
vertikalen Mobilität - und dies vor allem für Frauen, denen andere Wege,
etwa über die berufliche Qualifikation, lange Zeit strukturell partiell ver
schlossen waren.
Der Charakter einer Gesellschaft bestimmt sich zu einem nicht unwe
sentlichen Teil aus derartigen Mobilitätsmöglichkeiten beziehungsweise
strukturellen Verharrungstendenzen und sozialen Ungleichheitsstrukturen.
Die Soziologie sollte schon aus diesem Grunde ein großes Interesse an den
Prozessen haben, die die Partnerwahl beeinflussen. Ein Blick auf die sozio
logischen Klassiker zeigt, dass dieser Gedanke nicht neu ist. Beispielhaft sei
auf die Arbeit von Claude Levi-Strauss (1981) über den Frauentausch hin
gewiesen: Neben seines Beitrages zur Überwindung des Inzuchtproblems
dient der Frauentausch zwischen den einzelnen Stämmen vor allem dazu,
soziale Integration zu erzeugen (Levi-Strauss 1981: 94ff.). Die Partnerwahl
wird hier durch die kollektiven (Stammes-) Interessen bestimmt und nicht
durch die Motive der einzelnen Frauen und Männer.
In der Zwischenzeit finden sich derartig arrangierte Ehen - zumindest in
modernen Gesellschaften - wohl nur noch selten und sind gesellschaftlich
auch nicht anerkannt. Der Grund einer Verbindung sollte heute vor allem
Liebe und weniger der Statuserhalt der Herkunftsfamilie sein. Wenn nun
aber Partnerschaften und Ehen auf Liebe und Zuneigung basieren, stellt sich
erst recht die Frage, warum sie unter diesen Bedingungen sozial strukturiert
sind - und dies gegenwärtig sogar stärker als zu früheren Zeiten. Dabei
2 Die Homogarnie lässt sich selbstverständlich für verschiedene, sozial relevante Merkmale be
rechnen. Üblicherweise werden hier etwa die Gleichheit hinsichtlich der sozialen Herkunft, der
Ethnie oder der Religion untersucht. Zwar hängen die konkreten Ergebnisse sehr stark von der
Anzahl und Breite der gewählten Kategorien ab, zusammenfassend ftnden sich aber in vielen Berei
chen starke Hornagamietendenzen (vgl. für weitere Hinweise die in der ersten Anmerkung genann
ten Überblicksarbeiten sowie die weiteren Beiträge in diesem Band).
12
Description:Die Wahl des Lebenspartners: Eine vermeintlich ganz private Angelegenheit, die allenfalls psychologisch zugänglich erscheint? Analysen zeigen, dass die Partnerwahl nur auf den ersten Blick höchst privat und individuell ist. Tatsächlich folgt sie nämlich sozialen Regelmäßigkeiten: Weit überzuf