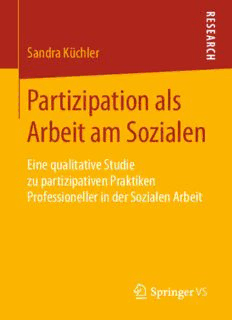Table Of ContentSandra Küchler
Partizipation als
Arbeit am Sozialen
Eine qualitative Studie
zu partizipativen Praktiken
Professioneller in der Sozialen Arbeit
Partizipation als Arbeit am Sozialen
Sandra Küchler
Partizipation als
Arbeit am Sozialen
Eine qualitative Studie
zu partizipativen Praktiken
Professioneller in der Sozialen Arbeit
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Timm Kunstreich
und Prof. Dr. Joachim Schroeder
Sandra Küchler
Hamburg, Deutschland
Dieses Buch wurde als Dissertation an der Universität Hamburg, Fakultät Erziehungs-
wissenschaft, im Oktober 2016 unter dem Titel: „Partizipation als Arbeit am Sozialen.
Eine qualitative Studie Partizipativer Praktiken Professioneller der Sozialen Arbeit am
Beispiel der sozialräumlichen Hilfen und Angebote in einem Hamburger Stadtteil“
eingereicht.
Gefördert wurde diese Dissertation von der Hans-Böckler-Stiftung
ISBN 978-3-658-20829-5 ISBN 978-3-658-20830-1 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-20830-1
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH und ist Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Geleitwort
Partizipative Arbeit am Begriff
Das Besondere und Ungewöhnliche dieser Arbeit ist der mutige und erfolgreiche
Versuch der Autorin, eine deutliche Differenz zu den eher auf Norm, Abwei-
chung und soziale Probleme orientierten dominierenden Ansätzen in der Sozia-
len Arbeit zu markieren. In Rezeption von kultursoziologischen, ethnomethodo-
logischen und institutionskritischen Konzepten und auf Basis einer eigensinnigen
Adaption von Texten des französischen Poststrukturalisten Gilles Deleuze ver-
fremdet Sandra Küchler gewohnte Sichtweisen, um so auch Eigenes neu wahr-
zunehmen. Dabei steht im Mittelpunkt ihres Interesses professionelles Handeln
und zwar solches, das versucht, Kooperation an die Stelle von Konkurrenz zu
setzen.
Diese theoretische Grundlegung knüpft an Einsichten der Partizipationsfor-
schung an und versteht professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit als anti-
nomische Handlungsanforderungen. Erkenntnisleitend ist dabei weniger, weitere
Begründungen für die Notwendigkeit partizipativen Handelns in einem professi-
onellen Feld zu liefern, sondern zu untersuchen, welche Techniken und Prakti-
ken die befragten Sozialarbeiterinnen einsetzen, um selbst zu partizipieren. In
den sich wiederholenden Handlungen von Professionellen in bestimmten Kräfte-
verhältnissen wird eine „generative Grammatik“ herausgearbeitet, in der sich das
implizite Wissen, die Anwendung und die „kluge Kombination“ solcher „Tech-
niken und Praktiken“ zeigen.
Diese entschlüsselt Sandra Küchler in drei Durchgängen durch ihr empiri-
sches Material, und sie ordnet es einem Kontinuum „misslingender“ bis „wirk-
lich gelungener“ Partizipation zu, wobei letzteres als eines jener seltenen „Mo-
mente“ verstanden wird, in dem SozialarbeiterInnen und AdressatInnen „ge-
meinsame“ Lösungsmöglichkeiten finden und umsetzen. Was genau in solchen
Momenten passiert und wie diese befördert werden können, wird ausführlich be-
schrieben, analysiert und handlungsorientierend interpretiert. Auf diese Weise
gelingt es, ein methodologisches und methodisches Design zu entwickeln, das
„Partizipation als Methode“ betrachtet. Damit – so die Autorin – „verabschiede
ich mich von dem Gedanken, dass erziehungswissenschaftliche Professionsfor-
schung zwangsläufig Evaluierungsforschung sein muss“. Statt „Verbesserungs-
forschung“, die Praxis in „vermeintlicher Objektivität“ bewertet, wird in kultur-
VI Geleitwort
wissenschaftlich inspirierter Alltagsforschung deutlich gemacht, dass die Ent-
schlüsselung dieses Alltags mehr braucht als nur Messinstrumente.
Im Aufbau gleicht die Arbeit zunächst einem klassischen Forschungsbe-
richt. Dann aber geschieht etwas Ungewöhnliches: Sandra Küchler schildert, wie
sie scheitert. In einem Workshop kam es weder zu einer intensiven Diskussion
von Thesen noch zu einer gemeinsamen Verständigung über Partizipation. Nicht
nur die Teilnehmerinnen waren enttäuscht, sondern auch die Forscherin. Diese
beginnt nun mit Bezug auf „Deleuze als Methode“ (Engelhardt) die Analyse ih-
res Scheiterns. Dabei arbeitet sie am Material heraus, dass sie die tatsächlichen
Differenzen zwischen den einzelnen Projekten zugunsten einer normativen Ver-
einheitlichung negiert hat.
Mit der – zunächst gewöhnungsbedürftigen – Terminologie von Deleuze
analysiert die Autorin im Folgenden die verschiedenen Komponenten schöpferi-
scher Wahrnehmung und der daraus entstehenden Praxis des Neuen. „Minoritär
werden“, das Verlassen der Ordnung als „Bruch“, „Verrat“ an dieser Ordnung
sind die Bezugspunkte in Darstellung und Analyse der jeweiligen Besonderhei-
ten der untersuchten Projekte. Diese drei Begriffe markieren die zentralen Pra-
xen, die zu scharfen und fundamentalen Ausschließungen in der bürgerlichen
Gesellschaft führen. Diese kontrafaktisch als Elemente des Widerstands und des
Neuen zu setzen, schließt an fundamentale Aspekte der kritischen Theorie an,
vor allem an die Notwendigkeit des Nicht-Identischen bzw. an die Ideologie des
Identischen als „falschem“ Bewusstsein. In der eindimensionalen Rationalität
werden die Grenzen der Kritik und damit auch der Ausschließung bzw. des Op-
ponierens gegen Ausschließungstendenzen deutlich. Erst mit der gleichberech-
tigten Einbeziehung von Emotionen wie Leidenschaft, Angst und Wut, aber auch
Neugier und Kreativität wird Widerstand genauso wie das Erproben von Neuem
möglich.
In dieser theoretischen Rahmung kann Forschung gar nicht anders als mit
einem „partizipativen“ Anspruch angelegt sein. Sandra Küchler bezieht Ansätze
der Situationsanalyse aus der Anthropologie (Geertz), der Evaluationstheorie
(Guba/Lincoln), der Gruppenanalyse (Bohnsack) sowie der Visualisierung
(Clarke) auf die Begrifflichkeit nach Deleuze. Dabei wird die Forschung selbst
zum Gegenstand der Untersuchung, denn im Reden von Professionellen über
partizipative Praktiken werden die verschiedenen Verständnisweisen zu Partizi-
pation freigelegt. Neue Verständnisweisen aber können eben nur in partizipati-
ven Prozessen selbst evoziert werden.
Eine besondere Note erhält die Studie dadurch, dass es Sandra Küchler ge-
lingt, eine originelle Variante des pädagogischen Urproblems vom Verhältnis
zwischen „Erzieher und Zögling“ herauszuarbeiten. Dieses Verhältnis tritt hier in
Gestalt der Relation der Forscherin zu den von ihr „Beforschten“ auf, denn es ist
Partizipative Arbeit am Begriff VII
das explizite Ziel der Forscherin, die Praxis ihres Erhebungsprozesses partizipa-
tiv zu gestalten. Das wird ihr in unterschiedlicher Weise möglich, vor allem aber
durch „Takt“, durch eine „zugewandte Freundlichkeit“ zu den „Beforschten“, die
taktvoll und respektierend ist, denn die Deutungshorizonte aller Beteiligten sind
gleichwertig, aber different. Dadurch erreicht die Autorin so etwas wie die „Auf-
hebung“ der Differenz zu den Interviewpartnerinnen: Aufgehoben im Sinne von
aufbewahrt bleibt die Differenz in allen Praxismomenten, in denen die Autorin
die Situation arrangiert und bestimmt. Aufgehoben in der Bedeutung, dass die
Differenz nicht mehr existiert, ist das Verhältnis zugleich in derselben Situation:
Die sich engagiert unterhaltenden Teilnehmerinnen kümmern sich nicht um die
Autorin/Moderatorin. Diese steht etwas hilflos daneben und ist unsicher, was sie
tun soll – und erlebt sich als nicht-zugehörig, also im doppelten Sinne als
„gleich-gültig“. Durch dieses Erlebnis wird die Relation zwischen beiden Seiten
auf eine neue Stufe gehoben, die Teilnehmerinnen bilden eine neue Gruppe zur
weiteren Bearbeitung ihre Projekte. Das Relationsbild eines Schöpfungsprozes-
ses wird damit zu einem anschaulichen Gegenstand einer „gemeinsamen Aufga-
benbewältigung“ als Aufhebung der Erzieher-Zögling-Hierarchie. Dieses Relati-
onsbild öffnet vergleichbare Perspektiven auf alle sozialpädagogischen Hand-
lungssituationen.
Die Untersuchung erschließt sowohl für die Soziale Arbeit, als auch für die sozi-
alpädagogische Praxis- und Professionalisierungsdebatte mit einer theoretischen
Fundierung der Kategorie „Partizipative Praktiken“ eine innovative Forschungs-
perspektive. Sandra Küchler löst überdies in beeindruckender Weise ihren an
sich selbst gestellten Anspruch einer partizipativen Forschung in den Handlungs-
feldern sozialer Problembearbeitung ein. Die Messlatte für künftige Studien liegt
nun sehr hoch.
Hamburg, im Oktober 2017
Timm Kunstreich, Joachim Schroeder
Vorwort
Die vorliegende Veröffentlichung ist meine im November 2016 an der Universi-
tät in Hamburg eingereichte und verteidigte Dissertation. Nach mehreren Jahren
Sozialer Arbeit in der Familiären Krisenhilfe bei ADEBAR in Hamburg Altona
habe ich mit Hilfe eines Stipendiums der Hans-Böckler-Stiftung promoviert. So
konnte ich meiner Fragestellung nachgehen, was diese Sternstunden der Sozialen
Arbeit auszeichnet, in denen Ideen sich erweitern, Hindernisse gemeinsam über-
wunden werden und etwas Neues entsteht. Wissenschaftliche Fragestellungen
sind immer auch biographisch geprägt wie Timm Kunstreich (2005a, S. 49) fest-
stellt. Folge ich dieser einen roten Faden ziehenden Blickrichtung, kann ich mei-
ne persönliche und wissenschaftliche Suchbewegung in der Frage formulieren:
Wie entsteht Neues? Diese Frage stellt sich mir nicht nur auf persönlicher, politi-
scher Ebene, sondern auch im Bezug auf Soziale Arbeit. Wie kann diese Welt zu
einem Ort der Gleichberechtigung für alle werden? Kann und wenn ja wie der
pädagogische Grundwiderspruch zwischen Hilfe und Kontrolle, das doppelte
Mandat situativ überwunden werden? Und was ist mein Anteil an der Reproduk-
tion des Bestehenden? Was genau passiert eigentlich in den Momenten, in denen
Neues im Begriff ist zu entstehen?
Diese Fragestellung habe ich in meiner Dissertation beantwortet, die auch
ein ‚Bildungsbericht‘ wurde, in der das Scheitern in der Herstellung einer ‚ge-
meinsamen Aufgabenbewältigung‘ ebenso nachvollzogen werden kann wie de-
ren Gelingen.
Dabei bin ich den Fallen der Repräsentation begegnet, die uns wie in ‚Fes-
seln‘ an das Bestehende ketten und mit bestem Wissen und Gewissen argumen-
tieren, überzeugen und beeinflussen, die aber immer in einem Fürsorge-Zögling
oder Lehrer – Schüler Verhältnis verharren und Potentiale gemeinsamer Enste-
hungsprozesse verhindern.
Den Enstehungsprozess von etwas Neuem konnte ich mit Begriffen von De-
leuze konkretisieren und mit Hilfe meiner eigenen Erfahrungen im Forschungs-
prozesssowie am Material der Mitarbeiter_innen ausdifferenzieren. Die Begriffe
‚Minoritär Werden‘, ‚Bruch‘, ‚Verrat’und ‚Schöpfung‘ sind nicht mehr nur theo-
retische Begriffe, die ich an die Praxis der Sozialen Arbeit angelegt habe, son-
dern sie wurden auch zu einem methodischen Werkszeug, das ich selbst anwen-
den kann und das im besten Falle auch Sozialarbeiter_innen darin unterstützt, ih-
X Vorwort
re Praktiken zu reflektieren und häufiger das Experiment gemeinsamer Aufga-
benbewältigungen zu wagen.
Schöpfungsprozesse sind dabei nicht die genialen Erkenntnisse einzelner,
sondern zähe Bewegungen gegen erstarrte und geordnete Wiklichkeiten.
Wie ich am Ende meiner Dissertation herausarbeitet habe, ist Partizipation
ein Relationsmuster zwischen der normativen Reproduktion des Bestehenden auf
der einen Seite und Partizipation als Schöpfungsprozess auf der anderen. Dabei
kommt es auf die Qualität der Gefüge an, in denen sich Neues realisieren und ak-
tualisieren kann.
Während des Schreibens meiner Dissertation hatte ich ein sehr unter-
stüztendes, stärkendes, vertrauensvolles Gefüge, aus dem ich einige namentlich
erwähnen möchte. Allen voran die Praktiker_innen der SHA-Projekte sowie die
Leitungsmitarbeiter_innen und die gesamten Teilnehmer_innen des Sozialraum-
projektes in Hamburg Eimsbüttel III. Ihnen allen gilt mein besonderer Dank, da
ohne sie diese Dissertation und meine Erkenntnisse nicht zustande gekommen
wären! Prof. Dr. Timm Kunstreich, der nicht nur bei allen Fragen jederzeit an-
sprechbar war, sondern der auch zu einem Freund wurde. Prof. Dr. Joachim
Schroeder, der mich obwohl er mich nicht kannte mich als Doktorantin ange-
nommen hat, das Experiment eingegangen ist und mich ebenfalls sehr anregend,
affizierend und weitertreibend beraten hat. Sowie Lion, Jules und Daniel, die
mich ebenfalls inspirierend ermutigt haben, weiter zu gehen. Theo Bruhns und
Clarissa Küchler, die das Lektorat und die Grafiken erstellt haben, möchte ich
danken ebenso wie der Hans-Böckler-Stiftung, die mir über das Bereitstellen der
finanziellen Möglichkeiten diese Arbeit erst ermöglicht hat.
Des Weiteren möchte ich mich bei meinen ‚alten‘ (und bleibenden) Freun-
den aus meiner Zeit in Freiburg bedanken, die mich Deleuze lieben gelehrt ha-
ben, weil „man weiß niemals im voraus, wie jemand lernen wird – durch welche
Liebschaften man gut in Latein wird (...) in welchen Wörterbüchern man denken
lernt“ (Deleuze, Guattari 1992, S. 213). Mit Deleuze habe ich verstanden, dass es
nicht darum geht, Dingen auf den Grund zu gehen, „(d)enn das Unbewusste
muss geschaffen und nicht wiedergefunden werden“ (ebd., S. 387).
Sandra Küchler
Inhalt
Geleitwort: Partizipative Arbeit am Begriff .................................................... V
Vorwort .............................................................................................................. IX
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ........................................................... XV
1 Einleitung und zentrale Fragestellung ........................................................ 1
2 Methodischer Rahmen: Von Geertz zu Deleuze ......................................... 9
2.1 Fourth Generation Evaluation als Aushandlungsprozess ...................... 15
2.2 Situationsanalyse zur Skizzierung der Differenzen ............................... 16
2.3 Dokumentarische Methode zur Rekonstruktion von Abläufen ............. 18
2.4 Methodisches Vorgehen: eine Triangulation ......................................... 19
3 Lokale und zeitliche Situierung des Forschungsfeldes ............................. 23
3.1 Das Sozialraumprojekt .......................................................................... 24
3.2 Sozialräumliche Hilfen und Angebote – die Globalrichtlinie in
Hamburg ................................................................................................ 30
3.3 Die Umsetzung – SHA in Eidelstedt und Stellingen ............................. 32
3.4 Acht Interviews zu gelungenen bzw. weniger gelungenen
partizipativen Situationen in SHA ......................................................... 33
3.5 Formulierende Interpretationen der Interviews ..................................... 35
4 Zusammenfassung der Interviews in Thesen ............................................ 55
4.1 „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...“ ........................................... 56
4.2 Das gemeinsame Dritte als Abgrenzung zum Einverständnis ............... 58
Description:Sandra Küchler widmet sich der Frage, welche Techniken und Praktiken die von ihr befragten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter einsetzen, um selbst zu partizipieren. Aus dem empirischen Material hat sie ein Instrumentarium entwickelt, dass das „Minoritär Werden“, den „Bruch“, den „Ver