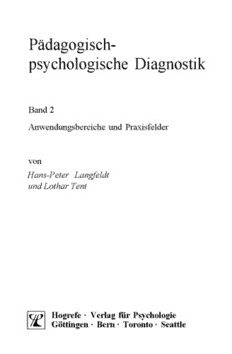Table Of ContentPädagogisch-
psychologische Diagnostik
Band 2
Anwendungsbereiche und Praxisfelder
von
Hans-Peter Langfeldt
und Lothar Tent
Hogrefe Verlag für Psychologie
l
Göttingen Bern Toronto Seattle
l l l
Prof. Dr. Hans-Peter Langfeldt, geb. 1943. 1965 Staatsexamen zum Lehramt an Volksschulen,
1971 Diplom-Psychologe Marburg, 1977 Promotion Köln/Bonn, 1983 Habilitation im Fach
Pädagogische Psychologie Marburg. Ab 1971 Tätigkeit in verschiedenen Funktionen an der
Pädagogischen Hochschule Heidelberg und an der Pädagogischen Hochschule Rheinland. 1987-
1990 Lehrstuhlvertreter und Professor in Würzburg. Seit 1991 Professor am Institut für
Pädagogische Psychologie der Universität Frankfurt am Main.
Prof. Dr. Lothar Tent, geb. 1928. 1948-1952 Lehramtsstudium, 1952-1960 Lehrer. 1958
Diplom-Psychologe, 1962 Promotion. 1962-1968 Wissenschaftlicher Assistent an der Univer-
sität Marburg. 1968 Habilitation im Fach Psychologie. 1968/69 Professur für Pädagogische
Psychologie an der Universität Gießen. 1969 Professur für Sonderpädagogik an der Universität
Marburg. Seit 1973 Professor am Fachbereich Psychologie der Universität Marburg. Seit 1993
emeritiert.
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Pädagogisch-psychologische Diagnostik.-
Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe, Verl. für Psychologie
Bd. 2. Anwendungsbereiche und Praxisfelder/
Hans-Peter Langfeldt; Lothar Tent.- 1999
ISBN 3-8017-0406-8
0 by Hogrefe-Verlag, Göttingen · Bern · Toronto · Seattle 1999
Rohnsweg 25, D-37085 Göttingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts-
gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfil-
mungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Druck: Dieterichsche Universitätsbuchdruckerei
W. Fr. Kaestner GmbH & Co. KG, D-37124 Göttingen-Rosdorf
Printed in Germany
Auf säurefreiem Papier gedruckt
ISBN 3-8017-0406-8
Vorwort
Aus verschiedenen Gründen erscheint Band 2 der Pädagogisch-psychologischen Dia-
gnostik später als ursprünglich vorgesehen. Ingeborg Stelzl, Koautorin des ersten
Bandes, ist ausgeschieden, weil sie ihrem eigentlichen Interessenschwerpunkt den
Vorrang geben mußte. An ihre und zugleich an die erste Stelle ist Hans-Peter
Langfeldt getreten.
Band 1 behandelt in drei Teilen grundlegende Annahmen und Definitionen der
professionellen Diagnostik, wichtige testtheoretische Modelle sowie pädagogische,
berufsethische und rechtliche Rahmenbedingungen der diagnostischen Praxis. Dieser
Praxis wendet sich der vorliegende Band in erster Linie zu, allerdings ohne das theo-
retische und methodische Fundament zu vernachlässigen. Er ist also kein Rezept-
buch, d.h. er enthält keine Gebrauchsanweisung, z.B. wie eine Untersuchung von
Schulanfängern, Lernbehinderten oder Hochbegabten im einzelnen durchzuführen ist.
Vielmehr erfährt der Leser, auf welchen Annahmen solche Untersuchungen beruhen,
was bei ihrer Durchführung zu beachten ist, welche Verfahren dafür - exemplarisch -
zur Verfügung stehen und welche Forschungsergebnisse für die Fragestellung be-
langvoll sind.
Wie Band 1 soll der zweite Band vor allem Studierenden der Psychologie und der
Pädagogik im zweiten Studienabschnitt diagnostisches Fachwissen und Problembe-
wußtsein vermitteln. Er setzt Grundkenntnisse in der Diagnostik voraus und kann
zusammen mit einer solchen Basis der Prüfungsvorbereitung dienen. Obwohl der
vorliegende Band auf dem ersten aufbaut und häufig darauf verweist, können die
Vorkenntnisse natürlich auch auf anderem Wege erworben sein. Beide Bände bilden
zwar eine Einheit, sind aber voneinander unabhängig zu benutzen. Auch im zweiten
Band haben wir uns bemüht, die Pädagogisch-psychologische Diagnostik als Pars pro
toto zu behandeln, d.h. an ihr die allgemeinen Probleme und Prinzipien der diagno-
stischen Praxis beispielhaft zu verdeutlichen.
Wir denken, daß der Band zugleich Praktikern entgegenkommt, die daran interes-
siert sind, ihre Kenntnisse aufzufrischen oder sich neu zu orientieren. Nach einer
Erhebung von Schorr (1995) nimmt die Diagnostik bei den pädagogisch-psycho-
logisch tätigen Kollegen etwa ein Drittel ihrer Gesamttätigkeit ein. Davon entfallen
auf das explorative Gespräch 49 % und jeweils 23% auf die Verhaltensbeobachtung
und die Testanwendung. Die Diagnostik insgesamt hat also nach wie vor einen hohen
praktischen Stellenwert.
Die Gliederung des Bandes folgt einer einfachen Systematik. An die Rekapitulati-
on einiger Grundlagen diagnostischen Handelns und die Charakterisierung des dia-
gnostischen Prozesses bis zum Abfassen von Gutachten (Teil 1) schließen sich die
Informationsquellen an, die dem Diagnostiker zu Gebote stehen, eine Auswahl spezi-
eller Tests und Fragebogen eingeschlossen (Teil II). Die beiden folgenden Teile sind
den besonderen pädagogisch-psychologischen Fragestellungen gewidmet, die diagno-
stische Entscheidungshilfen erfordern, sei es im Zusammenhang mit Schullaufbahn
und Ausbildung (Teil III), sei es bei individuellem Interventionsbedarf (Teil IV). Der
abschließende Teil V ist der Erörterung aktueller Probleme der Pädagogisch-psycho-
6 Vorwort
logischen Diagnostik vorbehalten. Dabei haben wir darauf verzichtet, unproduktive
Scheinkontroversen wie die zur Förder- versus Selektionsdiagnostik oder Status-
versus Prozeßdiagnostik fortzuführen, und beschränken uns auf kurze Anmerkungen
dazu.
Teil 1 sowie die Abschnitte 4.1 und 17 sind überwiegend von Lothar Tent, alle üb-
rigen vorwiegend von Hans-Peter Langfeldt verfaßt. Wie bei Band 1 wird der Inhalt
des vorliegenden Bandes von beiden Autoren gemeinsam vertreten. Der fachkundige
Leser wird das eine oder andere vermissen. So kommen sozialpsychologische Mode-
ratorvariablen wie Klassen-, Schul- oder Familienklima bei unserer Systematik nur
randständig vor. Der erste Band hat, soviel wir wissen, eine insgesamt positive Reso-
nanz gefunden. Das wünschen wir uns - trotz möglicher Schwächen - auch für die
überfällige Fortsetzung. Kritische Rückmeldungen nehmen wir gleichwohl gern ent-
gegen.
Bei den geschlechtstypischen Personenbezeichnungen haben wir die umständliche
Verdoppelung zumeist vermieden und statt dessen hier und da zwischen den Ge-
schlechtem gewechselt. Mit Psychologen sind immer auch Psychologinnen gemeint,
mit Lehrerinnen auch Lehrer usw. Mit Kindern gibt es ohnehin kein Problem.
Besonderer Dank gilt unserer Frankfurter Mitarbeiterin Frau Gisela Stöckel für die
kompetente Herstellung der Druckvorlage und Herrn Dr. Michael Vogtmeier vom
Verlag für seine beharrliche Geduld.
Frankfurt/Main und Marburg, im Juli 1998 Hans-Peter Langfeldt Lothar Tent
Inhaltsverzeichnis
Teil I Grundlagen und Ablauf diagnostischen Handelns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Funktion und Nutzen der Pädagogisch-psychologischen Diagnostik.... 13
1.1 Die Aufgaben der Pädagogisch-psychologischen Diagnostik...................... 13
1.2 Zur Nützlichkeit Pädagogisch-psychologischer Diagnostik......................... 16
1.2.1 Diagnostische Entscheidungen..................................................................... 17
1.2.2 Grundsätze der Nutzenbestimmung ............................................................ .20
2. Die diagnostische Situation ....................................................................... .25
2.1 Interaktion und Kommunikation................................................................. .25
2.2 Die Gestaltung der diagnostischen Situation.. ............................................. .27
3. Derdiagnostische Prozeß.......................................................................... .33
3.1 Einige Vorbemerkungen............................................................................... 33
3.1.1 ZurTerminologie.. ....................................................................................... .33
3.1.2 Zur Praxeologie diagnostischen Handelns .................................................. .34
3.2 DerUntersuchungsablauf............................................................................ .35
3.3 Die diagnostische Urteilsbildung ................................................................. 39
3.4 Psychodiagnostische Gutachten ................................................................... 44
3.4.1 Richtlinien und Regeln für die Abfassung.................................................. .44
3.4.2 Mustergutachten .......................................................................................... .51
Zusammenfassung und Literaturempfehlungen zu Teil I.......................................... .65
Teil II Diagnostische Informationsquellen ................................................... .69
4. Zensuren und Zeugnisse als diagnostische Information .........................71
4.1 Notengebung................................................................................................. 71
4.1.1 Funktion........................................................................................................ 71
4.1.2 Notenskalen .................................................................................................. 73
4.1.3 Empirische Eigenschaften........................................................................... .74
4.2 Verbale Beurteilungen.. ................................................................................ 77
4.3 Implizite Persönlichkeitstheorien von Lehrpersonen.................................. .82
5. Tests zur Beschreibung des Schulleistungsstandes:
Schulleistungstests ...................................................................................... 85
5.1 Weingartener Grundwortschatz Rechtschreib-Test
für dritte und vierte Klassen (WRT3+) ........................................................ 86
5.2 Schulleistungstest Deutsch für vierte Klassen (CT-D4).............................. .87
5.3 Diagnose- und Förderblätter, Rechenfertigkeiten ......................................... 88
8 Inhaltsverzeichnis
6. Beispiele pädagogisch relevanter Tests und Fragebögen...................... .91
6.1 Adaptives Intelligenz-Diagnostikum (AID)................................................. 91
6.2 Lerntestbatterie “Schlußfolgerndes Denken” (LTS).................................... . 96
6.3 Testreihe zur Prüfung der Konzentrationsfähigkeit (TPK).......................... 98
6.4 Persönlichkeitsfragebogen für Kinder zwischen 9 und 14 Jahren
(PFK 9-14) ................................................................................................. 100
7. Diagnostische Gesprächsformen: Anamnese und Exploration........... 103
7.1 Grundlagen und Fehlermöglichkeiten........................................................ 103
7.2 Durchführungshilfen.................................................................................. 106
8. Beobachten und Beschreiben.................................................................. 109
8.1 Definition ................................................................................................... 109
8.2 Verbal-Systeme zur Beschreibung von Verhalten ..................................... 110
8.3 Nominal-Systeme: Index- und Kategorien-Systeme.................................. 111
8.4 Dimensional-Systeme.. ............................................................................... 114
8.5 Beobachtungstendenzen............................................................................. 116
9. Projektive Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Zusammenfassung und Literaturempfehlungen zu Teil II...................................... . .... 119
Teil III Pädagogisch-psychologische Diagnostik bei
Schullaufbahnentscheidungen ........................................................... 123
10. Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ......................................... 125
10.1 Institutionelle Rahmenbedingungen.. ......................................................... 125
10.2 Charakteristika selektiver Laufbahnentscheidungen.................................. 127
10.2.1 Prognosen als Voraussetzung..................................................................... 127
10.2.2 Effizienz..................................................................................................... 129
11. Einschulung .............................................................................................. 135
11.1 Das Konstrukt “Schulreife”........................................................................ 135
11.2 Schulreifetests ............................................................................................ 139
11.3 Diagnostische Entscheidungen und ihre Folgen........................................ 144
11.4 Diagnostische Praxis.................................................................................. 146
11.4.1 Vorzeitige Einschulung .............................................................................. 146
11.4.2 Zurückstellung.. .......................................................................................... 148
12. Umschulung in die Sonderschule für Lernbehinderte ........................ 151
12.1 Vorbemerkung: Behinderung und Schulsystem.. ....................................... 151
12.2 Das Konstrukt “Lernbehinderung”............................................................. 154
12.3 Schulische Rahmenbedingungen.. .............................................................. 156
Inhaltsverzeichnis 9
12.4 Validität der Diagnose “lernbehindert” ...................................................... 157
12.4.1 Konstruktvalidität....................................................................................... 157
12.4.2 Diagnostische Entscheidungen und ihre Folgen......................................... 158
12.5 Diagnostische Praxis .................................................................................. 159
13. Übertritt in die Sekundarstufe I ..................................................... 161
13.1 Das Konstrukt “Eignung” ........................................................................... 161
13.2 Diagnostische Entscheidungen und ihre Folgen......................................... 163
13.3 Diagnostische Praxis .................................................................................. 165
14. Hochschulzugang .................................................................................... 169
14.1 Medizinstudium als Beispiel ...................................................................... 169
14.2 Der Test für medizinische Studiengänge: Inhalt und
prognostische Validität.. ............................................................................. 170
14.3 Diagnostische Entscheidungen undihreFolgen......................................... 171
15. Berufsberatung, Personalauswahl und Berufsausbildung ................ 175
15.1 Berufsberatung und Personalauswahl: Gemeinsamkeiten
undUnterschiede.. ...................................................................................... 175
15.2 Berufsausbildung.. ...................................................................................... 177
Zusammenfassung und Literaturempfehlungen für Teil III ...................................... 178
Teil IV Pädagogisch-psychologische Diagnostik bei
individueller Intervention .................................................................. 181
16. Geltungsbereiche Pädagogisch-psychologischer Diagnostik im
Rahmen individueller Intervention ........................................................ 183
16.1 Pädagogisch-psychologische Diagnostik als Teil der
Erziehungsberatung .................................................................................... 183
16.2 Grenzbereiche Pädgogisch-psychologischer Diagnostik............................ 185
17. Hochbegabungsdiagnostik ..................................................................... 189
17.1 Zum Stand der psychologischen Hochbegabungsforschung
in Deutschland............................................................................................ 189
17.2 Zur Theorie der Hochbegabung.................................................................. 190
17.3 Die Identifizierung Hochbegabter .............................................................. 193
18. Diagnostik von Lernstörungen .............................................................. 199
18.1 Definitionen und Konzepte ........................................................................ 199
18.2 Diagnostik von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (Legasthenie) ........... 201
18.3 Rechenschwierigkeiten (Dyskalkulie) ....................................................... 209
10 Inhaltsverzeichnis
19. Diagnostik von Verhaltensstörungen..................................................... 217
19.1 Definitionen und Konzepte....................................................................... .217
19.2 Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen..................................... .220
19.3 Aggressivität und dissoziales Verhalten.................................................... 227
19.4 Angst und Ängstlichkeit............................................................................ .233
Zusammenfassung undLiteraturempfehlungen zu TeilIV..................................... .237
Teil V Aktuelle Entwicklungen und Desiderate ........................................ 241
20. Computergestützte Diagnostik................................................................ 243
20.1 Definition und Anwendungsprinzipien...................................................... 243
20.2 Itemdarbietung und Itementwicklung ....................................................... .245
20.3 Implementierung “neuer” Testkonzepte.. .................................................. .245
20.4 Steuerung des diagnostischen Prozesses.................................................... 246
21. Evaluation in Schule und Hochschule.................................................... 249
21.1 Gegenstande der Evaluation....................................................................... 249
21.2 Evaluation von Unterricht in Schulen........................................................ 250
21.2.1 Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler .................................................. 250
21.2.2 Lehrfähigkeit der Lehrenden...................................................................... 251
21.3 Evaluation der Lehrean Hochschulen....................................................... .252
22. Pädagogisch-psychologische Diagnostik zwischen Stagnation
und Fortschritt ......................................................................................... 255
22.1 Zwischenbilanz .......................................................................................... 255
22.2 Perspektiven............................................................................................... 256
Zusammenfassung und Literaturempfehlungen zu Teil V ....................................... 260
Literaturverzeichnis ............................................................................................. 261
Verzeichnis der Testabkürzungen........................................................................ 289
Autorenregister ..................................................................................................... 291
Sachregister ........................................................................................................... 298
Anhang: Inhaltsverzeichnis von Band 1 .............................................................. 306
Anhang: Stichwortverzeichnis ausBand 1 .......................................................... 309
Teil I
Grundlagen und Ablauf diagnostischen Handelns
1. Wozu braucht man Pädagogisch-psychologische Diagnostik?
2. Was heißt Klassifikation, und wie kommen diagnostische Entscheidungen zu-
stande?
3. Läßt sich der Nutzen Pädagogisch-psychologischer Diagnostik berechnen?
4. Welche sozialpsychologischen Prozesse bestimmen die diagnostische Situation,
und was ist bei der Kontaktgestaltung zu beachten?
5. Was heißt diagnostischer Prozeß, und worauf stützt sich diagnostisches Han-
deln?
6. Wie laufen diagnostische Untersuchungen ab, und wie werden diagnostische
Urteile gebildet?
7. Wie teilt man die Ergebnisse mit?
Vorstrukturierende Lesehilfe
Im ersten Band (Tent & Stelzl, 1993) ging es um die begriffliche Klärung dessen,
was Diagnostik ist und bewirken soll, um ihre testtheoretischen Grundlagen sowie
um pädagogische, berufsethische und rechtliche Rahmenbedingungen für ihre An-
wendung. In diesem Band steht die diagnostische Praxis im Vordergrund. Teil I be-
faßt sich nach einem Rückgriff auf die Ziele der Pädagogisch-psychologischen Dia-
gnostik mit entscheidungstheoretischen und sozialpsychologischen Aspekten sowie
mit Vorgaben für die Gestaltung diagnostischer Untersuchungen von der Ausgangs-
frage bis zur Abfassung von Gutachten.
Die praktische Diagnostik wird als zweckrationales problemlösendes Handeln be-
trachtet, das wie das pädagogische Handeln dem Optimierungsgebot folgt. Sie trägt
zur Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit pädagogischer Entscheidungen bei. Ihre
Effizienz ist auch eine Frage der Kosten-Nutzen-Relation. Diagnostische Untersu-
chungen bestehen aus einer Abfolge von Interaktions- und Kommunikationsprozes-
sen. Eine Reihe theoretisch, empirisch oder rechtlich begründeter Verhaltensregeln
für den Diagnostiker soll ein möglichst hohes Maß an Objektivität gewahrleisten. Die
Regeln beziehen sich auf den Umgang mit dem Probanden, auf die Abfolge der
Handlungsschritte, auf die Urteilsbildung sowie auf die Vermittlung der Untersu-
chungsergebnisse. Den Schluß bilden Auszüge aus zwei Beispielgutachten.
1. Funktion und Nutzen der Pädagogisch-
psychologischen Diagnostik
Vorstrukturierende Lesehilfe
Pädagogisches Handeln ist darauf gerichtet, das Verhalten anderer mit mentalen
Mitteln zu beeinflussen. Sein Erfolg hängt (u.a.) davon ab, daß man die individuellen
Lernvoraussetzungen möglichst genau kennt (Diagnose) und einschätzen kann, wel-
che der verfügbaren pädagogischen Behandlungsalternativen unter den gegebenen
Randbedingungen die beste ist (Prognose). Der erwartete Lernerfolg bedarf der
Überprüfung (Veränderungsmessung). Ihr Ergebnis entspricht der Lernvoraussetzung
für die nächste pädagogische Maßnahme.
Unabhängig von Fragestellung und Verwertungszusammenhang führt Diagnostik
in der Regel zur Zuordnung von Individuen zu Gruppen mit gleicher Merkmalsaus-
prägung (Klassifikation). Dies geschieht grundsätzlich anhand rationaler, nachvoll-
ziehbarer Entscheidungsprozeduren. Die professionelle Pädagogisch-psychologische
Diagnostik ist in dem Maße effizient, wie gezeigt werden kann, daß sie nach Daten-
qualität und Verfahrensökonomie der besten alternativen Entscheidungsstrategie
überlegen ist.
1.1 Die Aufgaben der Pädagogisch-psychologischen Diagnostik
Ziel von Erziehung und Unterricht ist, vereinfacht gesagt, das Verhalten anderer
mittels mentaler Beeinflussung möglichst dauerhaft zu verändern. Erziehen und Leh-
ren bestehen aus dem intentionalen Herbeiführen systematischer Veränderungen an
Personmerkmalen durch Lernen, d.h. auf dem Weg über kognitive Prozesse der In-
formationsaufnahme und -Verarbeitung samt ihrer emotionalen und motivationalen
Begleitzustande. Es geht darum, gegebene individuelle Istwerte von Merkmalen in
neue, bestimmten Sollwerten entsprechende oder angenäherte Istwerte zu überführen.
In der professionellen Pädagogik gelten Individualisierung und Differenzierung
als unumstrittene Grundsätze der Organisation von Lehren und Lernen. Welche Ziele
im einzelnen es auch immer verfolgt, pädagogisches Handeln unterliegt dem allge-
meinen Optimierungsgebot, demzufolge Entscheidungen so getroffen werden sollen,
daß die Lernenden so gut wie möglich gefordert oder vor Nachteilen möglichst be-
wahrt werden (Erfolgsmaximierung, Risikominimierung).
Dementsprechend besteht die Funktion der Pädagogisch-psychologischen Diagno-
stik im wesentlichen darin, Grundlagen für “richtige” pädagogische Entscheidungen
zu liefern, d.h. folgende praktische Aufgaben zu erfüllen:
die tatsächlichen Ausgangsbedingungen bei den Lernenden zu klaren (Diagnose
l
von Lernvoraussetzungen oder Befindlichkeitszuständen)