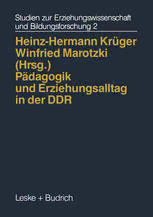Table Of ContentPädagogik und Erziehungsalltag in der DDR
Studien zur Erziehungswissenschaft
und Bildungsforschung
Herausgegeben von
BemdDewe
Heinz-Hermann Krüger
Winfried Marotzki
Band 2
Heinz-Hermann Krüger
Winfried Marotzki (Hrsg.)
Pädagogik und
Erziehungsa11tag
in der DDR
Zwischen Systemvorgaben
und Pluralität
+
Leske Budrich, Opladen 1994
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Pä3agogik und ErziehungsaIItag in der DDR : zwischen Systemvorgaben und Plu
ralitätlHeinz-Hermann Krüger; Winfried Marotzki (Hrsg.). !-Opladen : Leske
und Budrich, 1994
(Studien zur Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung ; Bd. 2)
ISBN 978-3-8100-1160-2 ISBN 978-3-322-99776-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-99776-0
NE: Krüger, Heinz-Hennann [Hrsg.]; GT
© 1994 by Leske + Budrich, Opladen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung au
ßerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzu
lässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfil
mungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Einführung 7
Ernst Cloer
Universitäre Pädagogik in der früheren DDR -
ausschließlich Legitmationswissenschaft?
Untersuchungen zur Pluralität pädagogischer Denkfonnen 17
Dietrich Benner, Horst Sladek
Das Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule
und die unterschiedliche Auslegung seiner hannonistischen
Annahmen zum Verhältnis von Begabung und
Bestimmung in den Jahren 1946/47 37
Winfried Marotzki, Walter Bauer
Zur sittlich-patriotischen Erziehung in der DDR-Pädagogik 55
Woifgang Eichler
Methodologische Fragen der Theoriebildung in der
Allgemeinen Pädagogik der DDR 95
Marita Appoltshauser, Thomas Gatzemann, Peter Menck
»Erziehung« im erziehungswissenschaftlichen Diskurs in
Deutschland 1945 - 1989.
Eine Projektskizze 117
Jörg Ruhloff, Jochen Riemen
Zur Fonn von Kritik in der DDR-Pädagogik 127
Lothar Wigger, Karl-Heim Walter, Cornelia Hilbrich
Schulstrukturentscheidungen aus
argumentationsanalystischer Sicht.
Am Beispiel der Refonn der Abiturstufe in der DDR 137
Reinhard Golz
Geschichte der Erziehung zwischen Vorgaben und
Gestaltungsversuchen 161
Brita Rang
Historische Pädagogik =Politische Pädagogik?
Überlegungen zum Verhältnis von Politik und Geschichte
der Erziehung in der DDR 177
HUmar Hoffmann
Die Entwicklung des Kindergartens in der Sowjetischen
Besatzungszone bis zur Gründung der DDR - Neuanfang
zwischen Dogmatismus und Demokratisierung 193
Heinz-Elmar Tenorth, Andreas Paetz, Sonja Kudella
»Politisierung des Schulalitags in der DDR«.
Skizze und erste Ergebnisse eines Forschungsvorhabens 209
Rotraud Coriand
Die Selbsttätigkeit des Schülers und die Führungsrolle des
Lehrers-kritischer Rückblick auf die Didaktikforschung
der 80er Jahre in der DDR 233
Franz-Peter Schimunek
Soll und Haben. Erste Bilanz des Wandlungsprozesses im
Bildungswesen Thüringens am Beispiel der Stadt Erfurt 243
Wolfgang Ortlepp
Ausgewählte Aspekte der Ausbildung von
Unterstufenlehrern in der DDR 257
Heinz-Hermann Krüger
'Wie Ernst Thälmann treu und kühn .. .'
Zur Politisierung des Studien- und Forschungsalitags in der
DDR am Beispiel der Pionierleiterausbildung 275
Jan H Olbertz
Zwischen Systemgebundenheit und Variabilität
Erwachsenenbildung in der DDR 295
Thomas Olk, Kerstin Bertram
Jugendhilfe in Ostdeutschland vor und nach der Wende 321
Autorenverzeichnis 351
Heinz-Hermann Krüger, Winfried Marotzki
Pädagogik und Erziehungsalltag in der DDR -
Eine Einführung
Mit dem Zusammenbruch der DDR ist auch die DDR-Pädagogik an ihr
Ende gekommen. Lohnt sich überhaupt noch die Auseinandersetzung mit
der Geschichte einer Disziplin, der nachgesagt wird, daß sie eingespannt in
die Parteiherrschaft der SED nur mit dazu beigetragen habe, aus der DDR
einen geschlossenen Erziehungs- und Weltanschauungsstaat zu machen?
Warum soll man sich noch einmal mit dem Erziehungsalitag in Schulen,
Hochschulen sowie in außerschulischen Einrichtungen beschäftigen, wenn
deren Funktionen ohnehin nur darin bestanden haben sollen, die »ideologi
sche Homogenisierung der Gesellschaft« zu sichern? (Anweiler u.a. 1992,
S.13-14)
Im Gegensatz zu pauschalisierenden Denkweisen, die in der DDR-Päd
agogik ausschließlich eine uniforme Staatspädagogik sehen, zielt der hier
vorgelegte Sammelband auf Differenzierungen. Intention ist es, ein komple
xes Bild der Pädagogik und des Erziehungsalitags in der DDR zu zeichnen,
das die Eingebundenheit in staatliche Formierungsabsichten ebenso aufzeigt
wie die Brüche und Ambivalenzen im Herrschaftssystem. Dabei können die
in diesem Band vorgestellten Beiträge jedoch nur erste Ansätze und exem
plarische thematische Ausschnitte aus dem noch aufzuarbeitenden For
schungsfeld skizzieren. Denn das Ende der DDR bedeutet für die kritische
Rekonstruktion der Pädagogik und des Erziehungsalitags in der DDR erst
den Anfang.
Diese Diagnose mag angesichts der Tatsache, daß in Westdeutschland be
reits seit den 50er Jahren eine vergleichende Deutschlandforschung existiert,
vielleicht paradox erscheinen Doch diese Studien aus dem Kontext der ver
gleichenden pädagogischen Deutschlandforschung weisen einige Leerstel
len und Schwachpunkte auf. Erstens liegt der thematische Akzent vieler
Arbeiten auf Strukturanalysen des Bildungssystems, auf der Geschichte der
Lehrplanentwicklung oder auf Fragen der polytechnischen Bildung (vgl.
u.v.a. Anweiler 1969, 1990; Baacke 1979; Fischer 1992; Waterkamp 1990),
während Rekonstruktionen pädagogischer Denkformen und Theoriedebatten
in der allgemeinen Pädagogik, aber auch in den Teildisziplinen, eher spär
lich ausfallen (vgl. Langewellpott 1973; eloer 1986, 1988 und in diesem
Band). Zweitens können die in der vergleichenden Bildungsforschung ge
wählten makrosoziologischen Theorieansätze zur Analyse der Entwicklung
8 Heinz-Hermann Krüger, Winfried Marotzki
von Bildung und Erziehung in der DDR nicht hinreichend überzeugen. Das
vor allem in den 50er und 60er Jahren entwickelte und neuerdings auch von
ostdeutschen Autoren wiederbelebte Totalitarismuskonzept kann aufg rund
des generell unterstellten totalen Führungsanspruchs der SED auf die Berei
che von Bildung und Erziehung Fonnen von Resistenz und Widerstand
nicht erklären. Außerdem wird in solch einem Theoriekonzept nicht hinrei
chend zwischen dem unterschiedlichen Grad der politischen Einflußnahmen
auf den verschiedenen Ebenen pädagogischen Wissens und Handeins diffe
renziert. Aber auch das in den späten 60er und 70er Jahren favorisierte Kon
zept der Industriegesellschaft, oft verbunden mit den Annahmen einer
Konvergenztheorie, die die ähnlichen Entwicklungen im Bildungswesen der
BRD und DDR vor allem unter bildungsökonomischen Perspektiven betonte
(vgl. Anweiler 1990, S. 2, als neuere Variante einer Konvergenztheorie
Gruschka 1992) greift zu kurz, da in diesem Theorieansatz die spezifischen
Herrschaftsfonnen und Legitimationsmuster staatssozialistischer Gesell
schaften weitgehend ausgeblendet bleiben. Eine dritte Einschränkung, mit
der die vergleichende Deutschlandforschung konfrontiert war, waren die
fehlenden Zugänge zu Archiven oder zu empirischen Originaldaten, die
selbst in der DDR oft geheim gehalten wurden (vgl. BüchnerlKrüger 1991,
S. 7). Deshalb konnten sich die westdeutschen Forscher bei ihren Analysen
nur auf offizielle Dokumente und die wenigen vorliegenden Arbeiten stüt
zen, aus denen zumeist die wesentlichen empirischen Grundlagen nicht er
sichtlich waren.
Diese Situation hat sich nach der politischen Wende in der DDR und der
deutsch-deutschen Vereinigung gravierend verändert. Archive verschieden
ster Provinienz (Universitätsarchive, Partei archive etc.) mit offiziellen Do
kumenten und nichtoffiziellem Material stehen für Recherchen zur
Verfügung. Empirische Original daten sind für Sekundäranalysen zugäng
lich. Pädagogische Zeitzeugen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern und Ge
nerationen können befragt werden. Die veränderten methodischen
Möglichkeiten und Handlungsspielräume eröffnen zugleich die Chance,
neue Aufgabenbereiche und Themengebiete für die pädagogische DDR-For
schung zu erschließen. So sind Arbeiten zur Alltags- und Regionalgeschich
te, etwa zu Biographie- und Karrieremustern von Neulehrern in der
Sozialgeschichte der Erziehung in der DDR (vgl. MBJS Brandenburg 1992,
S. 5) oder zur Aufarbeitung des regionalen refonnpädagogischen Erbes in
den neuen Bundesländern (vgl. Pehnke 1992) möglich, die sich auf Quellen
analysen bzw. Methoden der oral-history stützen können. Bezugnehmend
auf solche Verfahren kann auch die Wissenschaftsgeschichte der DDR-Päd
agogik neu rekonstruiert werden, indem Z.B. in Fallstudien zu einzelnen
pädagogischen Fakultäten der Versuch gemacht wird, Theorie- und Theore-
Einfohrung 9
tikergeschichten in Wechselbeziehung mit der ökonomischen, soziopoliti
sehen und Universitätsgeschichte zu interpretieren (vgl. dazu auch den Bei
trag von eloer in diesem Band). Durch solche Fallstudien sowie durch die
detaillierte Analyse von Tauwetterperioden im Verlaufe der Geschichte der
DDR (vgl. z.B. zur pädagogischen Revisionismusdebatte in den Jahren 1955
- 1958: Geissler 1992) können auch die wenigen bislang vorliegenden Peri
odisierungsversuche zur Theoriegeschichte der DDR-Pädagogik etwa von
Kirchhöfer (1992) und Kirchhöfer/Wessel (1991), die unterhalb des späte
stens im Verlaufe der 50er Jahre durchgesetzten marxistisch-leninistischen
Paradigmas als erziehungsphilosophischer Grundlage für die Pädagogik
noch eine kybernetische Wende in den 60er Jahren und eine individualitäts
orientierte Wende in den 80er Jahren ausmachen, empirisch überprüft und
gegebenenfalls revidiert werden. Erforderlich ist nicht nur eine Überarbei
tung der bislang vorliegenden bildungsgeschichtlichen Periodisierungsver
suche, die sich zumeist an schulpolitischen Entwicklungsetappen (vgl. etwa
Fischer 1992, S. 29) orientieren. Notwendig für die zukünftige pädagogi
sche DDR-Forschung ist es auch, bei den Analysen zwischen den unter
schiedlichen Ebenen, Orten und Verwendungszusammenhängen pädagogi
schen Wissens und Handeins genau zu differenzieren. Zwar ist davon aus
zugehen, daß die SED und das Ministerium für Volksbildung alle ihr direkt
oder indirekt unterstellten pädagogischen Institutionen ihrem politisch-ideo
logischen Führungsanspruch zu unterwerfen suchte. Aber erst detailliertere
Fallstudien zu den Entscheidungsprozessen im Ministerium für Volksbil
dung, im Bereich der APW, der Pädagogik an Hochschulen und Universitä
ten, auf der Ebene der Einzelschulen und auch zum integrierten zweiten
schulischen Erziehungssystem in Gestalt der Pioniere und der FDJ werden
zeigen, ob und wie diese Mechanismen funktioniert haben und wo Freiräu
me für abweichende Orientierungen und Handlungspraxen bestanden.
Ein weiteres Forschungsdesiderat für die pädagogische DDR-Forschung
ist die historische Aufarbeitung der theoretischen Diskurse in den verschie
denen erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen, wie etwa der Sozial
pädagogik (vgl. Böllert/Otto 1992) oder der Erwachsenenbildung und der
konkreten Erziehungspraxen in den außerschulischen pädagogischen Institu
tionen, seien es z.B. die Jugendwerkhöfe oder die politischen Weiterbil
dungsangebote der SED. Bleibt schließlich als zentrale Aufgabe der
aktuellen erziehungswissenschaftlichen Forschung noch die Analyse der
vielfältigen Transformationsprozesse im Hochschul-, Bildungs-, Erzie
hungs- und Sozialwesen in den neuen Bundesländern seit der deutsch-deut
schen Vereinigung mit ihren Auswirkungen auf die von diesem
Umstrukturierungsprozeß Betroffenen zu nennen, die die Bildungs-, Ju
gendhilfe- oder auch die Kindheits- und Jugendforschung vor neue große
10 Heinz-Hermann Krüger, WinJriedMarotzki
Herausforderungen stellen (vgl. DudekiTenorth 1993; KrügerlHaak/Musiol
1993; Marotzki 1993).
Zur Bearbeitung und analytischen Durchdringung der skizzierten Frage
und ThemensteIlungen ist die erziehungswissenschaftliehe DDR-Forschung
auch auf neue theoretische Bezugsgrößen angewiesen, die jenseits der tradi
tionellen totalitarismus- und konvergenztheoretischen Lesarten liegen. Ein
umfassendes und theoretisch konsistentes Erklärungsmodell, das die spezifi
schen Herrschaftsformen, die sozialstrukturelle und organisatorische Ver
faßtheit sowie die Einbindung von Bildung und Erziehung in die
DDR-Gesellschaft ebenso analytisch fassen kann wie den Legitimations
glauben bzw. Legitimationsverfall bei weiten Kreisen der DDR-Bevölke
rung, liegt nicht vor. Dennoch liefern sowohl modernisierungstheoretische
Ansätze, etwa das Theorem von der selektiven Modernisierung (Zinnecker
1991) oder differenzierungstheoretische Ansätze, die auf die geringe Diffe
renziertheit des politischen Systems und die Entdifferenzierung der Sozial
struktur hinweisen (Kohli/Joas 1993) als auch herrschafts soziologische
Ansätze, die die Entwicklung der DDR im Spannungsfeld von pseudo-patri
archalischer Herrschaft und staatsbürokratischen Rationalitätskriterien
(Meuschel 1992) zu begreifen suchen, plausible Deutungsvorschläge zur
Analyse der makrosozialen Bedingungen der DDR-Gesellschaft. Umgekehrt
kann vermutlich die Langzeitidentifikation von Teilen der Aufbaueliten mit
den Machtstrukturen des SED-Regimes nur mentalitäts geschichtlich mit de
ren Herkunft aus der Oppositionsbewegung gegenüber dem Nationalsozia
lismus erklärt werden, während für die Diagnose des rapiden Legitima
tionsverfalls bei weiten Teilen der DDR-Bevölkerung im Verlaufe der 80er
Ansätze aus der Wertewandeldiskussion (vgl. Friedrich 1991) hilfreich sein
können. Solche Deutungsversuche eignen sich im Rahmen bildungshistori
scher Untersuchungen sicherlich zur Erklärung der gesellschaftspolitischen
Rahmenbedingungen und individuellen Voraussetzungen von Erziehungs
und Bildungsprozessen. Notwendig sind darüberhinaus jedoch genuin erzie
hungswissenschaftliche Theoriekonzepte, seien sie nun bildungstheoreti
scher (Benner 1991) oder argumentationsanalytischer Provinienz (Wigger/
WalterlHilbrich in diesem Band), die die Spezifika von pädagogischen
Denkformen und Handlungsprozessen . im Kontext der Gesellschaft der
DDR kategorial fassen können.
Das hier in groben Umrissen skizzierte Forschungsprogramm und Aufga
benspektrum für die zukünftige pädagogische DDR-Forschung wird durch
die Beiträge in diesem Sammelband nur in ersten Ansätzen eingelöst. Die
Artikel, die von Autoren aus Ost- und Westdeutschland verfaßt wurden,
stellen den Versuch dar, sich der Vergangenheit der Pädagogik und des Er
ziehungsalltages in der DDR zu nähern, mit der Absicht aus der Vergangen-