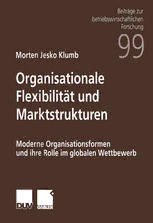Table Of ContentKlumb . Organisationale Flexibilität und Marktstrukturen
Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
Schriftenreihe herausgegeben von:
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horst Albach, Bonn
Prof. Dr. Sönke Albers, Kiel
Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Hax, Köln
Prof. Dr. Bemhard Pellens, Bochum
Band 99
Die "braune Reihe", wie die "Beiträge zur betriebswirtschaftlichen
Forschung" häufig kurz genannt werden, ist eine der bekanntesten
und angesehensten Buchreihen ihres Fachs. Seit 1954 erscheinen
hier besonders qualifizierte, oft richtungsweisende Forschungs
arbeiten (vor allem Dissertationen und Habilitationsschriften) der
jeweils "neuen Generation" der Betriebswirtschaftslehre.
Morten Jesko Klumb
Organisationale
Flexibilität und
Marktstrukturen
Modeme Organisationsformen und
ihre Rolle im globalen Wettbewerb
Deutscher Un iversitäts-Verlag
Die Deutsche Bibliothek -CIP-Einheitsaufnahme
Klumb, Morten Jesko:
Organisationale Flexibilität und Marktstrukturen : modeme Organisationsformen und ihre Rolle im
globalen Wettbewerb / Morten Jesko Klumb.
-I. Aufl .. -Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 2002
(Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung; Bd. 99)
Zugl.: Koblenz, Wiss. Hochsch. für Unternehmensführung, Diss., 2001
ISBN 978-3-8244-9073-8 ISBN 978-3-322-95314-8 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-95314-8
I. Auflage Juli 2002
Alle Rechte vorbehalten
© Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden, 2002
Lektorat: Ute Wrasmann / Annegret Eckert
Der Deutsche Universitäts-Verlag ist ein Unternehmen der
Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer.
www.duv.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Ver
vielfaltigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im
Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher
von jedermann benutzt werden dürften.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.
ISBN 978-3-8244-9073-8
Geleitwort
Die Grenzen zwischen der Theorie der Unternehmung und der volkswirtschaftlichen Theorie
der Marktformen verschwimmen immer mehr. Das liegt vor allem daran, daß die Theorie der
Marktformen die Organisationstheorie endogenisiert, also als Determinante der Marktform
berücksichtigt. Das liegt aber auch daran, daß sich in der Theorie der Unternehmung die
Erkenntnis durchgesetzt hat, daß die Unternehmung mit ihrer jeweiligen organisatorischen
Gestaltung das Verhalten der Manager am Markt und damit die Wettbewerbsintensität
beeinflußt.
Morten Klumb hatte die Aufgabe, diese Erkenntnis, die ursprünglich von Sutton formuliert
und von Silke Neubauer in dieser Reihe spieltheoretisch ausgebaut wurde, zu erweitern auf
die Frage, ob eine Interdependenz zwischen der Flexibilität einer Organisation des
Unternehmens und der Marktstruktur besteht.
Die zentrale These des Autors ist es, daß sich die Organisation nicht an gegebene Markt
strukturen anpaßt, wie es die Kontingenztheorie behauptet, sondern daß die Organisations
form die Marktstruktur beeinflußt. Die Beweisführung wird sehr gründlich vorbereitet. Sie
wird dann in einem fünfstufigen Spiel durchgeführt. Das Ergebnis lautet: Die initiativ
gestaltende flexible Organisation ist allen anderen Organisationsformen überlegen.
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel entwickelt die Begriffe, mit denen
der Verfasser sein Thema erschließt. Das zweite Kapitel enthält eine kurze Motivation für das
Thema und stellt das theoretische Fundament knapp dar. Im dritten Kapitel werden bekannte
Organisationskonzepte untersucht und deren Eignung zur Behandlung von unterschiedlichen
Anforderungen des Umfeldes an das Unternehmen analysiert. Als Ergebnis werden Ideal
typen flexibler Organisationen entwickelt. Im vierten Kapitel wird der interessanten Frage
nachgegangen, wie flexible Organisationsstrukturen von Unternehmen das Verhalten der
Agenten am Markt beeinflussen und wie sich dadurch die Marktstrukturen ändern. Dies ist ein
zentraler Teil der Arbeit. Im fünften Kapitel wird eine empirische Studie der europäischen
Chemieindustrie vorgelegt. Diese Studie soll die theoretischen Ergebnisse des vierten
Kapitels überprüfen und zeigen, wie sich die Marktstrukturen als Folge von Organisations
änderungen verändern.
v
Im ersten Kapitel werden Bewertungskriterien für Organisationen abgeleitet. Klumb sieht sie
in Innovation, Zeit, Qualität und Kosten. Das ist ein sehr problemadäquates Bewertungs
schema. Einerseits eignet es sich besser zur Charakterisierung von flexiblen Organisations
formen als frühere Bewertungsschemata in der Organisationslehre, zum anderen sind die
Bewertungskriterien von Klumb der Messung zugänglich.
Im zweiten Kapitel werden bekannte Organisationskonzepte nach diesem Bewertungsschema
beurteilt. Klumb stellt die tayloristische Organisation, die autokratische Organisation, die
Nomadenorganisation, die horizontale Organisation, das Lean Management, die amorphe
Organisation und die lernende Organisation vor. Er entwickelt draus drei Idealtypen von
Organisationen, nämlich die defensiv anpassende flexible Organisation, die aggressiv
anpassende flexible Organisation und die initiativ gestaltende flexible Organisation. Der
Verfasser kommt zu dem Ergebnis: "Ausschließlich aufbauorganisationale oder abI auf
organisationale Regelungen sind nicht geeignet, organisationale Flexibilität gleich weIcher
Dimension zu erreichen".
Den Hintergrund des dritten Kapitels bildet ein verallgemeinertes Modell von Sutton mit
flexiblen Bestimmungsgründen der Marktstruktur. Dieses Modell wurde von Sven Schiemann
(in dieser Reihe) erweitert und am Markt für Bahnsysteme getestet. Klumb erweitert nun das
Sutton/Schiemann-Modell, indem er eine organisationale Variable einführt. Er endogenisiert
die Organisation. Das geschieht in einem Spiel, das aus den Stufen Markteintritt,
Differenzierung, Reorganisation, Preispolitik besteht. Mit Hilfe stilisierter Kostenverläufe
werden die drei idealtypischen flexiblen Organisationsformen in dieses Modell eingeführt.
Das Modell wird sowohl für ein Produkt auf einem Markt als auch für ein Mehrproduktunter
nehmen mit Mehr-Marktbeziehungen entwickelt.
Es wird gezeigt, daß die initiativ gestaltende flexible Organisation die effizienteste
Organisationsform ist. Bei dieser Organisationsform setzt der Differenzierungswettbewerb
früher ein. Bei ihr konzentriert sich die Unternehmung auf ihre Kernkompetenzen. Je größer
die Flexibilität der Organisation ist, desto geringer sind die Transaktionseinzelkosten. Je
geringer die Transaktionseinzelkosten, desto höher die Endkonzentration am Markt. Die
Konzentration führt aber nicht zu einer Verminderung der Konsumentenrente, weil die
Kundennähe durch den Differenzierungswettbewerb verbessert wird.
VI
Erich Gutenberg wollte durch den "Schleier der Organisation" zu den "Gesetzmäßigkeiten der
Unternehmung" vorstoßen. Dieser wichtige methodische Schritt führte zur Entwicklung der
Theorie der Unternehmung auf der Basis der Produktions- und Kostentheorie. Die weitere
Entwicklung führte zum Nachweis: "Organization matters" und der Einbeziehung der
Organisationstheorie in die Theorie der Unternehmung. Heute befinden wir uns in der dritten
Phase der Entwicklung der Unternehmenstheorie. Nun wird die Markttheorie endogenisiert.
Strategisches Verhalten der Unternehmen arn Markt, d. h., die Wettbewerbstheorie, ist
Bestandteil der Theorie der Unternehmung. Dazu leistet die Arbeit von Morten Klumb einen
wichtigen Beitrag.
Ich wünsche der Arbeit eine gute Aufnahme bei den Fachkollegen. Der empirische Teil der
Arbeit zeigt, daß nicht alle in der Realität vorfindbaren Organisationsformen nur einer ideal
typischen Organisationsform, nämlich der in der Theorie dominanten initiativ gestaltenden
flexiblen Organisationsform, zugeordnet werden können. Der Praktiker kann darauf mit dem
bekannten Satz reagieren: "too bad for the theory". Er könnte aber auch nachdenklich werden
und sich fragen: "habe ich wirklich bei allen Restrukturierungs- und Reengineerings
Prozessen der letzten Jahre die vorhandenen Potentiale zur Effizienzsteigerung voll
ausgeschöpft? Oder sollte ich nicht doch durch weitere Bemühungen der initiativ gestaltenden
Organisationsform näher kommen?" Für solch nachdenkliche Praktiker ist die Arbeit von
Klumb eine anregende Lektüre. Der Autor kann solche Praktiker heute als Mitarbeiter eines
großen Beratungsunternehmens, das sich auf strategische Organisationsgestaltung
spezialisiert hat, bei solchen Überlegungen unterstützen und seine theoretischen Erkenntnisse
in die Praxis umsetzen. Das ist in der Betriebswirtschaftslehre noch immer der beste Test
einer neuen Theorie.
Horst Albach
VII
Vorwort
Immer schneller verändert sich im heutigen globalen Wettbewerb das Aussehen von Märkten.
Daß bei diesen Veränderungen dem Einfluß flexibel agierender Unternehmen eine besondere
Rolle zukommt, ist mittlerweile unbestritten. Doch wie genau laufen diese Beeinflussungs
prozesse ab, und wie sollte die Organisation eines Unternehmens beschaffen sein, damit es
die globalen Märkte in seinem Sinn gestalten kann? Die Beantwortung dieser praxis
relevanten Fragestellungen war für mich die Zielsetzung bei der Erstellung vorliegender
Dissertation an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung in Vallendar.
Der besondere Reiz lag dabei darin, diese praktische Problemstellung mit einer theoretisch
anspruchsvollen Arbeit zu beantworten, die einen Beitrag zur Zusammenführung von Markt-,
Wettbewerbs-und Organisationstheorie in der Theorie der Unternehmung leistet.
In diesem Anliegen unterstützt hat mich mein Doktorvater, Herr Professor Dr. Dr. h.c. mult.
Horst Albach. Er hat mir bei der Betreuung dieser Arbeit stets die notwendigen Hilfe
stellungen und erforderlichen Freiräume gewährt. Gleichzeitig hat er mir mit seiner außer
gewöhnlichen Fachkenntnis und Erfahrung bei der praktischen Umsetzung meiner Ideen
geholfen. Hierfür möchte ich ihm ganz herzlich danken.
Desweiteren gilt mein Dank Herrn Professor Dr. Brockhoff für die Übernahme des Zweitgut
achtens. Ebenfalls möchte ich mich bei allen Mitgliedern der Wissenschaftlichen Hochschule
für Unternehmensführung bedanken, die mich während meiner Promotion in zahlreichen
Diskussionen ermutigt haben. Stellvertretend sei an dieser Stelle mein Freund Christian Koch
genannt.
Vor allem danke ich jedoch meiner Familie, ganz besonders meinen Eltern. Sie haben mir
meine Ausbildung erst ermöglicht und mich in all den Jahren immer bedingungslos und
liebevoll unterstützt. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.
Morten Jesko Klumb
IX
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ......................................................................................X I
Abbildungsverzeichnis .............................................................................X VII
Tabellenverzeichnis ....................................................................................X IX
Abkürzungsverzeichnis ...............................................................................X XI
A. Einführung: Gegenstand, Methodik und Vorgehensweise der Arbeit ............. 1
A.I. AufgabensteIlung: die inhaltliche, theoretische und mathematisch·fonnale
Verbindung von Globalisierung des Wettbewerbs, Flexibilität der Organisation und
Konzentrationsprozessen der Marktstrukturen ....................................................................... 1
A.II. Methodik: eine praxis· und problemorientierte schrittweise Integration der
organisationalen, wettbewerblichen und marktbezogenen Theoriestränge ........................... 2
A.III. Vorgehensweise: eine zielorientierte Aufgabenbearbeitung .................................................... 3
B. Begrifflicher und konzeptioneller Bezugsrahmen: Organisation, Umfeld
der Organisation, organisationale Flexibilität ....................................................7
B.I. Die Organisation des Unternehmens: Begriff, Umfang und Bedeutung. ................................ 7
B.LI. Der Organisationsbegriff ............................................................................................................ 7
B.L2. Organisationale Gestaltungsfelder. ............................................................................................. 9
B.L2.1. Strukturelle Organisationskomponente .............................................................................. 10
B.L2.1.1. Aufbauorganisationale Regelungen ............................................................................ 11
B.L2.1.2. Ablauforganisationale Regelungen ............................................................................. 12
B.I.2.2. Führungskomponente ......................................................................................................... 14
B.I.2.3. Die Interdependenz der organisationalen Komponenten ................................................... 15
B.L3. Die Rolle der Organisation im Rahmen der Unternehmensführung ........................................ 17
B.II. Das Umfeld als Bewährungsprobe organisationaler Gestaltung: Instrumente zur
Beschreibung von Markt und Wettbewerb ............................................................................. 20
B.II.!. Das Structure-Conduct-Performance-Paradigma: industrieökonomische Analyse des
Marktprozesses ....................................................................................................................... 21
B.IL2. PORTERS Konzepte der Wettbewerbskräfte und der Strategischen Gruppen einer
Branche: Endogenisierung auch der einzel wirtschaftlichen Perspektive ............................... 23
B.II.3. ALB ACHS modifiziertes Structure-Conduct-Performance-Paradigma: ModelIierung
des marktübergreifenden dynamischen Wettbewerbs ............................................................ 25
B.III. Flexibilität als umfeldgerechte Organisationseigenschaft: von der Anpassung zur
Gestaltung ................................................................................................................................... 28
B.IIL !.Die Einordnung organisationaler Flexibilität mit Hilfe ganzheitlicher Flexibilitäts
konzepte: organisationale Flexibilität als Grundvoraussetzung der Unternehmens-
flexibilität ............................................................................................................................... 29
B.IIL2.0rganisationale Flexibilitätsgrade: Anpassungsfähigkeit, aktive Beweglichkeit,
Gestaltungsfahigkeit ............................................................................................................... 34
B.IV. Zwischenergebnis ....................................................................................................................... 38
XI
C. Konkrete Herausforderung an flexible Organisationskonzepte:
Globalisierung und die aus ihr resultierenden Ansprüche an
organisationale Gestaltung ................................................................................4 0
C.I. Globalisierung: Erscheinungsfonnen, Ursachen und Wettbewerbsbedingungen ..•...•..•..•..••. 40
C.l.l. Erscheinungsformen der Globalisierung ................................................................................. .41
C.1.2. Ursachen der Globalisierung .................................................................................................... 44
C.1.3. Wettbewerbsbedingungen der Globalisierung ......................................................................... .46
C.II. Die Anforderungen an flexible Organisationsgestaltung im globalen Wettbewerb:
Chancenerkennung, Kreativität, Entscheidungsschnelligkeit, Entscheidungs-
qualität und Wirtschaftlichkeit ................................................................................................ 48
c.n.l. Die Erfolgsfaktoren im globalen Wettbewerb ....................................................................... .49
C.II.2. Die abgeleiteten Bewertungskriterien für Organisationen ...................................................... 52
c.n.2.1. Erfüllung des Erfolgsfaktors Innovation: Chancenerkennung und Kreativität der
Organisation .................................................................................................................... 52
c.n.2.2. Erfüllung des Erfolgsfaktors Zeit: Entscheidungsschnelligkeit der Organisation .......... 55
c.n.2.3. Erfüllung des Erfolgsfaktors Qualität: Entscheidungsqualität der Organisation ............ 58
c.n.2.4. Erfüllung des Erfolgsfaktors Kosten: Wirtschaftlichkeit der Organisation .................... 59
C.III. Das mikroökonomische Fundament organisationaler Beurteilung: Property-Rights-,
Transaktionskosten-und Prinzipal-Agenten-Theorie ............................................................ 60
c.m.l. Die Property-Rights-Theorie ................................................................................................. 62
c.m.2. Die Transaktionskosten-bzw. Koordinationskostentheorie .................................................. 63
c.nl.3. Die Prinzipal-Agent-Theorie ................................................................................................. 66
C.IV. Zwischenergebnis ..•..•.................•...•••••••••••••.•................•.............•..•.............•......•.••••••••••.•••••••••• 69
D. Beurteilung der Anforderungserfüllung bekannter Organisations
konzepte: Herleitung idealtypischer flexibler Organisationen als
Synthese ihrer Stärken .......................................................................................7 1
D.I. Das Beurteilungsschema: eine zweistufige Vorgehensweise zur anforderungs-
bezogenen Prüfung organisationaler Konzepte ...................................................................... 71
D.II. Die Beurteilung: vergleichende Analyse und Bewertung wichtiger ganzheitlicher
Organisationsvorschläge ........................................................................................................... 71
D.ll.l. Die Klassiker: Hierarchisierung, Bürokratisierung, Taylorisierung ....................................... 73
D.n.I.I. Charakteristika ................................................................................................................. 73
D .11.1.2. Anforderungserfüll ung ..................................................................................................... 77
D.ll.l.2.1. Fähigkeit zur Chancenerkennung .............................................................................. 77
D.ll.I.2.2. Kreativität .................................................................................................................. 78
D.ll.l.2.3. Entscheidungsschnelligkeit. ....................................................................................... 81
D.ll.I.2.4. Entscheidungsqualität ................................................................................................ 82
D.ll.I.2.5. Wirtschaftlichkeit ...................................................................................................... 84
D.lI.I.2.6. Fazit ........................................................................................................................... 86
D.lI.2. Erste Veränderungs versuche I: die adhocratische Organisation ............................................. 88
D.lI.2.1. Charakteristika ................................................................................................................. 88
D.n.2.2. Anforderungserfüllung ..................................................................................................... 94
D.Il.2.2.1. Fähigkeit zur Chancenerkennung .............................................................................. 94
D.II.2.2.2. Kreativität .................................................................................................................. 95
D.II.2.2.3. Entscheidungsschnelligkeit... ............ . ...................................................... 97
D.II.2.2.4. Entscheidungsqualität ................................................................................................ 99
D.ll.2.2.5. Wirtschaftlichkeit. .. .............................................. 100
D.ll.2.2.6. Fazit ......................................................................................................................... 101
XII