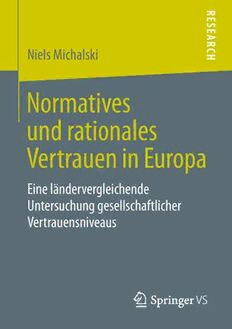Table Of ContentNiels Michalski
Normatives
und rationales
Vertrauen in Europa
Eine ländervergleichende
Untersuchung gesellschaftlicher
Vertrauensniveaus
Normatives und rationales Vertrauen
in Europa
Niels Michalski
Normatives und rationales
Vertrauen in Europa
Eine ländervergleichende
Untersuchung gesellschaftlicher
Vertrauensniveaus
Niels Michalski
Institut für Sozialwissenschaften –
Empirische Sozialforschung
Humboldt Universität Berlin
Berlin, Deutschland
Zgl. Dissertation an der Humboldt-Universität zu Berlin, 2018
ISBN 978-3-658-26057-6 ISBN 978-3-658-26058-3 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-26058-3
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019, korrigierte Publikation 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen
etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die
Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des
Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Danksagung
Die Arbeit an diesem Dissertationsprojekt begann mit einem
Vertrauensvorschuss meines langjährigen Chefs und Betreuers
Prof. Jürgen Schupp. Ihm gebührt der Dank für eine kontinuier-
liche Beratung und die Möglichkeit unabhängen Forschens. Be-
sonderer Dank gilt außerdem meinem Zweitgutachter Prof.
Bernhard Weßels, der mit seinen Kommentaren wesentlichen
Anteil an der Finalisierung der Arbeit hatte. Ich möchte außer-
dem Martin Nagelschmidt und Prof. Bernd Wegener stellvertre-
tend für die Promotionsprogramme BGSS und SESS für den
akademisch-organisatorischen Rahmen und die Finanzierung
insbesondere in der Frühphase der Promotion danken.
Besonderer Dank für methodische Diskussionen, Inspiration,
selisch-moralischen Beistand, Empathie und gesellige Abende
gilt Simone Schneider, Carlos Morales, Frederike Esche und
Christoph Jindra. Außerdem danke ich den Mitarbeitern des
Lehrbereichs Empirische Sozialforschung, insbesondere Prof.
Johannes Giesecke für hilfreiche Kommentare, Gabi Sonnen-
berg für die Unterstützung bei bürokratischem Aufwand und für
ihre allgemeine Anteilnahme, sowie Ferdinand Geißler für den
methodischen und kollegialen Austausch.
Für die Bewältigung mühevoller „Klein“-arbeit in der Endphase
und für ein elementares Lektorat bedanke ich mich bei Mathias
Loboda und Benjamin Becker. Meinen Freunden Martin Daßin-
nies, Daniel Beckmann und Mathias Loboda danke ich für unse-
re gemeinsam geteilte soziale Realität. Nicht zuletzt danke ich
meinen Eltern Angela Michalski und Jürgen Rathenow dafür,
mir alles Wesentliche auf den Weg gegeben zu haben.
Unschätzbarer Dank gilt meiner Frau Veronika. Sie stand mir in
den letzten 10 Jahren zur Seite und mit ihr konnte ich die über-
wältigende Erfahrung machen, Vater unserer Kinder - Jonathan
und Emma - zu werden. Wir vier erfahren täglich wie inspierend
und erfüllend intrinsisch motiviertes Vertrauen und Liebe sind.
Berlin, im Januar 2018 Niels Michalski
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung .............................................................................. 1
1.1 Unterschiedliche Vertrauenskonzepte und ihre Synthese ......... 3
1.2 Weitere Probleme der umfragebasierten
Vertrauensforschung ............................................................... 10
1.3 Empirische Besonderheiten: Transformationsprozesse in
Osteuropa und nordeuropäische Vertrauenskulturen .............. 11
1.4 Methodische Herausforderungen der empirischen
Forschung ............................................................................... 13
1.5 Die Struktur der Arbeit ........................................................... 15
2 Vertrauen – Relevanz des Themas für die
Sozialwissenschaften ........................................................... 21
2.1 Vertrauen – gesellschaftliche Relevanz und Entdeckung
des Themas in der sozialwissenschaftlichen Forschung ......... 23
2.2 Vertrauen in der Moderne – Funktionalität von Vertrauen
für das Individuum ................................................................. 25
2.3 Vertrauen als Ressource von Gesellschaften .......................... 31
2.4 Die Dualität von Struktur und Handeln .................................. 35
3 Vertrauen als Konzept ....................................................... 41
3.1 Konzeptspezifikation: Vertrauen auf der Mikroebene –
Taxonomie und Eingrenzung.................................................. 41
3.2 Grundlagen zur Erklärung von Vertrauen .............................. 54
3.2.1 Theorien der Rationalen Wahl ......................................... 55
3.2.2 Vertrauen als Persönlichkeitseigenschaft ........................ 64
3.2.3 Soziologischer Ansatz – moralisch-kulturelle
Grundlagen....................................................................... 66
3.3 Entwicklung eines Erklärungsmodells ................................... 70
3.3.1 Vertrauensvolle Einstellung und Bewertung der
Vertrauenswürdigkeit ....................................................... 71
3.3.2 Einstellungsforschung – Vertrauen als Belief .................. 74
3.3.3 Vertrauen in der Einstellungsforschung ........................... 77
3.3.4 Kognitive und nicht-kognitive Grundlagen des
Vertrauens ........................................................................ 78
viii Inhaltsverzeichnis
3.3.5 Zweckrationale kognitive Beliefs bezogen auf
generalisiertes Vertrauen ................................................. 82
3.4 Zusammenfassung: Die Grundlagen generalisierten
Vertrauens............................................................................... 89
4 Erklärende Theorien .......................................................... 93
4.1 Einordnung von Erklärungsansätzen ...................................... 93
4.2 Individuelle Ansätze ............................................................... 97
4.2.1 Sozialisationsbasierte Theorien ....................................... 97
4.2.2 Erfahrungsbasierte Theorien .......................................... 104
4.2.3 Soziodemografie und weitere individuelle Faktoren ..... 119
4.2.4 Zusammenfassung: Individuelle Ansätze ...................... 123
4.3 Strukturelle Ansätze ............................................................. 123
4.3.1 Bottom-up-Theorien sozietaler Ansätze ........................ 125
4.3.2 Top-down-Theorien sozietaler Ansätze ......................... 133
4.4 Religion ................................................................................ 163
4.5 Erfahrung kommunistischer Diktatur und Transformation
nach 1989.............................................................................. 167
4.6 Zusammenfassung: Erklärende Theorien ............................. 168
5 Die Messung generalisierten Vertrauens ........................ 171
5.1 Vertrauen in Experimenten ................................................... 171
5.2 Vertrauen in der Umfrageforschung ..................................... 180
5.3 Evaluation der Validität des Messmodells generalisierten
Vertrauens............................................................................. 184
5.3.1 Die Instrumente zur Messung generalisierten
Vertrauens im ESS und im SOEP .................................. 185
5.3.2 Dimensionen des Vertrauens und die Messung des
generalisierten Vertrauens im ESS und im SOEP ......... 188
5.3.3 Herstellung interkultureller Messäquivalenz der
Vertrauensmessung ........................................................ 195
5.4 Zusammenfassung: Die Messung generalisierten
Vertrauens............................................................................. 201
6 Werte als Bestimmungsfaktoren von Vertrauen ........... 203
6.1 Schwartz‘ Theorie universeller menschlicher Werte ............ 203
6.2 Zusammenhänge zwischen Werten und Vertrauen .............. 210
6.2.1 Self-Transcendence-Werte ............................................. 211
Inhaltsverzeichnis ix
6.2.2 Self-Enhancement-Werte ............................................... 212
6.2.3 Openness-to-Change-Werte ........................................... 216
6.2.4 Conservation-Werte ....................................................... 217
6.3 Zusammenfassung: Die Beziehung zwischen
Schwartzschen Werten und generalisiertem Vertrauen ........ 218
6.4 Die Messung der Wertedimensionen .................................... 220
6.4.1 Die Messung der Schwartzschen Werte am Beispiel
der Wertedimension Universalismus ............................. 220
6.4.2 Analyse der Effekte der Reskalierung ........................... 224
6.4.3 Interkulturelle Messäquivalenz der Wertevariablen ...... 228
6.5 Bivariate Zusammenhänge zwischen Werten und
Vertrauen auf der Mikroebene .............................................. 230
6.6 Die Effekte prosozialer und eigennütziger Einstellungen ... 232
6.6.1 Prosoziale Einstellungen ................................................ 232
6.6.2 Eigennützige Einstellungen ........................................... 247
6.6.3 Zusammenfassung: Effekte prosozialer und
eigennütziger Einstellungen ........................................... 251
6.7 Der Einfluss von prosozialen und eigennützigen
Einstellungen auf Vertrauen in Mehrebenenanalysen .......... 252
6.7.1 Varianzdekomposition ................................................... 252
6.7.2 Fixe Regressionskoeffizienten im Mehrebenenmodell .. 253
6.7.3 Variierende Slopes und Cross-Level-
Interaktionseffekte ......................................................... 256
6.8 Abschließende Analysen und Zusammenfassung der
Ergebnisse............................................................................. 262
7 Multivariate empirische Analysen .................................. 269
7.1 Methoden und Daten ............................................................ 270
7.1.1 Analysemethoden und Schätzverfahren ......................... 270
7.1.2 Stichproben .................................................................... 274
7.1.3 Unabhängige Variablen und Modellaufbau ................... 276
7.2 Bestimmungsfaktoren der Individualebene .......................... 281
7.2.1 Soziodemografische Merkmale als Determinanten von
Vertrauen ....................................................................... 282
7.2.2 Weitere zentrale unabhängige Variablen zur Erklärung
von Vertrauen ................................................................ 291
x Inhaltsverzeichnis
7.2.3 Zusammenfassung der Hypothesen nicht-normativer
Erklärungen .................................................................... 297
7.2.4 Wertorientierungen und generalisiertes Vertrauen ........ 301
7.3 Erklärungsmechanismen über normative Beliefs ................. 304
7.3.1 Geschlecht ...................................................................... 305
7.3.2 Alter (Lebenszyklus- und Kohorteneffekte) .................. 308
7.3.3 Bildung........................................................................... 312
7.3.4 Religion .......................................................................... 318
7.3.5 Einkommen .................................................................... 324
7.3.6 Zusammenfassung der Erklärungsmechanismen über
normative Beliefs ........................................................... 326
7.4 Makro-Determinanten des Vertrauens .................................. 327
7.4.1 Bivariate Zusammenhänge zwischen generalisiertem
Vertrauen und ausgewählten Makroindikatoren ............ 329
7.4.2 Effektstärken der Makrodeterminanten im
multivariaten Mehrebenenmodell .................................. 336
7.4.3 Cross-Level-Interaktionseffekte (CLIE) ........................ 347
7.4.4 Zusammenfassung und Überblick über die getesteten
Makrohypothesen ........................................................... 353
8 Resümee ............................................................................. 361
8.1 Zusammenfassung und Rückblick ........................................ 361
8.2 Limitationen der Analysen ................................................... 370
8.3 Muss generalisiertes Vertrauen anders gemessen werden? . 373
8.4 Schlussbetrachtung ............................................................... 375
8.4.1 Ausgestaltung von Institutionen und die Gefahr der
Erosion von Vertrauen durch autoritäre Politikstile ...... 375
8.4.2 Die Förderung der zivilen Kraft normativer
Vertrauensbeliefs ........................................................... 378
8.4.3 Die Unterstützung prosozialen Verhaltens als
dominante Handlungslogik ............................................ 382
Erratum zu: Werte als Bestimmungsfaktoren von
Vertrauen .............................................................................. E1
Anhang ................................................................................... 387
Literaturverzeichnis .............................................................. 401
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Niveaus generalisierten Vertrauens in Europa ................ 2
Abbildung 2: Die Dualität von Struktur bei Giddens (1997) ............. 38
Abbildung 3: Abgrenzung von Vertrauen zu verwandten
Konstrukten nach Ripperger (1998: 40) ........................................ 49
Abbildung 4: Vertrauensmodell nach Mayer et al. 1995 dt.
Übersetzung aus Kassebaum 2004 ................................................ 72
Abbildung 5: Mehrebenenmessmodell für generalisiertes
Vertrauen (unstandardisierte Koeffizienten)................................ 187
Abbildung 6: Messmodell SOEPtrust (2003) ................................... 188
Abbildung 7: Messmodell Generalisiertes Vertrauen vs. Vertrauen
in Fremde .................................................................................... 193
Abbildung 8: Wertekreis von Shalom Schwartz (aus Schwartz
2006) ........................................................................................... 209
Abbildung 9: Histogramm für den residualisierten Summenindex
der Variablen un1 und un2 mit Kerndichteschätzung.................. 224
Abbildung 10: Korrelationen zwischen Universalismus und
generalisiertem Vertrauen aus MGCFA....................................... 233
Abbildung 11: Streudiagramm Anteil prosozialer Menschen
(Universalismus) und generalisiertes Vertrauen (latent) ............. 245
Abbildung 12: Streudiagramm Anteil Prosozialer Menschen
(Benevolence) und generalisiertes Vertrauen (latent) .................. 247
Abbildung 13: Streudiagramm Anteil eigennütziger Menschen
und generalisiertes Vertrauen (latent) .......................................... 250
Abbildung 14: Streudiagramme zum Universalismus-Effekt .......... 264
Abbildung 15: Generalisierte Vertrauen (latente Variable) nach
Prosozialität über Länder (ESS 2002-2012, gepoolt) .................. 266
Abbildung 16: Streudiagramme Makrodeterminanten und
generalisiertes Vertrauen ............................................................. 332
Abbildung 17: Makrodeterminanten Generalisierten Vertrauens
(adaptiert nach Delhey und Newton 2005: 321) ......................... 334
Abbildung 18: Messmodell ESStrust (2002-2012) gepoolte Daten . 388
Abbildung 19: Multilevel CFA für Generalisiertes Vertrauen
unstandardisierte Koeffizienten ................................................... 388