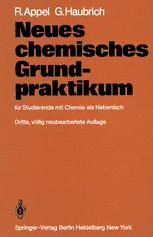Table Of ContentR. Appel G. Haubrich
Neues
chemisches Grundpraktikum
für Studierende
mit Chemie als Nebenfach
Dritte, völlig neubearbeitete Auflage
Mit 28 Abbildungen
Springer-Verlag
Berlin Heidelberg New York 1981
Rolf Appel
Gerhard Haubrich
Anorganisch-Chemisches Institut der Universität Bonn
Gerhard-Domagk-Straße 1,5300 Bonn
ISBN-13: 978-3-540-11007 e-lSBN: 978-3-642-&Q93...3
OOt 10.l007978-3-642-&Q93...3
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Appel, Rolf:
Neues chemisches Grundpraktikum für Studierende mit Chemie als
Nebenfach 1 R. Appel; G. Haubrich. - 3., völlig neubearb. Auf!. - Heidel
berg; NewYork: Springer, 1981.
ISBN 3-540-11089-5 (Berlin, Heidelberg, NewYork);
ISBN 0-387-11089-5 (NewYork, Heidelberg, Berlin)
NE: Haubrich, Gerhard:
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von
Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem
oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Ver
gütungsansprüche des § 54, Abs. 2 UrhG werden durch die "Verwertungs
gesellschaft Wort", München, wahrgenommen.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1981
Druck und Bindearbeiten: Beltz Offsetdruck, Hemsbach/Bergstr.
2142/3140-543210
Vorwort zur dritten, völlig neu bearbeiteten Auflage
Das vorliegende Praktikumsbuch ist für Studierende mit Chemie als Nebenfach
gedacht. Es wendet sich in erster Linie an Biologie-, Medizin- und Physik
studenten , deren gedrängte Studienpläne nur wenige Wochenstunden für das
Fach Chemie vorsehen. Ziel dieser Anleitung ist es daher, mit der begrenzten
Zahl verfügbarer Kursstunden den Studierenden die Stoff- und Grundkennt
nisse zu vermitteln, die zum Verständnis der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der
Chemie unbedingt erforderl ich sind.
Das Praktikum ist so aufgebaut, daß auch diejenigen, die auf Grund der freien
Fächerwahl in der reformierten Oberstufe keine oder nur geringe Vorkenntnisse
mitbringen, ohne Schwierigkeiten folgen können. Empfohlen wird lediglich der
vorherige Besuch der Hauptvorlesung in Allgemeiner und Anorganischer Chemie.
Alle Versuche, die sich in den beiden ersten Auflagen bewährt haben, sind
ungekürzt in diese Anleitung übernommen worden. Stark erweitert wurden
dagegen die den einzelnen Kapiteln vorangestellten theoretischen Erläuterungen.
Hiermit wurde der zunehmenden Durchdringung der NachtBrdisziplinen mit Methoden
und Begriffen der ·Chemi e Rechnung getragen.
So haben im AllgemeinenTeil physikalisch- chemische Gesichtspunkte eine stärkere
Berücksichtigung erfahren. Das Kapitel über Atombau und Bindungsvorstellungen
ist erheblich erweitert worden. Zusätzlich wurden Abschnitte über thermodynamische
Betrachtungen zum Massenwirkungsgesetz, über Reaktionskinetik und über die
elektrochemischen Grundlagen der Redox-Prozesse aufgenommen.
Bei der gezw ungenermaßen knappen Darstellung in einem Praktikumsbuch ließ
sich eine gewisse Unschärfe bei der Diskussion physikalisch-chemischer
Zusammenhänge nicht immer vermeiden. Beispielsweise sind bei der Betrachtung
der Energetik chemischer Reaktionen statistische Betrachtungen (Boltzmann
Verteilung) nicht berücksichtigt worden.
Im Anorganischen Teil wurde die große Zahl von Reaktionen und qualitativen
Analysen, die früher häufig geübt wurden, auf ein Mindestmaß beschränkt. Dafür
werden die maßanalytischen Übungen des quantitativen Teils unter Einbeziehung
des Ionenaustauschverfahrens ausführ Ii ch behandelt. Ein besonderer Abschnitt
ist Konzentrationsangaben und dem Herstellen von Lösungen gewidmet.
Der Organische Teil ist durch eine Einführung in die Grundlagen der Stereochemie
ergänzt worden, ohne die heute Probleme der Organischen ur1d der Biochemie
häufig nicht mehr sinnvoll diskutiert werden können. Auch ein Abschnitt über
VI
Reaktionsmechanismen organischer Reaktionen wurde den Experimenten voran
gestellt. Nach der Behandlung der Kohlenwasserstoffe und deren funktionellen
Derivaten wird in die Chemie derjenigen Stoffe eingeführt, die als Bausteine
wichtiger Naturstoffe Bedeutung haben.
Die erprobte Gliederung des Stoffes in 14 Kapitel wurde beibehalten. Die zu
jedem Kapitel angeführten Versuche lassen sich bei guter Vorbereitung in der
Regel während eines vierstündigen Praktikums erledigen, so daß bei 14 Praktikums
tagen im Semester oder einem drei wöchigem halbtägigen Kurspraktikum der be
handelte Stoff bewältigt werden kann.
Die vorliegende Praktikumsanleitung beruht auf mehrjähriger Erfahrung in der
Unterweisung von Medizin- und Biologiestudenten. In beiden Fächern steht die
Chemie am Studienanfang, so daß schon von daher eine möglichst einfache Dar
stellung des Stoffes notwendig war. Daraus ergibt sich von selbst, daß diese
Praktikumsanleitung kein Lehrbuchersatz sein kann und auf das begleitende Studium
der einschlägigen Lehrbücher nicht verzichtet werden kann. Dies um so mehr, als
in einem vierzehntägigen Kurspraktikum nur eine begrenzte Stoffauswahl getroffen
werden kann.
Bonn, im Jul i 1981 Rolf Appel
Gerhard Haubrich
Inhaltsverzeichnis
ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE
Kapitell
a} Atombau 1
b} Periodensystem 5
c) Metalle 6
d} Nichtmetalle 7
e} Chemische Verbindungsbildung 8
f) Chem"ische Wertigkeitsbegriffe 13
g} Elektrolytische Dissoziation 18
Kapitel 2-
a} Das chemische Gleichgewicht 21
b) Das Massenwirkungsgesetz 22
c) Energetik chemischer Reaktionen 24
d) Kinetik chemischer Reaktionen 29
e) Die elektrolytische Dissoziation als Gleichgewichtsreaktion 33
f) Wasser als Lösungsmittel 34
Kapitel 3
a) Säuren 39
b) Basen 43
c} Neutralisation 46
d} Hydrolyse 46
Kapitel 4
a} Allgemeine Zusammenhänge im Periodensystem 48
b) Chlorsäuren 52
c) Stickstoffsäuren 53
d) Phosphorsäure 54
Kapitel 5
a) Der pH-Wert 57
b) Pufferlösungen 59
c) Löslichkeitsprodukt 60
Kapitel 6
a} Oxidation - Reduktion 65
b) Elektrochemische Spannungsreihe 71
Kapitel 7
a} Komplexe Verbindungen 76
b) Bindungsverhältnisse in Komplexen 78
c} Eigenschaften von Komplexen 82
VIII
QUANTITATIVER TEIL
Kapitel 8
a) Konzentrationsangaben 85
b) Maßanalyse 86
c) Neutral isationsverfahren 87
d) Säure-Base-I ndikatoren 90
e) Ionenaustauscher 92
f) Oxidationsverfahren 94
g) Komplexometrische Titration 96
ORGANISCHE CHEMIE
Kapitel 9
a) Besonderheiten der Kohlenstoff-Chemie 99
b) Nomenklatur der Kohlenwasserstoffe 100
c) Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe 103
d) Funktionelle Gruppen 105
e) Einführung in die Reaktionsmechanismen 107
f) Stereochemie I 112
Kapitel 10
Einfache Substitution am Kohlenstoff-Atom 117
Kapitel 11
Zweifache Substitution am Kohlenstoff-Atom 124
Kapitel 12
Drei- und vierfache Substitution am Kohlenstoff-Atom 129
Kapitel 13
a) Stereochemie I I 134
b) Hydroxysäuren 135
c) Hydroxyaldehyde und -ketone 136
d) Aminosäuren 139
Kapitel 14
a) Chromatographi e 141
b) Eiweißstoffe 143
c) Kohlenhydrate 146
d) Fette 149
Periodensystem 151
Kapitel 1
Die Kenntnis von der Natur der chemischen Bindung ist die Voraussetzung für das Verständ
nis der chemischen Stoffumwandlungen. Sie erfordert eine Vorstellung von dem Bau und der
Beschaffenheit der Atome, den kleinsten Teilchen der Materie, die noch die Eigenschaften
des ursprünglichen Stoffes zeigen.
a) Atombau
Bestandteile des Atoms sind der positiv geladene Atomkern und die negativ geladene Atom
hülle. Während die Atomhülle aus den Elementartei Ichen der Elektrizität, den negativ gela
denen Elektronen besteht, bauen die positiv geladenen Protonen zusammen mit den ladungs
freien Neutronen den Atomkern auf. Obwohl der Durchmesser des Atomkerns nur etwa
10-15 m beträgt, ist in ihm fast die gesamte Masse des Atoms vereinigt. Dagegen besitzt
jedes Elektron nur 18~0 der Masse des Wasserstoffatoms. Bei jedem neutralen, d.h. unge
ladenen Atom ist die Zahl der im Kern vereinten Protonen gleich der Zahl der in der Hülle
befindlichen Elektronen.
Ein anschauliches Bild vom Atom vermittelt das BOHRsche Atommodell. Hiernach umlaufen
die Elektronen den in Ruhe befindlichen Kern auf Kreisbahnen. Die an den Elektronen wirk
samen Zentrifugalkräfte verhindern dabei, daß die Elektronen infolge der elektrostatischen
Anziehung in den Kern fallen. Dennoch wäre diese Anordnung nicht stabil - die umlaufenden
Elektronen müßten ständig Energie abstrahlen und dadurch auf einer langsam sich veren
genden Spiralbahn in den Kern fallen -, wenn nicht bestimmte Bahnen ausgezeichnet ~ären,
auf denen der Umlauf ohne Energieabgabe erfolgte. Die Elektronen umkreisen den Kern da
her nicht in beliebigen, regellosen Abständen, sondern nur innerhalb ganz bestimmter räum
licher "Elektronenschalen". Es gibt sieben Schalen; sie werden mit arabischen Zahlen oder
großen Buchstaben bezeichnet. Der Zahlenfolge 1 ,2,3,4,5 ..• entspricht dabei die Buchsta
benfolge K,L,M,N,O ••. Jede Schale vermag nur eine bestimmte Zahl von Elektronen auf
zunehmen, die inneren weniger als die äußeren. Im Maximum kann jede Schale mit 2n2
(n = Nummer der Schale) Elektronen besetzt werden. Die K-Schale (n = 1) ist demnach
nach Einbau von zwei Elektronen, die L-Schale entsprechend nach Einbau von acht Elek
tronen gesättigt.
Doch schon bald nach seiner Entwicklung erwies es sich als unumgänglich, das BOHRsche
Atommodell zu verbessern. Denn einerseits lassen sich nach der HEISENBERGschen Un
schärferelation (s. Lehrbücher der anorganischen Chemie) die Aufenthaltsorte oder -bahnen
der Elektronen nicht so exakt lokalisieren, wie es durch das BOHRsche Modell geschieht.
Andererseits versagt das BOHRsche Modell bei der Anwendung auf die Mehrelektronen-
2
systeme höherer Elemente. Dies und die Erkenntnis, daß eine Quantelung der Energie der
Elektronen nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der "Schalen" erfolgt, führten zu
einem neuen, verfeinerten Atommodell.
Diesem verbesserten Modell zufolge bedeutet die Schalennummer n die Hauptquantenzahl. Zu
jeder Hauptquantenzahl n gehören n energetische Unterniveaus. Diese Unterniveaus wer
den mit der Nebenquantenzahl I symbolisiert, wobei I Werte von 0 bis (n-l) annehmen kann.
Für n=1 (K-Schale) gibt es nur ein einziges I, nämlich 1=0. für n=3 (M-Schale) gibt es
entsprechend 1=0, 1=1, 1=2, also drei energetische Unterniveaus. Nach den Namen der zu
gehörigen Spektralserien wird das Unterniveau 1=0 mit s, 1=1 mit p, 1=2 mit d und 1=3 mit
f bezeichnet. Die Nebenquantenzahl I ermöglicht es, die Elektronen der einzelnen "Schalen"
energetisch genauer zu charakterisieren.
2
n=1 1=0 (s) wegen 2n mit 2 Elpktronen besetzt
n=2 1=0 (s) " " 2 "
1=1 (p) " " " 6 " "
n=3 1=0 (s) " " 2 " "
1=1 (p) " 6 " " Abb.
1=2 (d) " 10 " "
n=4 1=0 (s) " " " 2
1=1 (p) " " 6 "
1=2 (d) " " " 10 "
1=3 (0 " " " 14 "
Die Räume, in denen sich die einzelnen, zu einer Nebenquantenzahl gehörenden Elektronen
aufhalten, können mathematisch näherungsweise bestimmt werden. Man nennt sie - quanten
mechanisch nicht ganz korrekt - Orbitale (s. Abb. 2). Diese besser als Elektronenwolken
zu bezeichnenden Aufenthaltsräume können im Magnetfeld energetisch weiter aufgespalten
werden. Die sich daraus ergebende Magnetquantenzahl m ist mathematisch folgendermaßen
mit der Nebenquantenzahl I verknüpft: m=21+1. Für 1=0 gibt es demzufolge nur eine Ein-
1%z ,'
.",JI?y-"""
Abb.2 Darstellung der s-, p- und d-Atomorbitale
3
stellungsmöglichkeit im Magnetfeld, für 1=1 drei, für 1=2 schon fünf und so weiter. Die Ein
zelwerte von m sind aus mathematischen Gründen so definiert, daß sie zwischen -I und + I
liegen:
1=0 Eine Einstellungsmögl ichkeit 0
1=1 Drei E instellungsmögl ichkeiten -1,0,+1
1=2 Fünf E instellungsmögl ichkeiten -2,-1,0,+1,+2
1=3 Sieben Einstellungsmögl ichkeiten -3,-2,-1,0,+1,+2,+3
Daraus geht hervor, daß es beispielsweise für die sechs zur Nebenquantenzahl 1=1 gehö
renden EI ektronen drei gleichwertige Aufenthaltsräume (p-Orbitale) gibt, deren energetische
Ungleichwertigkeit erst im Magnetfeld zutage tritt. Diese äußert sich in unterschiedlichen
Orientierungen der Orbitale im Magnetfeld (p , p , p entlang den drei Raumachsen).
x y z
Eine vierte und letzte Möglichkeit der Energiequantelung ist durch die Eigenrotation der
Elektronen gegeben. Sie kann im oder gegen den Uhrzeigersinn erfol gen und besitzt dann
als Spinquantenzahl s die Werte s=+~ oder s=-~. Die gebrochenen Werte sind auf mathema
tische Besonderheiten der Quantenmechanik zurückzuführen.
Die vier Quantenzahlen ermöglichen eine genaue Bestimmung der Elektronenzustände. Nach
dem von PAULI 1925 aufgestellten Prinzip dürfen in einem Atom niemals zwei Elektronen
in allen vier Quantenzahlen übereinstimmen. Sie müssen sich mindestens in einer Quanten-
zahl unterscheiden.
Die einzelnen Atome der rund hundert Elemente unterscheiden sich durch ihre verschiede
nen Kernladungszahlen (Zahl der Protonen im Kern). Das einfachste Atom ist das Wasser
stoffatom mit der Kernladungszahl 1, es folgen die Elemente Helium und Lithium mit den
Atomkernladungszahlen 2 und 3. Nach dem modernen Atommodell können in den zur Haupt
quantenzahl n=l gehörenden Energieniveaus (1=0, m=O, s=+~ oder -~) nur zwei Elektronen
untergebracht werden, folglich findet das beim Lithium neu hinzukomrr,ende Elektron dort
keinen Platz mehr, es wird in dem niedrigsten Energieniveau der Hauptquantenzahl 2 unter
gebracht. Bei den nachfolgenden Elementen Bery llium bis Neon dienen die neu hinzukommen
den Elektronen zur Auffüllung der zu n=2 gehörenden Unterniveaus (ein s- und drei p-Orbi
tale, bis beim Natrium (Ordnungszahl 11) mit einer neuen Hauptquantenzahl begonnen wird.
Der' Einbau der Elektronen erfolgt nun in gleicher Weise bis zum Element 18, dem Edelgas
Argon. Dann allerdings werden beim nachfolgenden Kalium schon Energieniveaus der Haupt
quantenzahl n=4 besetzt, obwohl die Besetzung der Energieniveaus von n=3 noch nicht ab
geschlossen ist. Die Auffüllung dieser Plätze beginnt erst nach dem folgenden Element, dem
Calcium, bei den Übergangselementen Scandium bis Zink. Diese Unregelmäßigkeit ist darauf
zurückzuführen, daß die 4s-0rbitale energetisch für den Elektroneneinschub günstiger lie
gen, als die 3d-Orbitale. Ähnliche Erscheinungen beobachtet man auch bei den höheren Ele
menten (s. Lehrbücher der anorganischen Chemi e).
Stellt man die Atomorbitale durch Kästchen dar und symbolisiert die Elektronen durch
Pfeile, die durch ihre Richtung gleichzeitig die beiden unterschiedlichen Spin-Einstellungen