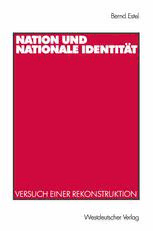Table Of ContentBernd Estel
Nation und nationale Identität
Bernd Este!
Nation und
nationale Identität
Versuch einer Rekonstruktion
Westdeutscher Verlag
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhältlich
1. Auflage Mai 2002
Alle Rechte vorbehalten
© Westdeutscher Verlag GmbH, Wiesbaden 2002
Der Westdeutsche Verlag ist ein Unternehmen der Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer.
www.westdeutschervlg.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne
der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jeder
mann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung: Horst Dieter Bürkle, Darmstadt
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
ISBN 978-3-531-13778-0 ISBN 978-3-663-05641-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-05641-6
Vorwort
Das vorliegende Buch ist das Hauptergebnis einer bald zwanzigjährigen wissen
schaftlichen Auseinandersetzung mit der modemen Nation als realer Erscheinung
und als über zweihundert Jahre altem sozialwissenschaftlichem Thema. Eine solche
Auseinandersetzung erfolgt nicht nur in - Phasen der - Einsamkeit und Freiheit,
sondern auch durch Gespräche und Diskussionen mit anderen, mit Freunden und
Bekannten, mit Fachkollegen und der Sache verbundenen Angehörigen anderer
Fächer. Deren Beitrag zum schließlichen Produkt ist zwar nicht genau zu bestim
men, fällt aber meistens beträchtlicher aus, als selbst redliche Verfasser sich einzu
gestehen bereit sind. Schon aufgrund der ins Land gegangenen Jahre und entspre
chend ungenauer Erinnerung ist es mir freilich schlecht möglich, sie alle aufzuzäh
len. In jedem Fall sind hier jedoch die Professoren Hans Braun (Trier), Michael
Diehl (Tübingen), Alois Hahn (Trier), Wolfgang Lipp, Tilman Mayer (Bonn), John
P. Neelsen (Verdun), ferner die Herren Bert Hardin, Günther Nietsch (heide Tübin
gen) sowie Siegfried Weichlein (Berlin) zu nennen, die durch fachlichen Rat, aber
auch persönliche, mir schwer entbehrliche Aufmunterung zur Fertigstellung dieser
Arbeit beigetragen haben. Herzlichen Dank an sie alle! Weil die Arbeit auch als
Habilitationsschrift, und zwar der Fakultät für Sozial-und Verhaltenswissenschaften
an der Universität Tübingen vorgelegt worden ist, bin ich außerdem den Professoren
Christoph Deutschmann, Gottfried Korff (beide Tübingen), Reinhard Kreckel (Hal
le), Dieter Langewiesehe (Tübingen) und wiederum Wolfg ang Lipp für die ihnen
daraus erwachsene Mühe sehr dankbar. Denn sie haben die Aufgabe übernommen,
die nötigen fakultätsoffiziellen Gutachten zu dieser ja umfangreichen Schrift zu
verfassen.
Schließlich bleibt mir einer gewissen GWE zu danken, die auf ihre Weise die
Entstehung des Buchs gefördert hat, und ihre Knechtung durch mich noch immer
mit ziemlicher Geduld erträgt.
Tübingen, im Dezember 200 I B.E.
Inhalt
Einleitung........................................................................................................ 11
I. Nation und Verwandtes: Begrimiche Vorklärungen und
historische Aspekte
1.1 Die historische Entwicklung des Nationsverständnisses:
Eine Skizze.......................................................................................... 23
1.1.1 Zum vormodemen Verständnis von Nation............................ 23
1.1.2 Die Zäsur von 1789 und die ideelle Fortwirkung des
vormodemen Nationsverständnisses............... ....... ................. 27
1.2 Definitionen................................... .............. ..... ..... ............................. 28
1.2.1 Vorbemerkung......................................................................... 28
1.2.2 Objektive und subjektive Komponenten ethnischer
Gruppen................................................................................... 30
Exkurs 1: Alternativen zum Etbnozentrismus..................................... 33
1.2.3 Volk, Nation und Nationalismus............................................. 35
1.3 Zur Frage der Existenz von modemen Nationen bereits im
Mittelalter............................................................................................ 42
1.3.1 Die Situation bei den Westslawen und in Frankreich.............. 43
1.3.2 Die Situation in Deutschland................................................... 48
Exkurs 2: Der politische Grunddualismus im Römisch-
Deutschen Reich................................................................................. 52
1.3.3 Fazit......................................................................................... 54
1.4 Grundauffassungen der modemen Nation und gegenwärtige
konzeptuelle Tendenzen...................................................................... 57
1.4.1 Zum Konzept der Staatsnation und des nation-bui1ding.......... 58
1.4.2 Nation als Ku1tur-und Willensnation...................................... 61
1.4.3 Aktuelle Konzepte der Nation................................................. 66
11. Nation als Wissenskonstrukt
11.1 Analytische Grundunterscheidungen........................................ .......... 70
11.2 Die Rolle kollektiver Gemeinsamkeiten............................................. 76
11.2.1 Der Beitrag der" objektiven" Faktoren.................................... 77
11.2.2 Gemeinsamkeiten und Gemeinschaftstypen............................ 82
11.3 Konstitution und Charakter nationaler Identität.................................. 91
11.3.1 Verfahren der kognitiven Nationsstiftung................ .... ........... 91
8 Inhalt
11.3.2 Prä-Gemeinschaften und nomisches Wissen........................... 101
11.3.3 Struktur und Typen nationaler Identitäten............................... 108
III. Nation als idee-force
III.l Nationalbewegung und Massenattraktivität nationalen Wissens........ 129
111.1.1 Soziale Träger und Phasen der nationalen Bewegungen.. ....... 129
III.l.2 Nationale Verheißungen oder die Zugkraft des
Nationalismus.......................................................................... 136
III.l.3 Wissensinterne Erfolgsbedingungen nationaler Identitäts-
entwürfe..... .......... ..... ...... ..... ........ ...... ..... ... .......... ..... ...... ......... 145
111.2 Perspektiven und Grundprozesse der Nationsverwirklichung ........... 152
111.2.1 Zielsetzungen der modemen Nation als Gemeinschaft oder
Nation als (Bürger)Kriegsgrund.............................................. 155
111.2.2 Nation, nationale Identität und allgemeine Grenzen ihrer
sozialen Durchsetzung............ ................................................. 171
111.2.3 Aspekte der personalen Nationalisierung................................ 182
IV. Die Nationalisierung des Daseins
IV. 1 Vorbemerkung: Typen der Nationalisierung...................................... 195
Exkurs 3: Die Nationalisierung der Hochkultur. Eine theoretische
Skizze....................................................................................... 200
IV.2 Der Bereich der Politik........... .......... ....... ..... ...... ....... ..... ....... ..... ........ 203
IV.2.1 Umrisse der territorialstaatlich-absolutistischen Herrschafts
organisation und die politische Ausgangskonstellation der
Revolution von 1789................................................................ 203
IV.2.2 "Republik" und "Nation": Politische Gemeinschaft bei
Rousseau und Sieyes.... ........ ... ......... ..... ...... ....... ..... ....... ..... ..... 211
IV.2.3 Intentionen, Ausprägungen und Folgen nationaldemokrati-
scher Herrschaft............... ............ ... .......... ..... ....... ..... ....... ..... 227
IV.2.3.1 "Einheit der Nation -Einheit des nationalen
Willens!"................................................................. 232
IV.2.3.2 Echte und unechte Formen der Volkssouveränität:
Reale staatliche Modelle....... ... ....... ....... ....... ..... ..... 248
Exkurs 4: Verfassungsstaat Bundesrepublik Deutschland.................. 253
IV.2.3.3 Politische Konsequenzen der offiziellen
Volksherrschaft.. ........ .......... ..... .............. ... .... ..... .... 261
IV.3 Aspekte der wirtschaftlichen Nationalisierung................................... 274
IV.3.1 Reale und ideelle Nationalisierung: Ein Überblick................. 274
IV.3.2 Entstehung und historische Typen der modemen
Volkswirtschaft........... ................ ........... ........ ... ......... .......... .... 280
IV.3.2.1 Der Deutsche Zollverein......................................... 285
IV.3.3 Ideelle Nationalisierung: Drei Entwürfe.................................. 299
Inhalt 9
IV.3.3.1 "Das nationale System der politischen Ökono-
mie": Friedrich List................................................. 300
IV.3.3.2 Die historische Schule der Nationalökonomie:
Karl Knies.......... ..................................................... 310
IV.3.3.3 "Wir ökonomischen Nationalisten": Max Weber... 316
V. Die äußeren Folgen des Prinzips Nation: Der Fall des
europäisch-westlichen Imperialismus
V.I Imperialismus überhaupt und Grundmerkmale des Imperialismus
vor dem I. Weltkrieg.............................. ............................................ 347
V.2 Expansion und Expansionsziele der einzelnen Imperialmächte......... 356
V.3 Ursachen des Expansionsdrangs......................................................... 367
V.3.1 Die grundlegende Konstellation.............................................. 367
V.3.2 Nichtideelle Beweggründe....................................................... 373
Exkurs 5: Imperialismus als "Sozialimperialismus"........................... 378
V.3.3 Ideelle Beweggründe............................................................... 387
V.3.3.1 Kulturimperialismus und nationale Sendungsvor-
stellungen................................................................ 387
V.3.3.2 Sozialdarwinismus.................................................. 392
V.3.4 Nachbemerkung: Zum Niedergang des klassischen
Imperialismus.......................................................................... 400
VI. Die moderne Nation - heute
VI. 1 Vorbemerkung: Zeitgeschichtliche Zäsuren im Transformationspro-
zess der modemen Nation............................ .................................. 40 I
VI.2 Äußere Herausforderungen: Das Ende der Nation als wirtschaft-
licher und politischer Besonderung?................................................... 407
V1.2.1 Stichwort Globalisierung.................................................. ....... 407
VI.2.2 Umrisse und sozio-ökonomische Folgen der wirtschaftlichen
Globalisierung.......................................................................... 412
VI.2.3 Internationale Institutionen (Regimes, Organisationen) und
Großraumbildung. ........ .............. .................. .... ........................ 429
VI.2.4 Globalisierungsprozesse und nationale Souveränität:
Abschließende Erörterung....................................................... 437
VI.2.4.1 Auswirkungen auf die staatliche Souveränität....... 438
VI.2.4.2 Auswirkungen auf die Volkssouveränität............... 450
VI.3 Innere Herausforderungen der Nation............... ............ ...................... 462
VI.3.1 Tendenzen der personalen Entnationalisierung....................... 463
VI.3.1.1 Transnationale Angleichungs-und innergesell-
schaftliche DifIerenzierungsprozesse..................... 463
10 Inhalt
VI.3.1.2 Sozio-ökonomische Individualisierung und perso- 466
nale Individuierung ................................................ .
VI.3.2 Pluralisierungsprozesse............................................................ 472
V1.3.2.1 Erscheinungsformen und nationale Folgen des
kulturellen Pluralismus........................................... 472
VI.3.2.2 Ethnische Pluralisierung: Die Bildung neuer
Minderheiten........................................................... 478
Exkurs 6: Kultur als Konfliktgrund.. .. .......... ........... ....... ... ..... ..... ........ 485
VII. Schlusswort 496
Literaturverzeichnis....... ....... ..... ....... ....... .... ....... ..... ...... ....... ..... ....... ..... ... ...... 502
Einleitung
Nation und Nationalismus besitzen unter den gebildeteren Deutschen schon seit
langem einen schlechten Ruf. Die Nation bzw. ihre personale Bejahung brächte, so
heißt es auch unter den Sozialwissenschaftlem, verheerende praktische Folgen mit
sich, die von törichtem Nationalstolz zu aggressiver Fremdenfeindlichkeit, von äu
ßeren und manchmal auch inneren Kriegen bis zur Vertreibung, ja Ausrottung un
liebsamer Minderheiten und ganzer Völker reichten. Allerdings ist die Ablehnung
aus solchen praktischen Gründen nicht gerade konsequent: Typischerweise gilt sie
dann doch nur der eigenen, der deutschen Nation, während etwa die britische und
französische Nation (um von den USA zu schweigen), die schließlich vor wie nach
1789 mehr Kriege als die anderen Europäer geführt haben, kaum Kritik zu treffen
pflegt, sie vielmehr oft Gegenstand einer wenig oder gar nicht verhohlenen Bewun
derung sind. Wissenschaftlich entspricht dieser Uneinheitlichkeit bzw. Inkonsistenz
des Urteils eine ebenfalls ältere, wenn auch nie allgemein geteilte Unterscheidung
zwischen einer guten und einer schlechten Nation, deren reifste Ausprägung wohl
die von Smith (1986, 1991) vorgenommene Gegenüberstellung eines "westlichen"
oder "staatsbürgerlichen" Nationsmodells und eines "ethnischen" Nationsmodells
darstellt. Dies ändert jedoch nichts daran, dass, jedenfalls in der deutschen Soziolo
gie, die negative Beurteilung von Nation und Nationalismus seit dem 2. Weltkrieg
klar überWog und noch immer überwiegt - und dies trotz der Ereignisse von 1989 -
1991 und ihren durchaus unterschiedlichen Konsequenzen für alte und neue
Nationen des ehemaligen Ostblocks.
Dieses Grundurteil, das nach seiner moralischen Qualität und Berechtigung hier
nicht interessiert, hat nun, in den letzten Jahrzehnten, ohne Zweifel bestimmte Wei
chenstellungen innerhalb der Nationsforschung gefördert. An erster Stelle ist hier
die Verdrängung der betreffenden Wirklichkeit selbst zugunsten des Wissens - im
Sinne der neueren Wissenssoziologie! - von ihr zu nennen: Entweder wird die
Nation als eine eigene Realität ausgeblendet, sodass lediglich der Nationalismus mit
seiner, wie es nicht zufällig heißt, "ideologischen Armut und Widersprüchlichkeit"
(Elwert 1989: 441), seine geistigen Urheber ("furchtbar-fruchtbare Ideologen") und,
faktisch freilich wenig beachtet, die "Verfiihrbarkeit" von Massen übrigbleiben. Ein
gutes Beispiel für diese Art des Vorgehens ist eine Arbeit Giesens (1993) über "die
Intellektuellen und die Nation", in der er zwar bei der Nation und ihrer wissen
schaftlichen Behandlung ansetzt, sie aber bald ,,kulturalistisch" auflöst. Und zwar
so, dass er sie als ,,Bilder, Vorstellungen und Mythen" verstanden wissen möchte,
"die in einer kulturellen Tradition enthalten sind" und sich in den verschiedenen
,,Konstruktionen" der ,,nationalen Identität" niederschlagen (a.a.O., 10 und 23f.).
12 Einleitung
Auf diese Weise wird es ihm rasch möglich, im wesentlichen nur noch (a) von In
tellektuellen produziertes nationales Wissen des 18. und 19. Jahrhunderts zu behan
deln, d.h. aufeinander folgende Entwürfe bzw. Versionen der deutschen Identität, die
damit den Status einer etablierten Identität genau nicht besaßen und nicht besitzen
konnten. Ferner (b) die ihre Produktion antreibenden Motive ihrer Urheber wie z.B.
die Erfahrung mangelnder sozialer Anerkennung, die als wenig schmeichelhaft gel
ten ("Suche der Enttäuschten und Ausgeschlossenen"), stets aber personbezogen
oder -gebunden und damit nichtnationaler Natur sind. Und schließlich (c) sozial
strukturelle Gegebenheiten wie ,,Karrierestau", die wiederum für sie verantwortlich
seien (a.a.O., 19f.; vgl. 1991: 275ff.). Nirgendwo aber werden diese Entwürfe sys
tematisch auf ihr sachliches Gegenstück, die äußeren und inneren Lagen bzw. Prob
leme der sich neu bildenden Nation bezogen.-Oder die Nation bleibt grundsätzlich
erhalten, wird aber ihrerseits, ganz oder doch primär, als Wissen bestimmt. Für Lep
sius etwa ist die Nation "eine gedachte Ordnung, eine kulturell definierte Vorstel
lung, die eine Kollektivität von Menschen als eine Einheit bestimmt" (1982: l3; vgl.
1981: 440). Sind mit dieser allgemeinen Definition immerhin noch recht unter
schiedliche Nationsausprägungen (wie "Volks"-, ,,Kultur"- und selbst ,,Klassen
nation") verträglich, so nicht mehr mit der von ihm favorisierten Variante der
"Staats(bürger)nation". Sie ist sozusagen gedachte Ordnung in zweiter Potenz, näm
lich das Produkt einer anderen, erst nur als Anspruch bestehenden Ordnung. Näm
lich einer "Verfassungsordnung", die nach ihrem Selbstverständnis in ihrem Kern
unantastbar ist, zugleich aber den Anspruch erhebt, für eine Vielzahl von Menschen
zu gelten und sie eben zu einer Staats(bürger)nation zusammenzuschließen - die
freilich genau nicht mehr pouvoir constituant, sondern constitue ist. Und tatsächlich,
diese Verfassungsordnung ist, jedenfalls innerhalb eines, einen Teil Europas bilden
den Landes, zu einem ,,räumlichen Geltungsbereich" gekommen, in dem die eigent
liche Herrschaft über die Menschen folglich bei ihr liegt. Dass aber dieser Geltungs
bereich ,,Personengruppen" zerschnitten oder abgetrennt hat, die mit dem so ent
standenen Staatsvolk "ethnisch oder kulturell oder historisch Merkmalsgleichheit"
aufweisen, besagt für sie überhaupt nichts (1982: 23f.). Wie anders noch die Haltung
eines Max Weber, dem "die Interessen und Aufgaben" der Nation "turmhoch" über
"allen Fragen der politischen Form überhaupt", und ausdrücklich: "ihrer Staatsform"
standen (1988: 449; vgl. 306 und 309), dem also eine Verfassung nicht eine nur auf
sich selbst bedachte, ja herrschsüchtige Quasi-Person, sondern ein bloßes, mehr oder
minder zweckmäßiges Mittel im Dienst der sich selbst bestimmenden Nation war!
Schließlich bleibt Richter (1994) zu erwähnen, der die Nation als ,.,sozial kons
truiertes Deutungsmuster" begriffen wissen möchte: Nicht etwa faktische Grenzen
bzw. für die Alltagspraxis der Menschen bedeutsame Unterschiede sind es, die hier
zur nationsstiftenden Grunddifferenz von ,,'Wir' und 'Sie'" führen, sondern bloße
,,semantische Grenzziehungen". Wird diese Differenz aber "werthaft" aufgeladen,
kommt es nach Richter zu einer ,,Binarisierung der WeItsicht ('Wir' oder 'Sie')",
mit der zwangsläufig ,,Irrationalität und Emotionalität" verbunden seien. Nation ist
so ein intrapersonaler kognitiver Mechanismus (!), der immerhin noch in doppelter